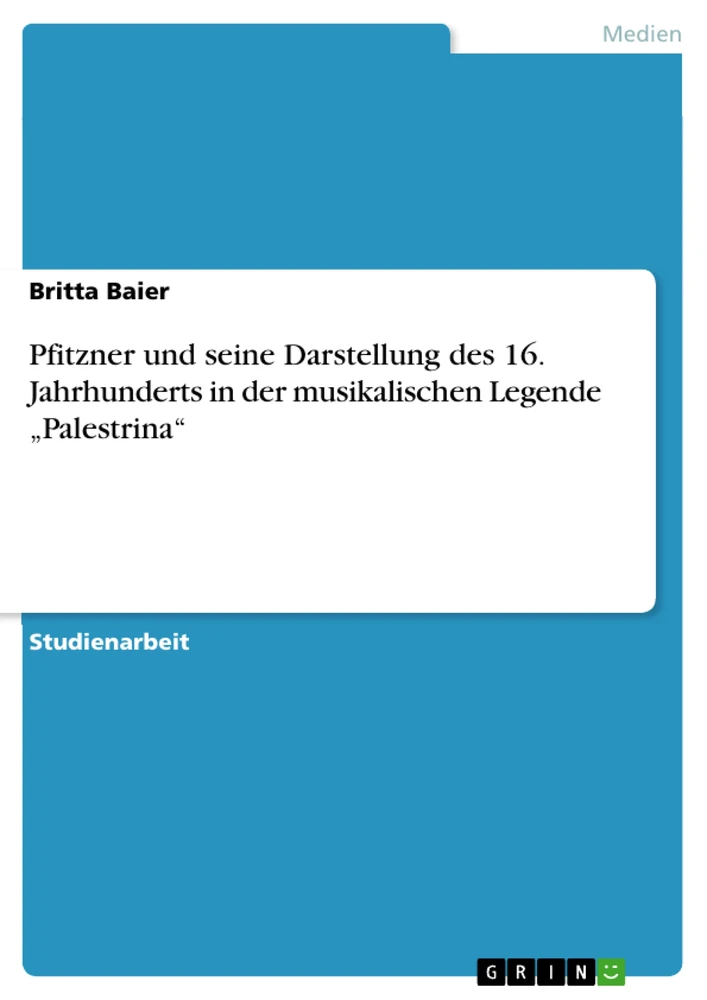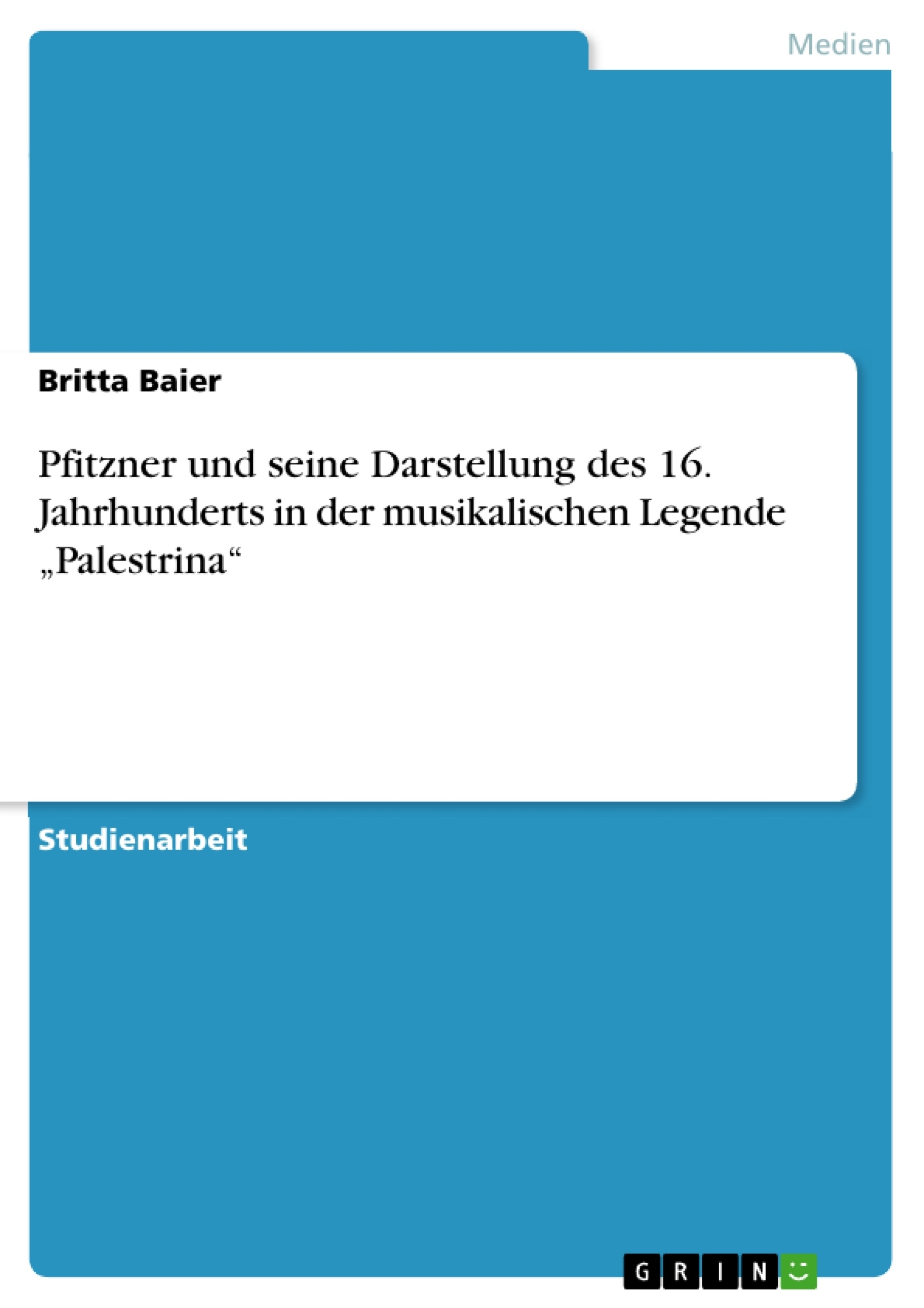Die musikalische Legende Palestrina wird sowohl von weiten Kreisen der Fachliteratur als auch vom Komponisten selbst als sein Hauptwerk bezeichnet. Der Komposition wurde von Pfitzners musikdramatischen Schöpfungen die größte öffentliche Aufmerksamkeit zuteil, wenngleich ein internationaler Bekanntheitsgrad bis heute nicht erreicht wurde. Rectanus äußert sich in seiner Schrift Leitmotivik und Form begeistert zu der Komposition:
„Außergewöhnliche und bedeutsame Züge heben dieses Werk aus dem gesamten musikdramatischen Schaffen des Meisters und seiner Zeit heraus und verleihen ihm den Stempel des Epochalen und Großen.“
Tatsächlich sind einige Aspekte des Palestrina als außergewöhnlich zu bezeichnen. Die Urzelle des Werks, das von Pfitzner selbst geschriebene Libretto, ist von sehr hoher Qualität und wurde in vielen Aufsätzen gänzlich unabhängig von Pfitzners Musik besprochen. Die Dichtung war vollständig vor dem Beginn der musikalischen Ausarbeitung abgefasst. Der dramaturgische Aufbau der Handlung ist höchst unüblich und hat in den Rezensionen damals und heute viel Kritik und Unverständnis hervorgerufen: Der eigentliche Höhepunkt in Bezug auf Spannung und Intensität des Werks liegt klar im ersten Akt, in der Inspirationsszene, danach folgen jedoch, je nach Aufführung, noch circa zwei Stunden Musiktheater. Pfitzner musste sich gegen zahlreiche Vorwürfe verteidigen, allen voran den, dass der zweite Akt schlichtweg überflüssig sei. In einer Schrift Pfitzners über sein Werk berichtet er von Theaterdirektoren, die ihm vorschlugen, den zweiten Akt doch in verkürzter Form von einem Conférencier erzählen zu lassen. Es ist sicher hinterfragenswert, ob die dramatische Konzeption, aus rein pragmatischer Sicht und vor allem aus Perspektive der Rezipienten, klug angelegt ist. Die Art der Konzeption liegt jedoch in Pfitzners intendierter Philosophie der Oper begründet, auf die in den Kapitelpunkten II.4 und II.6 noch genauer eingegangen wird. Sie ist daher nicht leichtfertig veränderbar.
Auch musikalisch bietet das Werk kontroverses und interessantes Material: Thomas Mann bezeichnete den Palestrina, unter anderem mit Blick auf die morbiden Elemente der Komposition, als „Grabgesang der romantischen Oper“. Es verbinden sich in ihr vielfältige Elemente der Rückgewandtheit, Zitate sowohl aus Palestrinas Werken, Werken von Bach und Luther, sowie aus Pfitzners eigenen Kompositionen...
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Hinführung zur zentralen Fragestellung
- II. Hauptteil
- 1. Stoffquelle und Abriss der Handlung
- 2. Palestrina und sein Werk im historischen Kontext
- 3. Pfitzners musikalisches Schaffen
- 4. Musikalisches Material und Zitate im Werk
- 5. Historizität der Umsetzung
- 6. Philosophischer Überbau
- III. Schluss: Deutungsansätze
- IV. Literaturverzeichnis
- Die Rolle der Legende Palestrinas und ihre Verbindung zur tatsächlichen Geschichte des Komponisten
- Die musikalische und dramaturgische Umsetzung des 16. Jahrhunderts in der Oper
- Pfitzners musikalische Sprache und sein Bezug auf die Werke von Palestrina, Bach, Luther und anderen Komponisten
- Der Einfluss des Tridentiner Konzils und die Darstellung der Kirchenmusik im 16. Jahrhundert
- Die Philosophie und Intentionen Pfitzners in Bezug auf seine Oper
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die musikalische Legende „Palestrina“ von Hans Pfitzner und beleuchtet insbesondere die Darstellung des 16. Jahrhunderts in diesem Werk. Die Zielsetzung liegt darin, zu analysieren, inwieweit Pfitzners Oper eine historische Darstellung des 16. Jahrhunderts bietet, welche musikalischen und gesellschaftlichen Elemente er in seiner Komposition verwendet und welche Intentionen hinter seiner Darstellung stehen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Hinführung zur zentralen Fragestellung
Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die musikalische Legende „Palestrina“ von Hans Pfitzner und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor, welche die Darstellung des 16. Jahrhunderts in der Oper untersucht. Die Einleitung verweist auf die Bedeutung des Werks für Pfitzners Schaffen und beleuchtet dessen besondere Aspekte, wie die Qualität des Librettos und die ungewöhnliche dramaturgische Struktur.
II. Hauptteil
1. Stoffquelle und Abriss der Handlung
Dieses Kapitel beleuchtet die Legende, die der Oper zugrunde liegt, und stellt die wichtigsten Handlungselemente der drei Akte dar. Es werden die Hauptfiguren und ihre Beziehungen zueinander vorgestellt, sowie die Konzeption der Messe und die Darstellung des Tridentiner Konzils.
2. Palestrina und sein Werk im historischen Kontext
Dieses Kapitel befasst sich mit dem historischen Kontext, in dem Palestrina lebte und wirkte. Es beleuchtet den Stand der Kirchenmusik im 16. Jahrhundert und die Rolle des Tridentiner Konzils. Darüber hinaus werden die Werke Palestrinas und deren Bedeutung für die Musikgeschichte vorgestellt.
3. Pfitzners musikalisches Schaffen
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Pfitzners musikalisches Schaffen und seine kompositorischen Stilelemente. Es werden die Einflüsse anderer Komponisten, wie Wagner, Beethoven und Mozart, sowie die Leitmotivtechnik und andere musikalische Besonderheiten behandelt.
4. Musikalisches Material und Zitate im Werk
Dieses Kapitel befasst sich mit der musikalischen Gestaltung der Oper und analysiert die verwendeten musikalischen Materialien. Es untersucht die Zitate aus Palestrinas Werken, aus Werken von Bach und Luther, sowie aus Pfitzners eigenen Kompositionen.
Schlüsselwörter
Hans Pfitzner, „Palestrina“, musikalische Legende, 16. Jahrhundert, Kirchenmusik, Tridentiner Konzil, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Missa Papae Marcelli, Leitmotivtechnik, historische Oper, Dramaturgie, Musiktheater, Musikgeschichte, Opernphilosophie.
- Quote paper
- Britta Baier (Author), 2011, Pfitzner und seine Darstellung des 16. Jahrhunderts in der musikalischen Legende „Palestrina“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189937