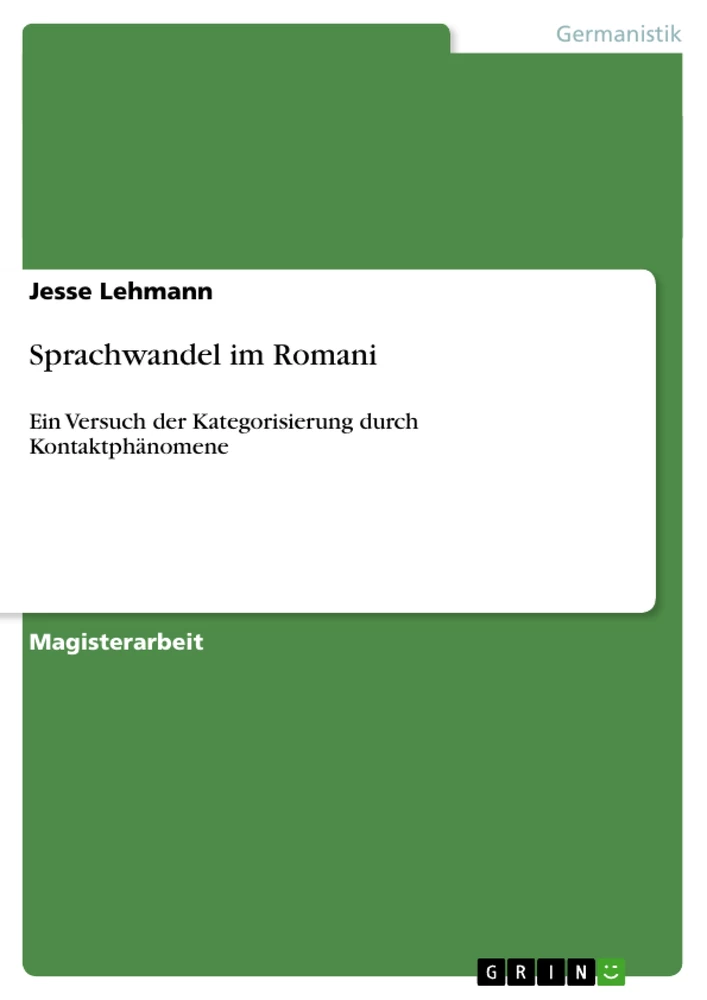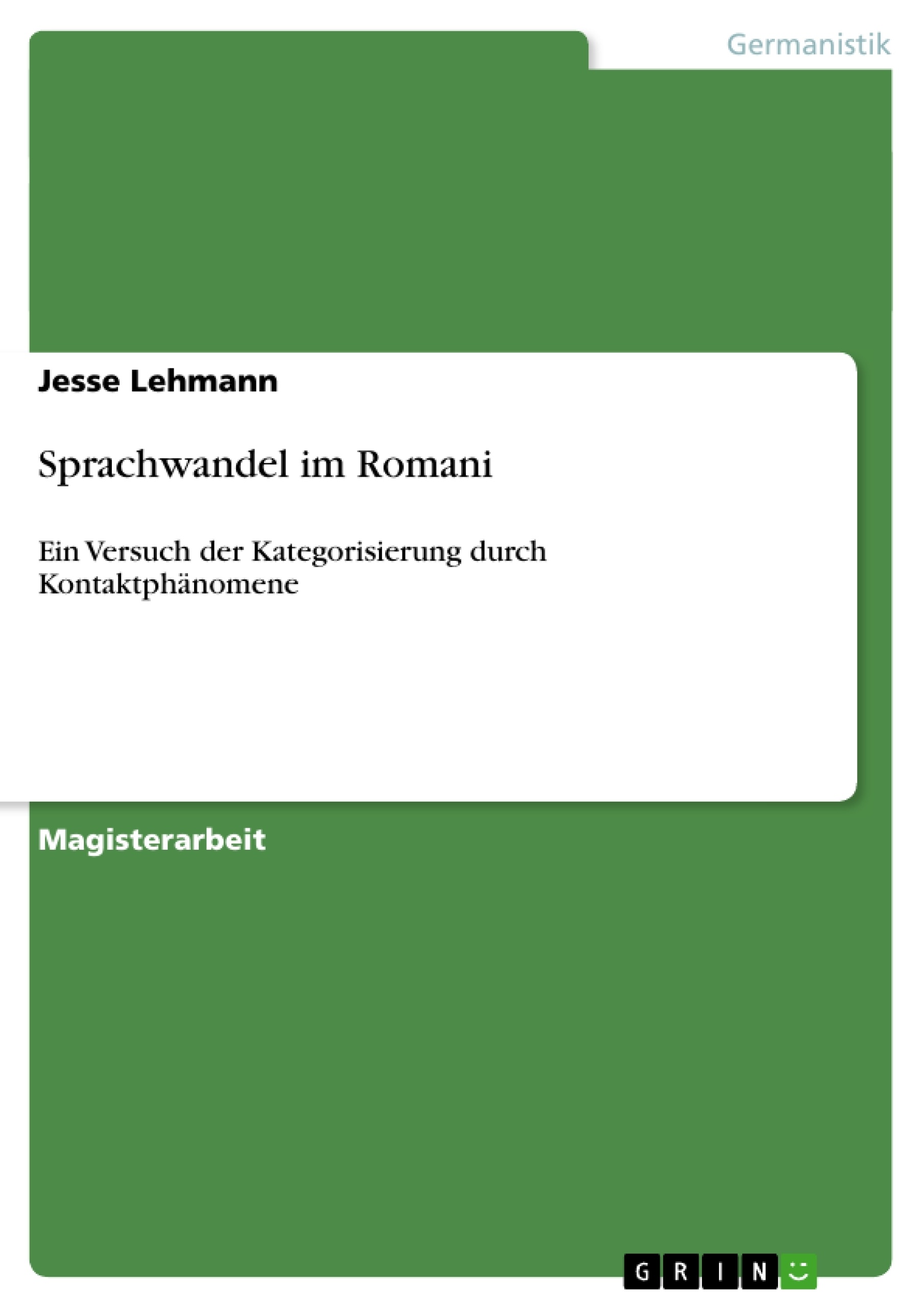Gegenstand der Arbeit ist das Romani, die Sprache der Zigeuner. Bei genauerer Betrachtung des Untersuchungsmaterials fällt auf, dass der Anteil an deutschem Vokabular im lexikalischen Teilbereich der Funktionswörter, zu denen allen voran Elemente wie Konjunktionen und Subjunktionen, Artikel, Pronomina sowie Adpositionen und Partikel gehören, besonders hoch ist. Aber der Teilbereich der Inhaltswörter, zu denen Nomina, Adjektive und Verben gehören, besteht zu einem besonders hohen Anteil aus Vokabular des Romanes. Desweiteren stammen die Flexionsaffixe beinahe ausschließlich aus dem Deutschen. Für die Filial- oder Hybridsprache, die aus Bestandteilen sowohl des Deutschen als auch des Romanes aufgebaut ist, lässt sich somit durchaus behaupten, dass die Grammatik deutschen Ursprungs ist und das Vokabular dem Romanes entnommen ist.
Die traditionelle Substrat-Superstrat-Theorie, wie sie hier näher erläutert wird, würde eine vollkommen gegenläufige Tendenz erwarten lassen. Kurz gefasst besagt dieses Sprachkontaktmuster, dass eine prestigereichere Sprache (das sogenannte Superstrat) einer durch Sprachmischung entstandenen Sprache das Lexikon vererbt und eine prestigeärmere Sprache (das sogenannte Substrat) jener entstandenen Sprache die Grammatik mitsamt dem morphologischen, morphosyntaktischen, syntaktischen und syntagmatischen Regelwerk vererbt. Das Deutsche müsste demnach als die Amts- und Prestigesprache in Deutschland und daher als Superstrat angesehen einer Mischsprache das Lexikon spenden. Das Romanes, das von einer sozial schwachen sowie prestigearmen Schicht gesprochen wird, müsste der Mischsprache demnach die Grammatik spenden. Doch wird diese Annahme durch die folgenden Sprachbeispiele völlig widerlegt. Die vorliegende Arbeit geht also von dem Standpunkt aus, dass das traditionelle Sprachkontaktmuster nach dem Ansatz der Substrat-Superstrat-Theorie keine Anwendung auf den Sprachkontakt Deutsch-Romanes finden kann. Die Arbeitshypothese lässt sich daher etwa folgendermaßen formulieren: Die Sprachmischungsuniversalien, wie sie sich die Forschung gerne zurecht legt, sind nicht universal, sondern können durch die folgenden Sprachbeispiele falsifiziert werden. Die Substrat-Superstrat-Theorie wird durch den Sprachkontaktfall Deutsch-Romanes völlig umgekehrt.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Vorbemerkungen
- 0.1. Gegenstand der Arbeit und Hinführung zum Thema
- 0.2. Arbeitshypothese und Methodik
- 0.3. Festlegungen
- 0.3.1. Begriffliche Festlegungen
- 0.3.2. Orthographie
- 0.3.3. Glossierungsregeln
- 0.3.4. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Darstellung des Untersuchungsmaterials
- 2. Analyse des Materials
- 2.1. Analyse des Materials in Bezug auf Interferenzen
- 2.2. Zweifelsfälle der Interferenz und deren Ausschluss
- 2.3. Ausarbeitung der Interferenzen
- 2.3.1. Hybridität im Lexikon
- 2.3.2. Hybridität in der Morphosyntax
- 2.3.3. Hybridität in der Syntax
- 2.4. Übersicht über die hybriden Sprachmuster
- 3. Versuch der Einordnung in bestehende Sprachkontaktmechanismen
- 3.1. Einführung der Sprachkontaktmechanismen
- 3.1.1. Substrat-Superstrat
- 3.1.1.1. Substrat
- 3.1.1.2. Superstrat
- 3.1.1.3. Diskussion der Zuordnungsmöglichkeit
- 3.1.2. Adstrat
- 3.1.3. Sprachbund und Sprachgemeinschaft
- 3.1.3.1. Sprachbund
- 3.1.3.2. Sprachgemeinschaft
- 3.1.3.3. Diskussion der Zuordnungsmöglichkeit
- 3.1.4. Pidginisierung
- 3.1.5. Kreolisierung
- 3.1.6. Sprachtod
- 3.1.6.1. Language Murder
- 3.1.6.2. Language Suicide
- 3.1.6.3. Diskussion der Zuordnungsmöglichkeit
- 3.1.7. Code-Switching
- 3.1.7.1. Äquivalenzmodell
- 3.1.7.2. Generatives Phrasenstrukturmodell
- 3.1.7.3. Dependenzmodell
- 3.1.7.4. Morphemhypothese
- 3.1.7.5. Konzept der Auslösefunktion
- 3.1.7.6. Matrix-Language-Frame
- 3.1.1. Substrat-Superstrat
- 3.2. Überblick über die Zuordnungsmöglichkeiten
- 3.1. Einführung der Sprachkontaktmechanismen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, den Sprachwandel im Romani zu untersuchen, indem sie Kontaktphänomene als Kategorien für diesen Wandel nutzt. Dabei wird ein spezifischer Dialekt des Romanes, das Romanes, als Untersuchungsmaterial herangezogen. Ziel ist es, die Veränderungen im Romani zu verstehen und einzuordnen, um ein tieferes Verständnis der Sprache und ihrer Entwicklung zu gewinnen.
- Die Rolle von Kontaktphänomenen bei der Veränderung des Romani
- Die Analyse von Hybridisierungsphänomenen im Lexikon, der Morphosyntax und der Syntax des Romanes
- Die Einordnung der beobachteten Sprachwandelprozesse in etablierte Sprachkontaktmechanismen
- Die Untersuchung der Besonderheiten des Romanes im Vergleich zu anderen Romani-Dialekten
- Die Herausarbeitung der Bedeutung von Sprache für die Identität und Kultur der Romani-Sprecher
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 0: Dieses Kapitel gibt eine Einführung in das Thema der Arbeit, stellt den Gegenstand des Romanes vor und erläutert die Methodik und die Festlegungen der Untersuchung.
- Kapitel 0.1: Hier wird der Gegenstand der Arbeit, das Romani, vorgestellt. Die Arbeit fokussiert sich auf die Sprache der europäischen Volksgruppen, die traditionell als "Zigeuner" bezeichnet werden.
- Kapitel 0.2: Dieses Kapitel erläutert die Arbeitshypothese und die Methodik der Untersuchung, ohne die Details der Methodik zu enthüllen.
- Kapitel 0.3: Dieses Kapitel legt die grundlegenden Begriffe, die Orthographie, die Glossierungsregeln und das Abkürzungsverzeichnis der Arbeit fest.
- Kapitel 1: Dieses Kapitel präsentiert das Untersuchungsmaterial, welches sich auf den Dialekt des Romanes konzentriert.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert das Material in Bezug auf Interferenzen und arbeitet die hybriden Sprachmuster heraus.
- Kapitel 2.1: Hier wird das Material im Hinblick auf Interferenzphänomene analysiert.
- Kapitel 2.2: Dieses Kapitel befasst sich mit Zweifelsfällen bei der Identifizierung von Interferenzphänomenen und deren Ausschluss aus der Analyse.
- Kapitel 2.3: Dieses Kapitel untersucht die Ausarbeitung der Interferenzen in Bezug auf die Hybridität im Lexikon, der Morphosyntax und der Syntax.
- Kapitel 2.4: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die hybriden Sprachmuster, die im Romanes beobachtet werden.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel versucht, die im Romanes beobachteten Sprachwandelprozesse in bestehende Sprachkontaktmechanismen einzuordnen.
- Kapitel 3.1: Dieses Kapitel führt die wichtigsten Sprachkontaktmechanismen ein, darunter Substrat-Superstrat, Adstrat, Sprachbund und Sprachgemeinschaft, Pidginisierung, Kreolisierung und Sprachtod sowie Code-Switching.
- Kapitel 3.1.1: Dieses Kapitel behandelt die Sprachkontaktmechanismen Substrat und Superstrat und diskutiert deren mögliche Anwendung auf das Romanes.
- Kapitel 3.1.2: Dieses Kapitel behandelt den Sprachkontaktmechanismus Adstrat.
- Kapitel 3.1.3: Dieses Kapitel behandelt den Sprachkontaktmechanismus Sprachbund und Sprachgemeinschaft und diskutiert deren mögliche Anwendung auf das Romanes.
- Kapitel 3.1.4: Dieses Kapitel behandelt den Sprachkontaktmechanismus Pidginisierung.
- Kapitel 3.1.5: Dieses Kapitel behandelt den Sprachkontaktmechanismus Kreolisierung.
- Kapitel 3.1.6: Dieses Kapitel behandelt den Sprachkontaktmechanismus Sprachtod und diskutiert dessen mögliche Anwendung auf das Romanes.
- Kapitel 3.1.7: Dieses Kapitel behandelt den Sprachkontaktmechanismus Code-Switching und erläutert die verschiedenen Modelle zur Beschreibung dieses Phänomens.
- Kapitel 3.2: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Zuordnungsmöglichkeiten der im Romanes beobachteten Sprachwandelprozesse zu den verschiedenen Sprachkontaktmechanismen.
- Kapitel 3.1: Dieses Kapitel führt die wichtigsten Sprachkontaktmechanismen ein, darunter Substrat-Superstrat, Adstrat, Sprachbund und Sprachgemeinschaft, Pidginisierung, Kreolisierung und Sprachtod sowie Code-Switching.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Romani, Romanes, Sprachwandel, Kontaktphänomene, Interferenz, Hybridität, Lexikon, Morphosyntax, Syntax, Sprachkontaktmechanismen, Substrat, Superstrat, Adstrat, Sprachbund, Sprachgemeinschaft, Pidginisierung, Kreolisierung, Sprachtod, Code-Switching.
- Quote paper
- M.A. Jesse Lehmann (Author), 2009, Sprachwandel im Romani, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189555