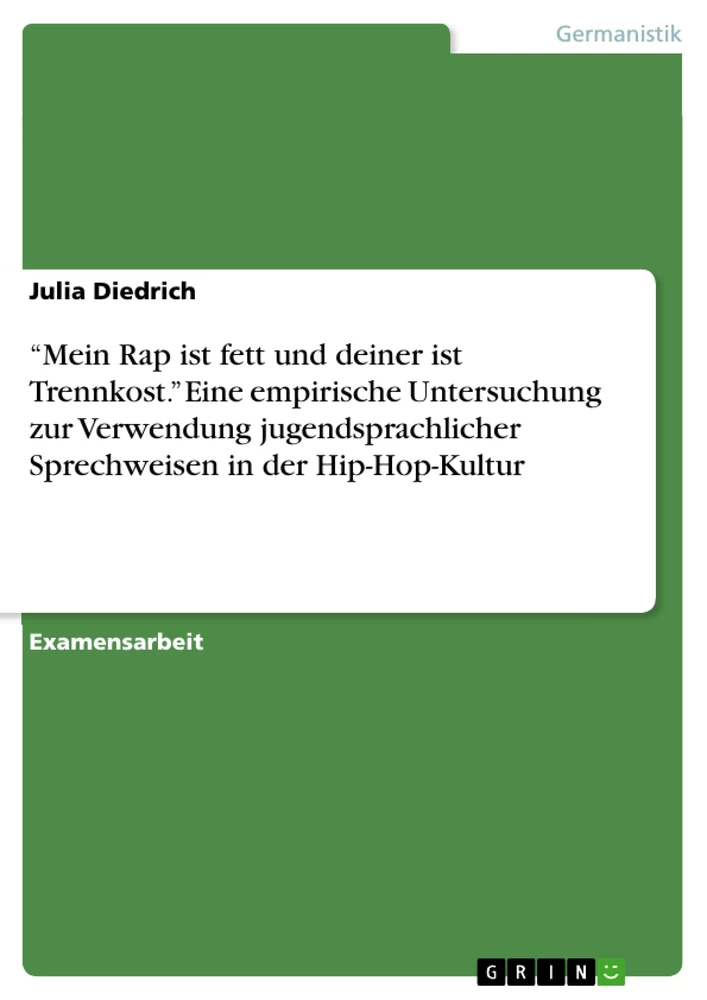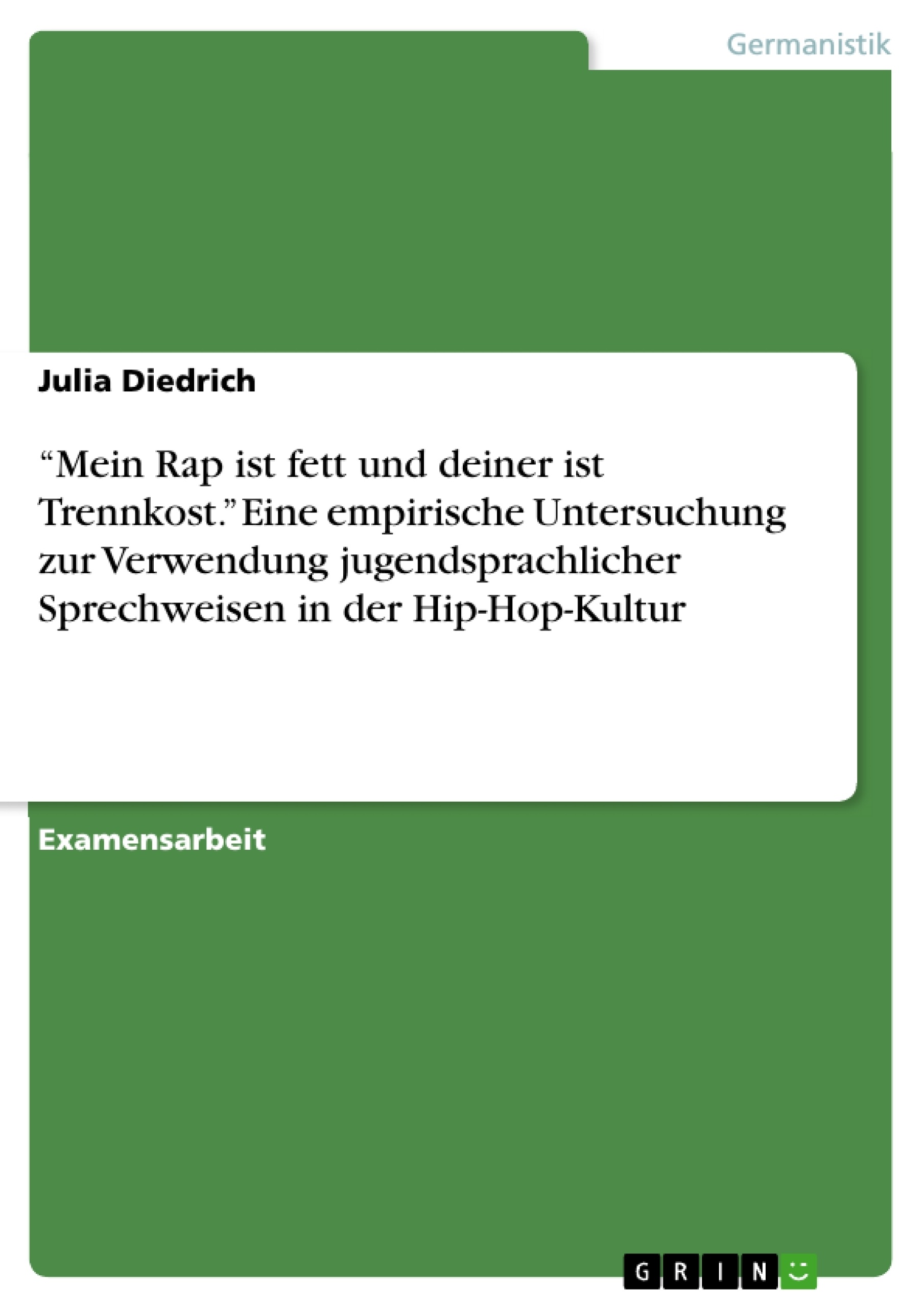Diese Arbeit stellt sich die Aufgabe, die Verwendung jugendsprachlicher Sprechweisen in ausgewählten Musiktexten, die allesamt aus der Hip-Hop-Kultur stammen, zu analysieren. In einem Eingangskapitel wird ein Überblick über den allgemeinen Forschungsstand gegeben, in dem zunächst die Jugendsprachforschung näher beleuchtet wird. Es soll die Behauptung gestützt werden, dass es keine homogene Jugendsprache gibt. Außerdem soll versucht werden, Raptexte in vorliegende wissenschaftliche Gefüge einzuordnen. Des Weiteren soll gezeigt werden, dass Hip-Hop den Subkulturen zuzuordnen ist, wofür der Begriff Subkultur bzw. Szene definiert und von dem Terminus der Kultur abgegrenzt werden wird.
Das darauffolgende Kapitel enthält einen geschichtlichen Abriss der wohl weltweit erfolgreichsten Musikrichtung, wobei zunächst die Anfänge und Ursprünge näher beleuchtet werden sollen, um dieses Phänomen besser verstehen zu können. Dabei soll am Ende die Annahme bestätigt werden, dass Hip-Hop mehr als nur eine Musikrichtung ist. Im zweiten Teil soll der Einfluss des Hip-Hops in Deutschland näher betrachtet werden. Somit sollen in diesem dritten Kapitel allgemeine Fragen wie die Folgenden geklärt werden: Was ist Hip-Hop? Wo liegen seine Ursprünge? Wie hat er sich entwickelt? Und wie äußert er sich im deutschen Rap?
Als Grundlage für die später anschließende empirische Untersuchung soll weiterhin eine umfassende Systematik jugendsprachlicher Merkmale gegeben werden, die die besondere Kommunikationsweise von Jugendlichen von denen der Erwachsenen abgrenzt. Es sollen neben dem jugendtypischen Wortschatz und den viel kritisierten Vulgarismen linguistische Besonderheiten wie die Verwendung von Anglizismen, Hyperbolisierungen, Lautwörtern und Partikeln aufgearbeitet und vorgestellt werden. Dabei wird Bezug auf namenhafte Sprachforscher wie Eva Neuland, Helmut Henne und Jannis Androutsopoulos genommen.
Diese linguistischen Charakteristika sollen dann an insgesamt sieben Liedtexten verschiedener Interpreten des Hip-Hop, die chronologisch aufsteigend geordnet sind, untersucht werden. Dabei soll am Ende das Ergebnis stehen, dass die kommerziell erfolgreichen Gruppen eine leicht verständliche Umgangssprache mit vielen sprechsprachlichen Elementen wählen, während die sogenannten „Gangsta-Rapper“ provozierend auch vulgäre und diskriminierende Ausdrücke verwenden. Es kann demnach von der Annahme ausgegangen werden, „dass ein Rapsong, je radio- und großmarktfähiger er sein soll, auch ...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsstand
- 2.1 Jugendsprachforschung
- 2.2 Die Subkultur Hip-Hop
- 3 Hip-Hop
- 3.1 Die Anfänge
- 3.2 Hip-Hop in Deutschland
- 4 Linguistische Merkmale jugendsprachlicher Sprechweisen
- 5 Jugendsprache in Musiktexten
- 5.1 Die Fantastischen Vier „Die Da“
- 5.2 Fettes Brot „Hallo Hip Hop“
- 5.3 Freundeskreis „Esperanto“
- 5.4 Fünf Sterne Deluxe „Wir ham's drauf“
- 5.5 Eko Fresh „König von Deutschland“
- 5.6 Sido „Mein Block“
- 5.7 Bushido „Alles Gute kommt von unten“
- 6 Auswertung
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Verwendung jugendsprachlicher Sprechweisen in ausgewählten Hip-Hop-Musiktexten. Ziel ist es, die sprachlichen Besonderheiten dieser Texte zu untersuchen und deren Einordnung in den bestehenden Forschungsstand der Jugendsprachforschung zu beleuchten. Dabei wird auch der Einfluss der Hip-Hop-Kultur auf die Entwicklung und Verbreitung jugendsprachlicher Elemente betrachtet.
- Jugendsprachforschung und ihre Methodologie
- Hip-Hop als Subkultur und seine linguistischen Merkmale
- Analyse jugendsprachlicher Elemente in verschiedenen Hip-Hop-Liedtexten
- Vergleich verschiedener Hip-Hop-Stile und deren sprachlicher Ausprägung
- Der Einfluss von Kommerzialisierung auf die Sprache im Hip-Hop
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Jugendsprache und deren Forschung ein und stellt die Forschungsfrage nach der Verwendung jugendsprachlicher Elemente in Hip-Hop-Musiktexten. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Jugendsprachforschung, die Hip-Hop-Kultur und die Analyse ausgewählter Liedtexte umfasst. Der Titel der Arbeit, ein Zitat aus einem Lied von Fettes Brot, illustriert die jugendsprachliche Verwendung von Begriffen, die im Standarddeutschen eine andere Bedeutung haben.
2 Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet den Forschungsstand der Jugendsprachforschung, insbesondere im Kontext der Soziolinguistik. Es wird die Schwierigkeit einer homogenen Definition von Jugendsprache und die Herausforderungen bei der Formulierung einer umfassenden Theorie des jugendspezifischen Sprachgebrauchs aufgezeigt. Es wird auf die Vielfältigkeit der Forschungsergebnisse und die Notwendigkeit empirischer Untersuchungen hingewiesen. Die Einordnung von Raptexten in den wissenschaftlichen Diskurs wird ebenfalls thematisiert.
3 Hip-Hop: Dieses Kapitel bietet einen geschichtlichen Abriss des Hip-Hops, von seinen Anfängen bis zum Einfluss in Deutschland. Es wird die Entwicklung und Verbreitung dieser Musikrichtung und Kultur erörtert, um ein besseres Verständnis für die sprachlichen Besonderheiten zu schaffen. Es wird die These aufgestellt, dass Hip-Hop mehr als nur eine Musikrichtung darstellt.
4 Linguistische Merkmale jugendsprachlicher Sprechweisen: Hier werden die linguistischen Merkmale jugendsprachlicher Sprechweisen systematisch dargestellt. Es werden Aspekte wie Wortschatz, Anglizismen, Hyperbolisierungen, Lautwörter und Partikel behandelt. Die Charakteristika werden auf der Basis der Arbeiten von namhaften Sprachforschern erläutert, um eine Grundlage für die folgende Textanalyse zu liefern. Es wird der Unterschied zwischen jugendlicher und erwachsener Kommunikation herausgestellt.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Hip-Hop, Rap, Soziolinguistik, Musiktexte, Sprachwandel, Subkultur, Anglizismen, Vulgarismen, Kommerzialisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit "Jugendsprache im deutschen Hip-Hop"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Verwendung jugendsprachlicher Elemente in ausgewählten deutschen Hip-Hop-Musiktexten. Sie untersucht die sprachlichen Besonderheiten dieser Texte und ordnet sie in den bestehenden Forschungsstand der Jugendsprachforschung ein. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Einfluss der Hip-Hop-Kultur auf die Entwicklung und Verbreitung dieser sprachlichen Elemente.
Welche Textsorten werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Liedtexte von verschiedenen bekannten deutschen Hip-Hop-Künstlern, darunter Die Fantastischen Vier, Fettes Brot, Freundeskreis, Fünf Sterne Deluxe, Eko Fresh, Sido und Bushido. Konkret werden die Texte folgender Lieder untersucht: „Die Da“, „Hallo Hip Hop“, „Esperanto“, „Wir ham's drauf“, „König von Deutschland“, „Mein Block“ und „Alles Gute kommt von unten“.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Jugendsprachforschung und ihre Methodologie, Hip-Hop als Subkultur und seine linguistischen Merkmale, Analyse jugendsprachlicher Elemente in verschiedenen Hip-Hop-Liedtexten, Vergleich verschiedener Hip-Hop-Stile und deren sprachlicher Ausprägung, sowie der Einfluss von Kommerzialisierung auf die Sprache im Hip-Hop.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Forschungsstand (inkl. Jugendsprachforschung und Hip-Hop als Subkultur), Hip-Hop (Geschichte und Entwicklung), Linguistische Merkmale jugendsprachlicher Sprechweisen, Jugendsprache in Musiktexten (Analyse der ausgewählten Lieder), Auswertung und Zusammenfassung. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Der Forschungsstand beleuchtet den aktuellen Stand der Wissenschaft. Kapitel 3 bietet einen geschichtlichen Überblick über Hip-Hop. Kapitel 4 beschreibt linguistische Merkmale von Jugendsprache. Kapitel 5 analysiert die ausgewählten Liedtexte. Kapitel 6 wertet die Ergebnisse aus. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, die auf der Analyse von Liedtexten basiert. Die linguistischen Merkmale der Jugendsprache werden systematisch identifiziert und im Kontext der jeweiligen Lieder und Künstler interpretiert. Der Vergleich verschiedener Lieder und Künstler ermöglicht eine umfassendere Analyse der sprachlichen Entwicklungen im deutschen Hip-Hop.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Jugendsprache, Hip-Hop, Rap, Soziolinguistik, Musiktexte, Sprachwandel, Subkultur, Anglizismen, Vulgarismen, Kommerzialisierung.
Welchen Beitrag leistet die Arbeit?
Die Arbeit trägt zum Verständnis der Jugendsprache im Kontext der deutschen Hip-Hop-Kultur bei. Sie liefert eine detaillierte Analyse der sprachlichen Besonderheiten in ausgewählten Liedtexten und beleuchtet den Einfluss von Hip-Hop auf den Sprachwandel. Die Ergebnisse können für weitere Forschungsarbeiten im Bereich der Soziolinguistik und Jugendsprachforschung genutzt werden.
Wo finde ich weitere Informationen?
Für detailliertere Informationen wird auf die vollständige Arbeit verwiesen (hier wäre der Link zur vollständigen Arbeit einzufügen).
- Citar trabajo
- Julia Diedrich (Autor), 2010, “Mein Rap ist fett und deiner ist Trennkost.” Eine empirische Untersuchung zur Verwendung jugendsprachlicher Sprechweisen in der Hip-Hop-Kultur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189284