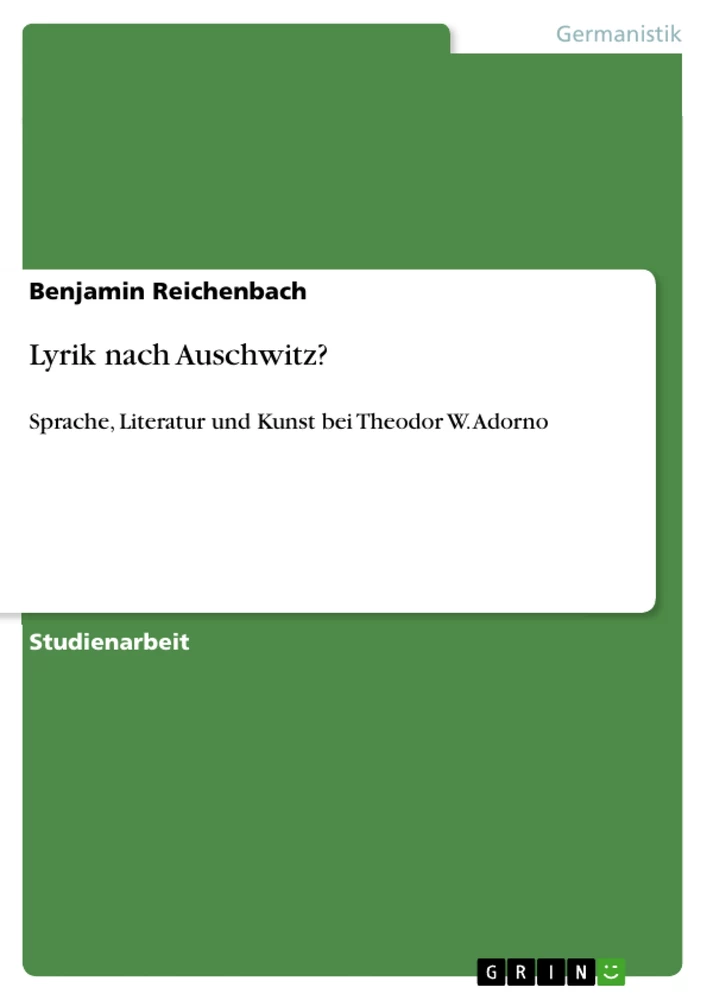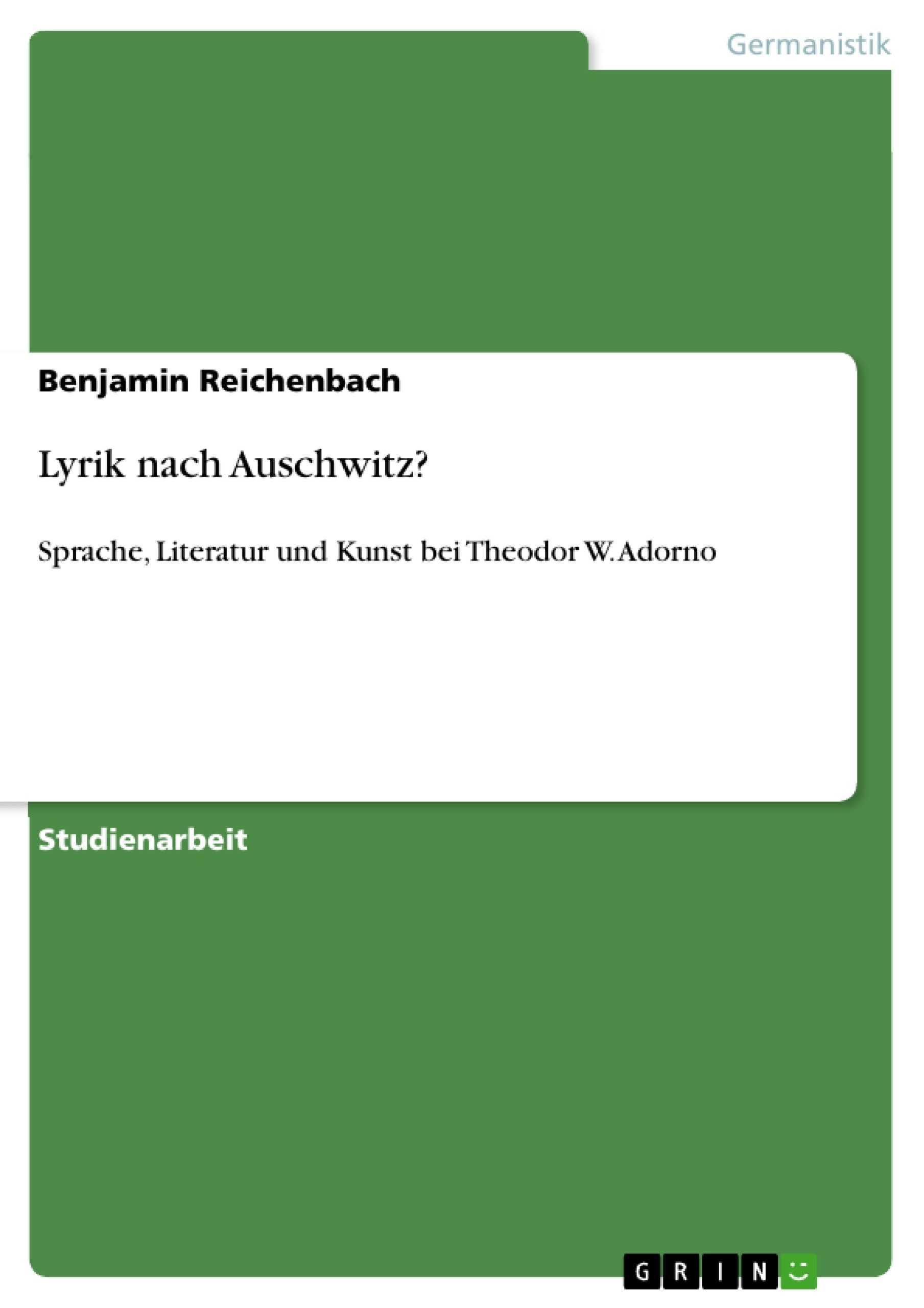Theodor W. Adorno ist einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Zusammen mit Max Horkheimer gilt er als Begründer der Kritischen Theorie der so genannten Frankfurter Schule, die aus dem 1923 gegründeten Institut für Sozialforschung hervorgegangen war und zu der auch andere bekannte Philosophen gehörten wie Friedrich Pollock, Erich Fromm, Herbert Marcuse und Walter Benjamin, sowie als Vertreter der zweiten Generation Jürgen Habermas. Grundlage ihrer philosophischen Denkrichtung, die an die Kapitalismuskritik von Marx und die Psychoanalyse Freuds anschließt, ist eine interdisziplinäre, ideologiekritische Analyse gesellschaftlicher Strukturen der Moderne.
Nachdem ihn der ältere Freund und Mentor Sigfried Kracauer mit Kants Kritik der reinen Vernunft, Hegel und Kierkegaard vertraut gemacht hatte, studierte Adorno ab 1921 Philosophie, Soziologie, Psychologie und Musikwissenschaft in Frankfurt.1 Er galt nicht nur als Philosoph, sondern auch als Soziologe, Musikwissenschaftler, Literaturkritiker und Komponist und befasste sich insbesondere mit Kultur- und Gesellschaftskritik, Musiksoziologie und Ästhetik. Einzelne Deutungen schreiben ihm sogar zu, dass seine unvollendete Ethik Kern seines philosophischen Denkens gewesen sei.2 Neben der mit Horkheimer verfassten Dialektik der Aufklärung (1947) zählen Minima Moralia (1951), Negative Dialektik (1966) und Ästhetische Theorie (1970, posthum erschienen) zu seinen Hauptwerken.
Auf gesellschaftlicher Ebene spielte Adorno immer wieder eine entscheidende Rolle in öffentlichen Auseinandersetzungen. Im Positivismusstreit (Adorno selbst hatte den Begriff geprägt), der sich in den frühen 60er Jahren entzündete, waren Adorno und Habermas als Vertreter der Kritischen Theorie Hauptgegner von Karl Popper und Hans Albert, die den Kritischen Rationalismus repräsentierten.3 Auch die Studentenbewegung der 68er sah Adorno in gewisser Hinsicht als geistigen Vordenker, wenngleich Adorno selbst sich in diesem Zusammenhang teilweise missverstanden fühlte.4
Inhaltsverzeichnis
- Adorno, Horkheimer und die Frankfurter Schule
- Adorno und Horkheimer - der Briefwechsel 1941
- Dialektik der Aufklärung
- Kulturkritik und Gesellschaft
- Jene zwanziger Jahre, Engagement, Ist die Kunst heiter?
- Negative Dialektik
- Ästhetische Theorie
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Kulturkritik des Philosophen und Soziologen Theodor W. Adorno im Kontext der Frankfurter Schule und stellt insbesondere seine Auseinandersetzung mit Sprache und Literatur nach der Shoah in den Vordergrund. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie die literarische Produktion nach Auschwitz angesichts des unvorstellbaren Leids und der gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt möglich sein kann.
- Adornos philosophische Positionierung innerhalb der Frankfurter Schule
- Die Dialektik der Aufklärung und ihre Bedeutung für Adornos Kulturkritik
- Adornos Kritik an der Kulturindustrie und seinen Begriff der "verdinglichten Sprache"
- Die Rolle von Sprache und Literatur in einer Gesellschaft nach Auschwitz
- Die Relevanz von Adornos Gedanken für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in Adornos Leben und Werk, seine philosophische Positionierung innerhalb der Frankfurter Schule sowie seinen frühen Austausch mit Max Horkheimer über sprachphilosophische Fragen. Kapitel zwei behandelt die Dialektik der Aufklärung und ihre Bedeutung für Adornos Kulturkritik. Hier wird besonders auf die Kritik an der Kulturindustrie und den Begriff der "verdinglichten Sprache" eingegangen.
Im dritten Kapitel werden die Aufsätze "Kulturkritik und Gesellschaft", "Jene zwanziger Jahre", "Engagement" und "Ist die Kunst heiter?" analysiert, um die spezifischen Herausforderungen von Sprache und Literatur in einer "Gesellschaft, die den eigenen Untergang überlebt hat", zu beleuchten. Kapitel vier beschäftigt sich mit einzelnen Passagen aus Adornos "Negative Dialektik" und "Ästhetische Theorie", um seine Gedanken zur Kunst und zur Rolle des Schönen im Kontext seiner Kulturkritik weiter zu vertiefen.
Schlüsselwörter
Theodor W. Adorno, Frankfurter Schule, Kritische Theorie, Dialektik der Aufklärung, Kulturindustrie, verdinglichte Sprache, Sprachzerfall, Literatur, Kunst, Auschwitz, Sprache und Vernunft, Positivismus, Negative Dialektik, Ästhetische Theorie.
- Quote paper
- Benjamin Reichenbach (Author), 2008, Lyrik nach Auschwitz? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189154