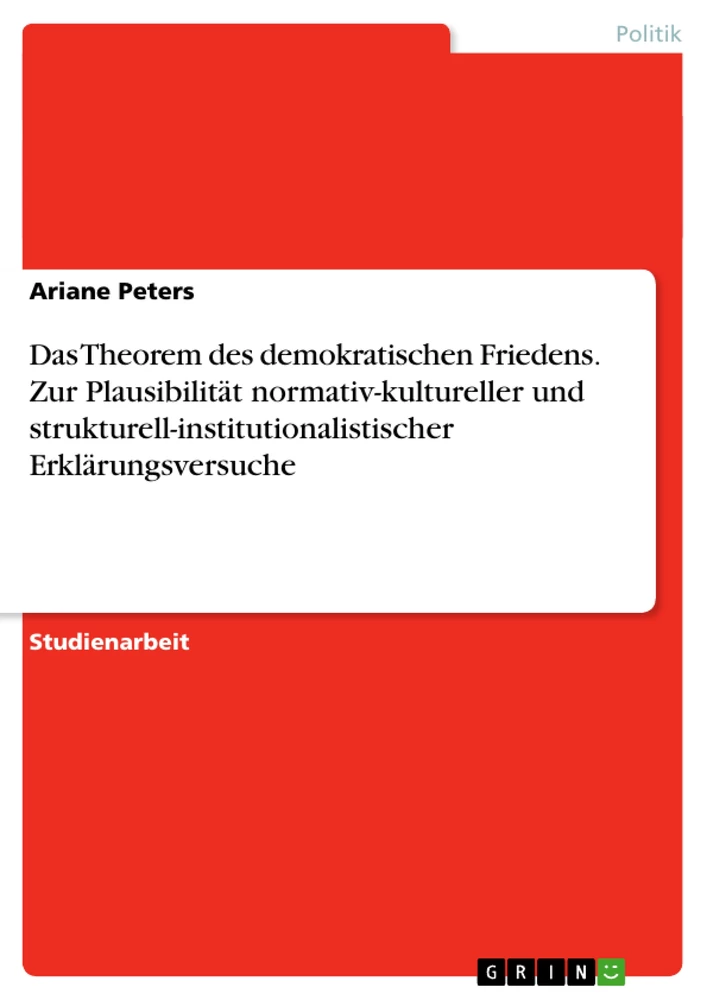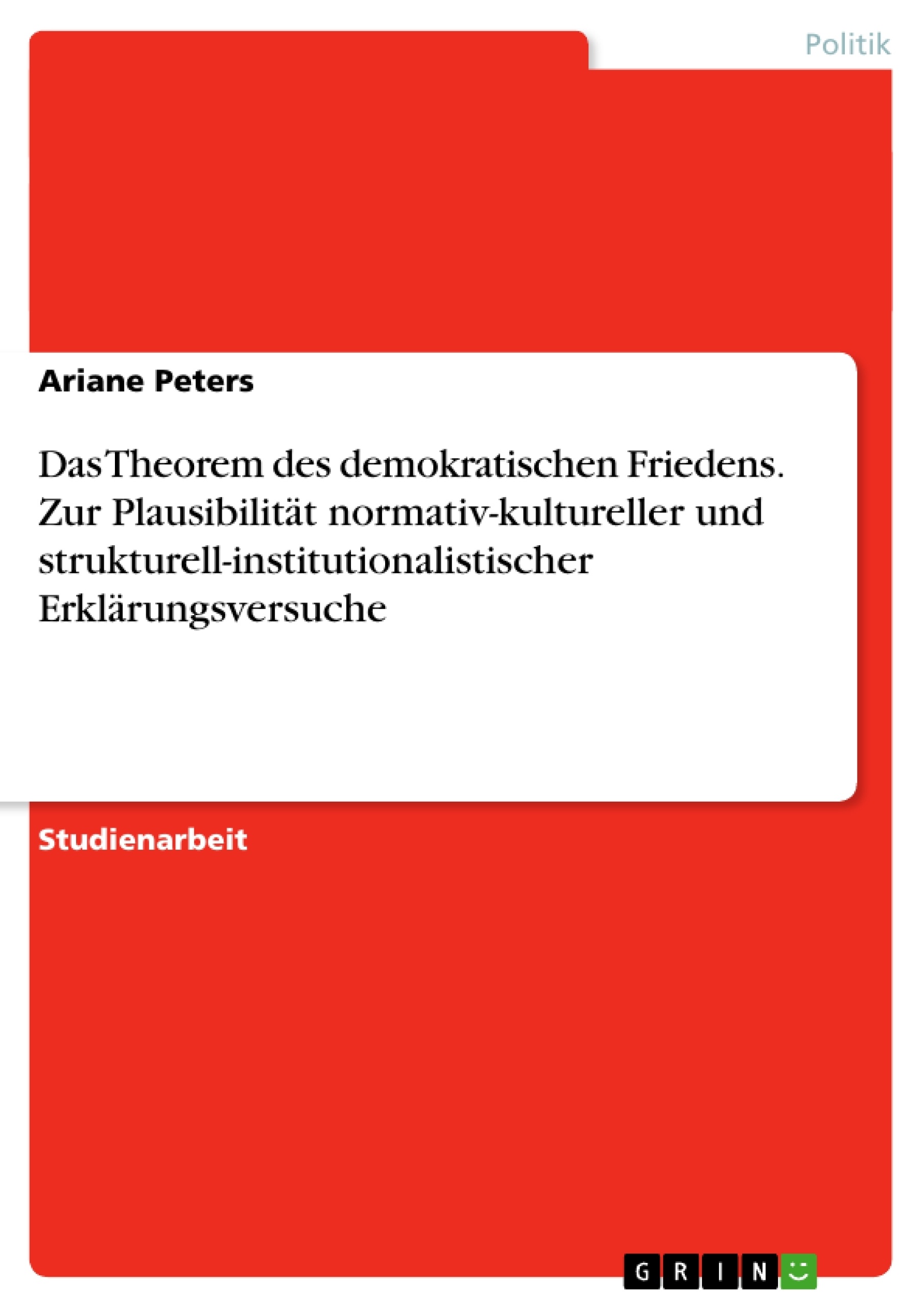Die Kontroversen um die Theorie des „Demokratischen Friedens“ bilden ein breites Forschungsfeld in den Internationalen Beziehungen. Seit dem Ende des Kalten Krieges spielt dabei die Idee, dass eine durch den Westen nachdrücklich geförderte Demokratisierung weltweit zu mehr Frieden führen würde, eine zunehmend wichtige Rolle. Dieser Gedanke beruht auf der weit verbreiteten These, dass Demokratien (fast) keine Kriege gegeneinander führen.
Im Fokus dieser Arbeit steht die Frage, warum Demokratien eher als andere politische Systeme in der Lage sind Kooperationsprobleme zu überwinden und untereinander stabile Friedensordnungen ausbilden, die dem kantischen Ideal des „Friedensbundes“ (foedus pacificum)1 nahe kommen. Wie kann der demokratische Frieden trotz unfriedlicher Demokratien erklärt werden?
Zwei Erklärungsversuche sollen auf ihre Stichhaltigkeit untersucht werden: der normativ-kulturelle Ansatz und der strukturellinstitutionalistische Ansatz. Ich werde zeigen, dass obwohl beide Erklärungsversuche empirisch belegt werden können, der normativ-kulturelle Ansatz in Verbindung mit sozialkonstruktivistischen Elementen das selektive Außenverhalten von Demokratien am besten erklären kann.
Die vorliegende Arbeit geht in fünf Schritten vor: Zunächst ist es notwendig den Friedensbegriff näher zu erläutern, um die anschließend dargelegten empirischen Befunde zum Verhältnis von Demokratie und Frieden bewerten zu können. Im zweiten Teil werde ich beide theoretischen Ansätze erläutern, um sie anschließend auf ihr Erklärungspotential hin zu prüfen. Im dritten Teil wird nach der Eindeutigkeit der empirischen Befunde der Wissenschaftler Zeev Maoz und Bruce Russett gefragt. Sie haben beide Ansätze gegeneinander getestet. Im vorletzten Teil dieser Arbeit wird am Beispiel der Angloamerikanischen Beziehungen in der Zeit von 1845 bis 1920 die Wirkung demokratischer Institutionen und gemeinsamer Normen im Detail überprüft. Zum Ende wird es eine Zusammenfassung geben, mit dem Ziel weitere Perspektiven für die zukünftige Forschung aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Friedensbegriff
- Empirische Befunde zum Verhältnis von Demokratie und Frieden
- Theoretische Erklärungsansätze zum Verhältnis von Demokratie und Frieden
- Strukturell-institutionalistische Erklärungsversuche
- Schwerfälligkeit und Komplexität demokratischer Institutionen
- Partizipationschancen und Kosten-Nutzen-Kalküle
- Kritik
- Normativ-kulturelle Erklärungsversuche
- Kritik
- Strukturell-institutionalistische Erklärungsversuche
- Der empirische Befund: Das Erklärungspotential demokratischer Normen und Institutionen im Vergleich
- Angloamerikanische Beziehungen, 1845-1930: Friedliche Beziehungen durch gemeinsame Werte oder demokratische Institutionen?
- Konflikte zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten
- Die Oregon Krise
- Schlussfolgerungen für die Theorie des „Demokratischen Frieden“
- Die Venezuelanische Grenzfrage
- Schlussfolgerungen für die Theorie des „Demokratischen Frieden“
- Die friedliche Annäherung
- Fazit
- Konflikte zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Plausibilität normativ-kultureller und strukturell-institutionalistischer Erklärungsversuche zum Verhältnis von Demokratie und Frieden. Sie analysiert die These, dass Demokratien eher als andere politische Systeme in der Lage sind, Kooperationsprobleme zu überwinden und untereinander stabile Friedensordnungen auszubilden, die dem kantischen Ideal des „Friedensbundes“ nahe kommen.
- Der Friedensbegriff und seine verschiedenen Definitionsvarianten
- Empirische Befunde zum Verhältnis von Demokratie und Frieden
- Theoretische Erklärungsansätze: Normativ-kultureller und strukturell-institutionalistischer Ansatz
- Das Erklärungspotential demokratischer Normen und Institutionen im Vergleich
- Die Angloamerikanischen Beziehungen als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Demokratischer Frieden“ ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Demokratie und Frieden in den Internationalen Beziehungen. Kapitel 2 behandelt den komplexen Friedensbegriff und beleuchtet verschiedene Definitionsvarianten, um die folgenden Kapitel besser bewerten zu können. Kapitel 3 stellt empirische Befunde zum Verhältnis von Demokratie und Frieden dar. Kapitel 4 erläutert theoretische Erklärungsansätze, insbesondere den normativ-kulturellen und den strukturell-institutionalistischen Ansatz, und untersucht deren Erklärungspotenzial. Kapitel 5 analysiert die empirischen Befunde und beleuchtet die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien von Zeev Maoz und Bruce Russett, die beide Ansätze gegeneinander getestet haben. Kapitel 6 analysiert am Beispiel der Angloamerikanischen Beziehungen die Wirkung demokratischer Institutionen und gemeinsamer Normen im Detail.
Schlüsselwörter
Demokratischer Frieden, Friedensbegriff, Normativ-kultureller Ansatz, Strukturell-institutionalistischer Ansatz, Angloamerikanische Beziehungen, Kooperationsprobleme, Friedensordnungen, Kantischer Friedensbund.
- Quote paper
- Ariane Peters (Author), 2003, Das Theorem des demokratischen Friedens. Zur Plausibilität normativ-kultureller und strukturell-institutionalistischer Erklärungsversuche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18910