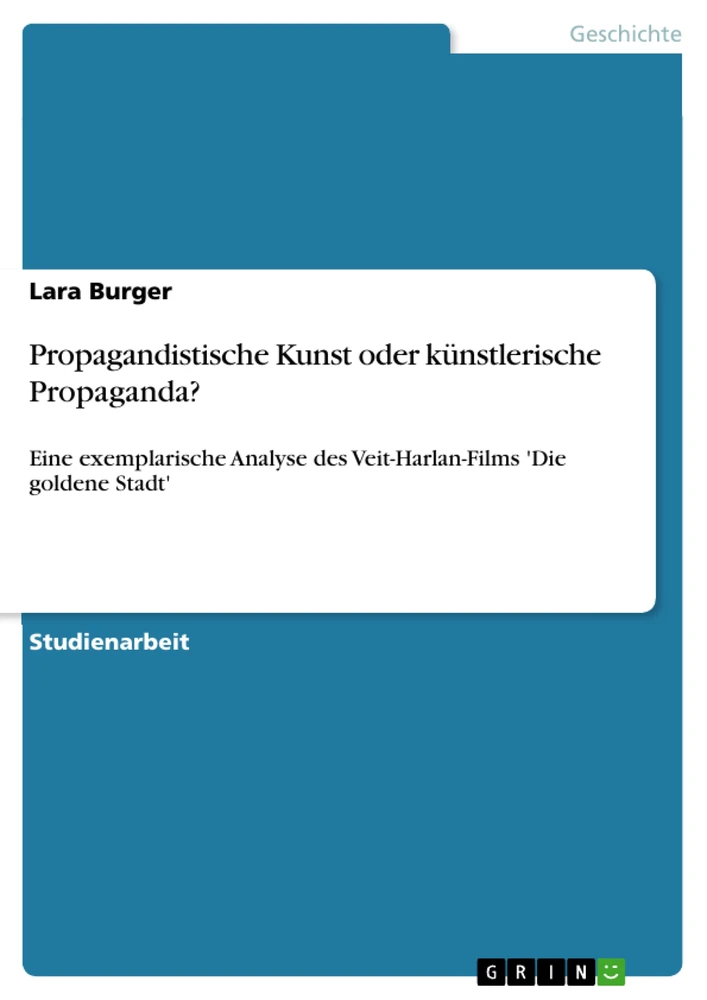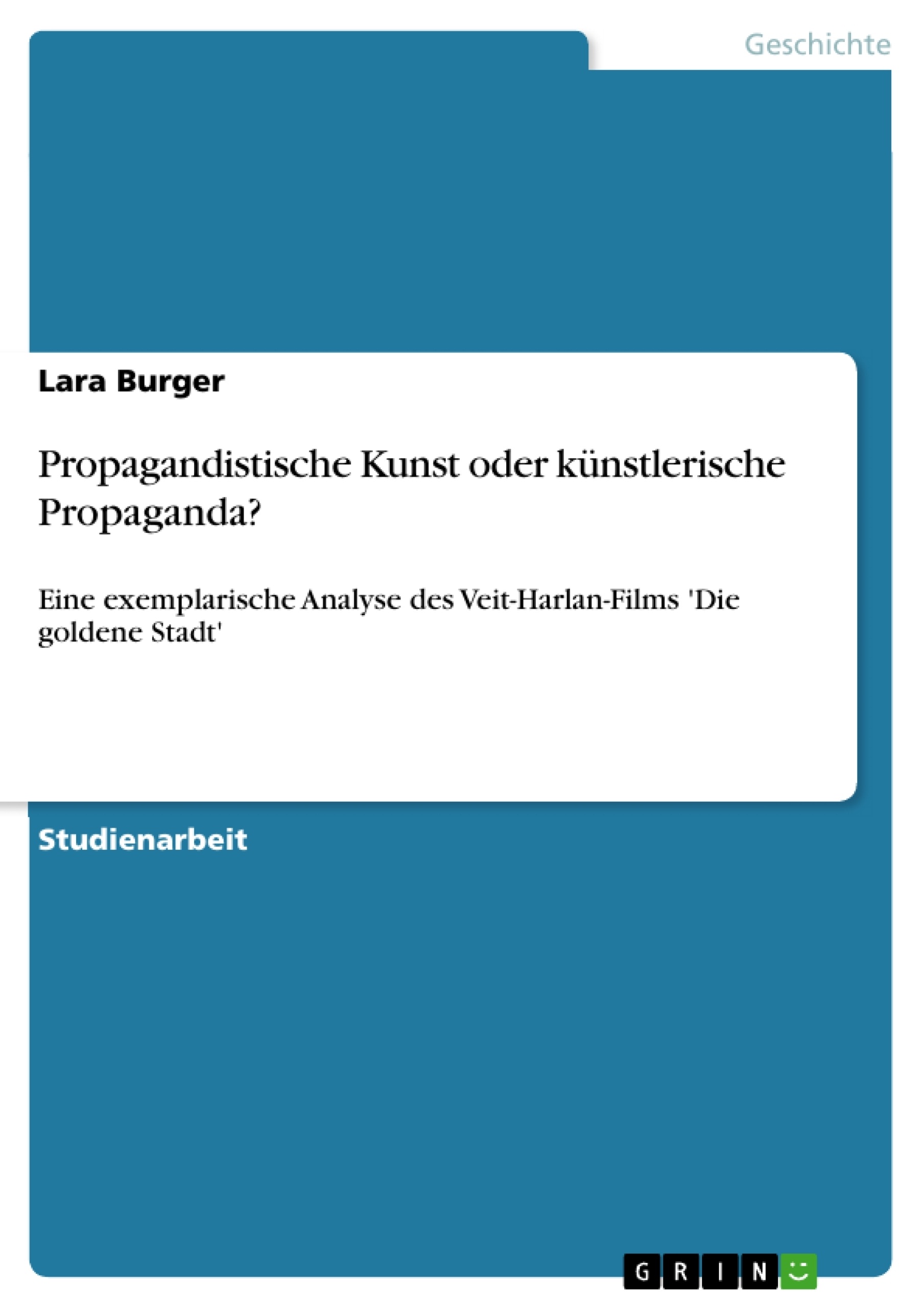Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit, der deutsche Film, erlebte während der dreißiger und vierziger Jahre seine „goldene Zeit“2 als das am erfolgreichsten und publikumswirksamsten eingesetzte Massenmedium. Viele der bekannten Persönlichkeiten aus jener Schaffensperiode des Filmwesens wie Marlene Dietrich, Zara Leander oder Heinz Rühmann sind auch heute noch bekannt; ebenso werden viele Spielfilme aus jener Zeit noch immer im Fernsehen gezeigt. Heutzutage lässt ein in jener Zeit entstandener Film den Betrachter beinahe automatisch Bezug zu dem politischen Hintergrund, vor dem jene Werke entstanden, nehmen; ein scheinbar simpler Spielfilm wird sofort mit nationalsozialistischen Ideologien in Bezug gesetzt, und fast ausschließlich hiernach wird er heutzutage auch interpretiert.
Darf und kann man dieses pauschale Urteil auf alle Filme dieser Zeit anwenden? Inwiefern war die Kunst, insbesondere Filmkunst, der dreißiger und frühen vierziger Jahre wirklich von NS-Ideologien und der dazugehörigen Propaganda infiltriert? Wie viel nationalsozialistisches Gedankengut kann und darf einem Film, der zu Kriegszeiten in Deutschland als Unterhaltungsfilm für ein breites Publikum in den Kinos gezeigt wurde, attestiert werden – und enthält jeder Film dieser Zeit das nationalsozialistische Potential, das die Mehrheit der Werke in sich trägt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Film im dritten Reich: Kunst nach Vorschrift
- Blut-und-Boden-Ideologie unterläuft den Unterhaltungsfilm
- Rassenpropaganda: Die Darstellung der Tschechen im Film
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Film „Die goldene Stadt“ von Veit Harlan, der 1942 uraufgeführt wurde, um zu untersuchen, inwieweit ein scheinbar harmloses Melodram ohne offensichtlichen „politischen Dreh“ einen ideologischen und propagandistischen Inhalt tragen kann. Der Fokus liegt auf der Frage, welche ideologischen Schwerpunkte im Film deutlich werden und wie diese künstlerisch umgesetzt werden.
- Die Rolle des Films im Dritten Reich
- Die Vermittlung von Blut-und-Boden-Ideologie und Rassenideologie im Film
- Die Analyse des Filmes „Die goldene Stadt“ und seine Interpretation
- Die Rezeption des Films durch zeitgenössische Kritik
- Die Sichtweise des Regisseurs Veit Harlan auf sein Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext des deutschen Films im Dritten Reich. Sie skizziert die zentralen Forschungsansätze und die Quellen, die für die Untersuchung herangezogen werden.
- Film im dritten Reich: Kunst nach Vorschrift: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der deutschen Filmwirtschaft unter dem Einfluss der Nationalsozialisten. Es analysiert die Rolle des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda unter Dr. Joseph Goebbels und die Einführung von Zensur und Prädikatisierung in der Filmwirtschaft.
- Blut-und-Boden-Ideologie unterläuft den Unterhaltungsfilm: Dieses Kapitel untersucht die Verbreitung der Blut-und-Boden-Ideologie in deutschen Filmen. Es analysiert die Mechanismen der Ideologievermittlung und die Verwendung von stereotypen Darstellungen.
- Rassenpropaganda: Die Darstellung der Tschechen im Film: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Tschechen im Film „Die goldene Stadt“ und untersucht die Rolle des Films bei der Vermittlung von nationalsozialistischer Rassenideologie.
Schlüsselwörter
Deutsche Filmwirtschaft, Nationalsozialismus, Propaganda, Ideologie, „Die goldene Stadt“, Veit Harlan, Blut-und-Boden-Ideologie, Rassenideologie, Filmzensur, Prädikatisierung, Unterhaltungsfilm, Melodram, zeitgenössische Kritik.
- Quote paper
- Lara Burger (Author), 2011, Propagandistische Kunst oder künstlerische Propaganda?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188873