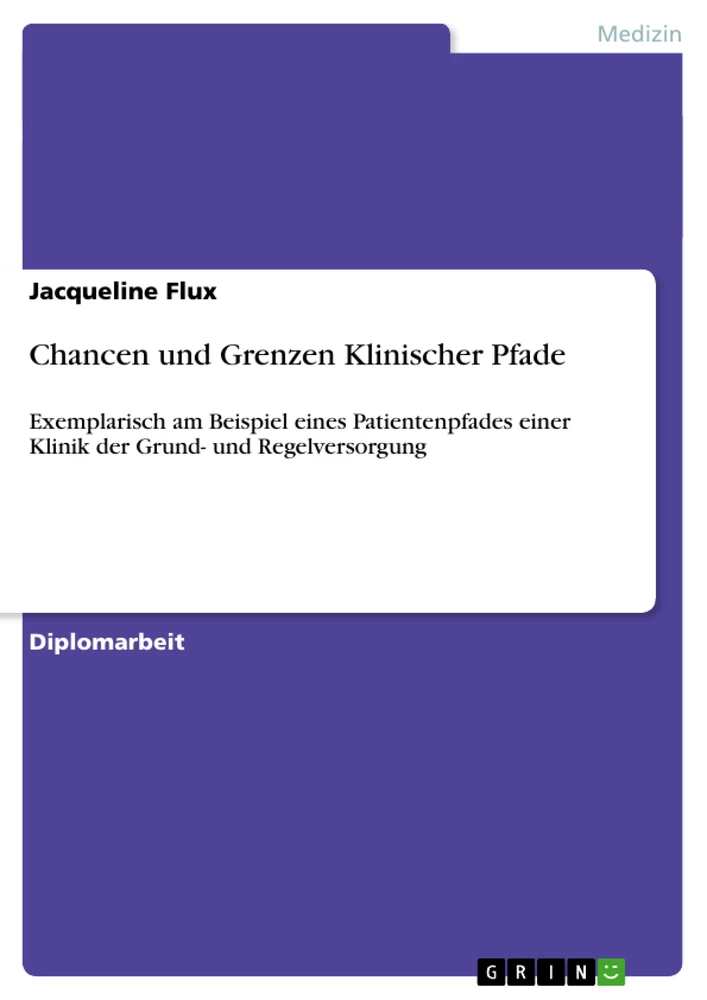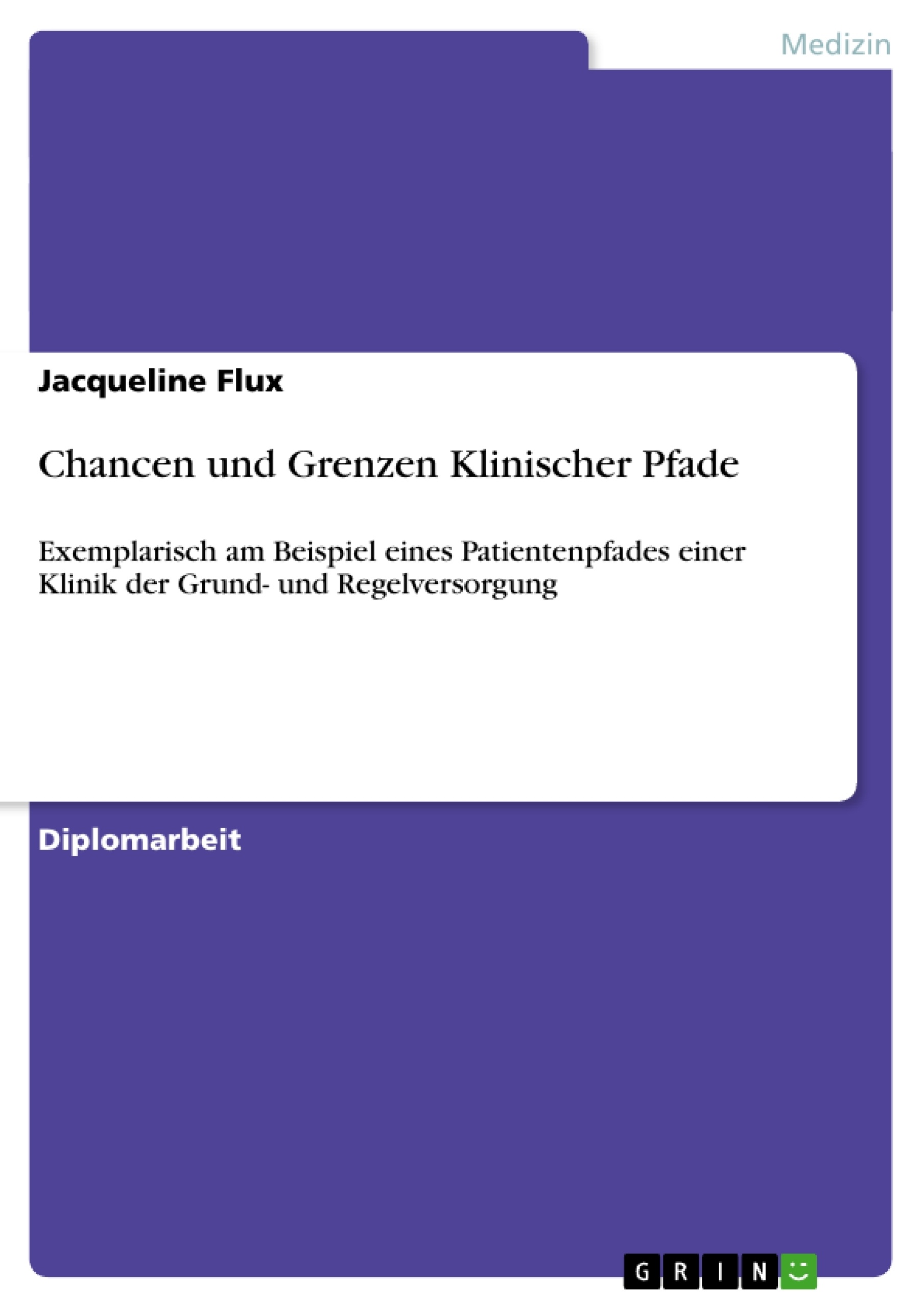Auf Grund der knapp bemessenen Kalkulation der Kostengewichte müssen
Krankenhäuser dringend eine Optimierung der Leistungserbringung und der Kostenstruktur der fallzahlstärksten DRG vornehmen. Klinische Pfade werden dabei häufig als Königsweg propagiert (vgl. Scheu, C. 2004: 61).
Am Beispiel eines Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung in
Deutschland werden Chancen und Grenzen Klinischer Pfade auf der Grundlage eines Pfad-Controllings dargestellt. Zunächst werden die Ausgangslage und die gesetzlichen Vorgaben in Deutschland sowie der fallpauschalierte Vergütung mittels G-DRG umrissen. Anschließend erfolgt die Begriffsbestimmung und die Aufzeichnung der Entwicklung und Implementierung eines Klinischen Pfades für die Diagnoseschlüssel I70.21 bis I70.24 in der Klinik für Innere Medizin I am Park-Krankenhaus Leipzig-Südost GmbH. Damit die Implementierung des Pfades gelingt, müssen die verschiedenen Berufsgruppen motivierend begleitet werden.
Dazu gehört das Anstoßen eines Umdenkungsprozesses. Ein wichtiges Mittel dafür ist die frühzeitige Aufklärung der Mitarbeiter bezüglich häufiger Vorurteile.
Diesen ist das Kapitel „Implementierungsbarrieren“ gewidmet. Dem Leser wird anschließend die inhaltliche und organisatorische Vorgehensweise des Pfad-Controllings vorgestellt. Damit sich der Leser ein besseres Bild von dem entwickelten Pfad machen kann, wird dieser in Kapitel 5.3 vorgestellt und erläutert.
Um die Frage zu beantworten, ob sich Klinische Pfade als „Wunderwaffe“ (vgl. Scheu, C. 2004: 61) gegen den steigenden Kostendruck in Krankenhäusern eignen, wird eine Analyse der mittleren Verweildauer, der Abteilungsleistungszahlen, der MDK-Anfragen und der Komplikationsraten unter den Auswirkungen der Umstellung des herkömmlichen Behandlungsprozesses zum strukturierten Behandlungsprozess durchgeführt. Dabei werden das Behandlungsjahr 2007 als Referenzjahr ohne Pfad, 2008 als Jahr der Pfadentwicklung und 2009 als Behandlungsjahr unter Einwirkung des Pfades angesehen. Die Aufzeigung der Grenzen Klinischer Pfade und eine resultierende Schlussfolgerung bilden den Abschluss der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Einleitung
- Ausgangslage in Deutschland
- Gesetzliche Vorgaben für Klinische Pfade
- EbM und Reduktion von Varianzen innerhalb medizinischer Interventionen
- Vergütung nach G-DRG
- Definition und Bedeutung Klinischer Pfade
- Verschiedene externe Definitionen
- Definition für Klinische Pfade im Park-Krankenhaus Leipzig-Südost GmbH
- Nutzen und Ziele Klinischer Pfade
- Zentrale Fragestellung und Zielsetzung
- Methoden
- Auswahlkriterien für Patientenpfade
- Kriterium der abteilungsrelevanten Top-10-Diagnoseschlüssel
- Kriterium der abteilungsrelevanten Fallzahlen
- Durchführung des Dokumentationsaudits
- Analyse der mittleren Verweildauer von Pfadpatienten und Nicht-Pfadpatienten
- Analyse der mVWD der paVK-Patienten im Jahr 2009
- Analyse der mVWD der DRG F59B in den Jahren 2007 und 2009
- Benchmarking mit der mVWD
- Vergleich der Leistungsparameter des angiologischen Katheterlabors der Kalenderjahre 2007, 2008 und 2009
- Analyse der MDK Einzelbegutachtungen
- Qualitätskriterium: Punktionskomplikation
- Auswahlkriterien für Patientenpfade
- Ergebnisse
- Auswahlkriterien einer geeigneten Patientengruppe
- Kriterium der abteilungsrelevanten Top-10-Diagnoseschlüssel
- Kriterium der abteilungsrelevanten Fallzahlen
- Entwicklung eines Klinischen Pfades
- "Plan"-Phase
- "Do"-Phase
- Pfadentwicklung am Park-Krankenhaus
- Der Patientenpfad am Park-Krankenhaus Leipzig-Südost GmbH
- Aufbau
- Pfad-Implementierung
- Voraussetzung für eine effektive Implementierung
- Implementierungsbarrieren
- Pfad-Controlling
- Das Dokumentationsaudit
- Analyse der mVWD von Pfadpatienten und Nicht-Pfadpatienten
- Analyse der mVWD der paVK-Patienten im Jahr 2009
- Analyse der mVWD der DRG F59B im Jahr 2007 und 2009
- Benchmarking mit der mVWD
- Vergleich der Leistungsparameter des angiologischen Katheterlabors der Kalenderjahre 2007, 2008 und 2009
- Analyse der Einzelbegutachtungen des MDK
- Qualitätskriterium: Punktionskomplikation
- Auswahlkriterien einer geeigneten Patientengruppe
- Diskussion
- Ökonomische Aspekte von Klinischen Pfaden
- Monetäre Auswirkungen
- Steigerung der Fallzahlen
- Qualitative Aspekte von Klinischen Pfaden
- Aktenanalyse
- Punktionskomplikationen
- Organisatorische Aspekte von Klinischen Pfaden
- Organisatorisch bedingte Verlängerung der Verweildauer
- Reduzierter Einsatz diagnostischer Leistungen
- Grenzen Klinischer Pfade
- Fazit
- Ökonomische Aspekte von Klinischen Pfaden
- Literaturverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Glossar
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Chancen und Grenzen klinischer Pfade am Beispiel eines angiologischen Patientenpfades in einer Klinik der Grund- und Regelversorgung in Deutschland. Dabei wird untersucht, inwieweit die Einführung eines strukturierten Behandlungsprozesses für Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (paVK) zu einer Verbesserung der Behandlungsqualität, einer Reduktion der Verweildauer und einer Optimierung der ökonomischen Effizienz führt.
- Einführung und Implementierung eines klinischen Pfades für paVK
- Analyse der Auswirkungen des Pfades auf die Verweildauer, die Dokumentationsqualität und die Komplikationsraten
- Bewertung des Pfades unter ökonomischen, qualitativen und organisatorischen Gesichtspunkten
- Aufzeigen der Grenzen und des Potenzials von klinischen Pfaden im Krankenhausalltag
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Skizziert die Ausgangslage des deutschen Gesundheitswesens, die Einführung der DRG-Vergütung und die Relevanz von klinischen Pfaden in diesem Kontext.
- Methoden: Beschreibt die Auswahlkriterien für den Patientenpfad, die Durchführung des Dokumentationsaudits, die Analyse der mittleren Verweildauer, die Auswertung der Leistungszahlen und die Analyse der MDK-Begutachtungen.
- Ergebnisse: Stellt die Entwicklung und Implementierung des Patientenpfades am Park-Krankenhaus Leipzig-Südost vor. Außerdem werden die Ergebnisse des Dokumentationsaudits, die Analyse der Verweildauer und die Auswertung der Leistungsparameter dargestellt.
- Diskussion: Beurteilt die ökonomischen, qualitativen und organisatorischen Aspekte des Pfadeinsatzes. Die Ergebnisse der Analyse werden mit Studienergebnissen aus der Literatur verglichen.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen Klinische Pfade, Patientenpfade, periphere arterielle Verschlusskrankheit (paVK), DRG-Vergütung, Dokumentationsaudit, mittlere Verweildauer, Komplikationsraten, Qualitätsmanagement, ökonomische Effizienz, Prozessoptimierung, Krankenhausorganisation, Evidenzbasierte Medizin.
- Quote paper
- Jacqueline Flux (Author), 2010, Chancen und Grenzen Klinischer Pfade, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188627