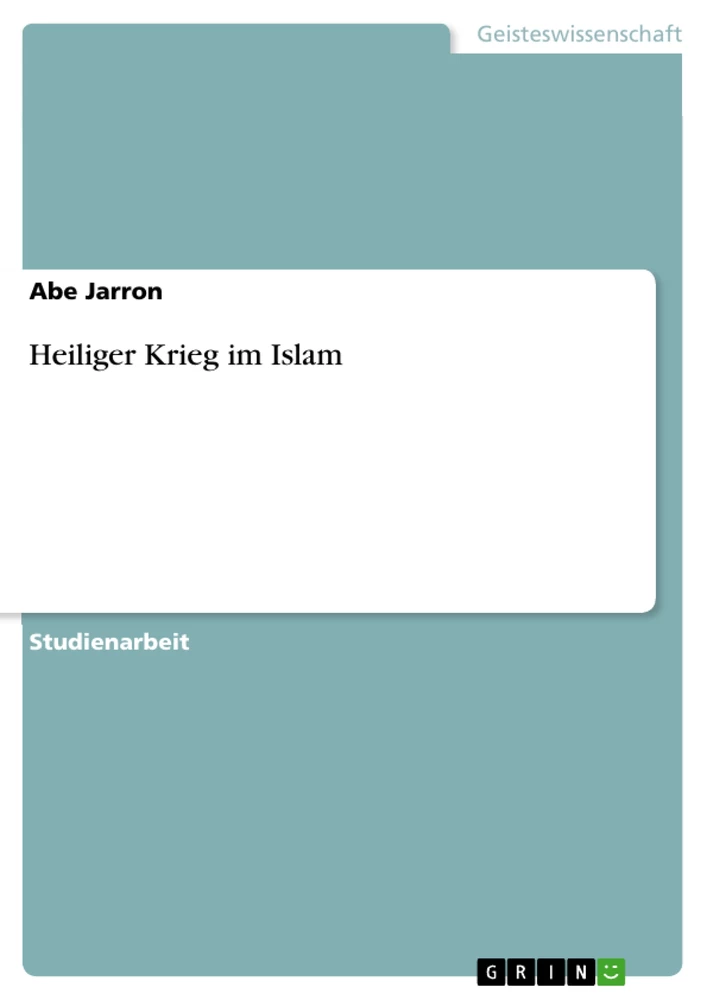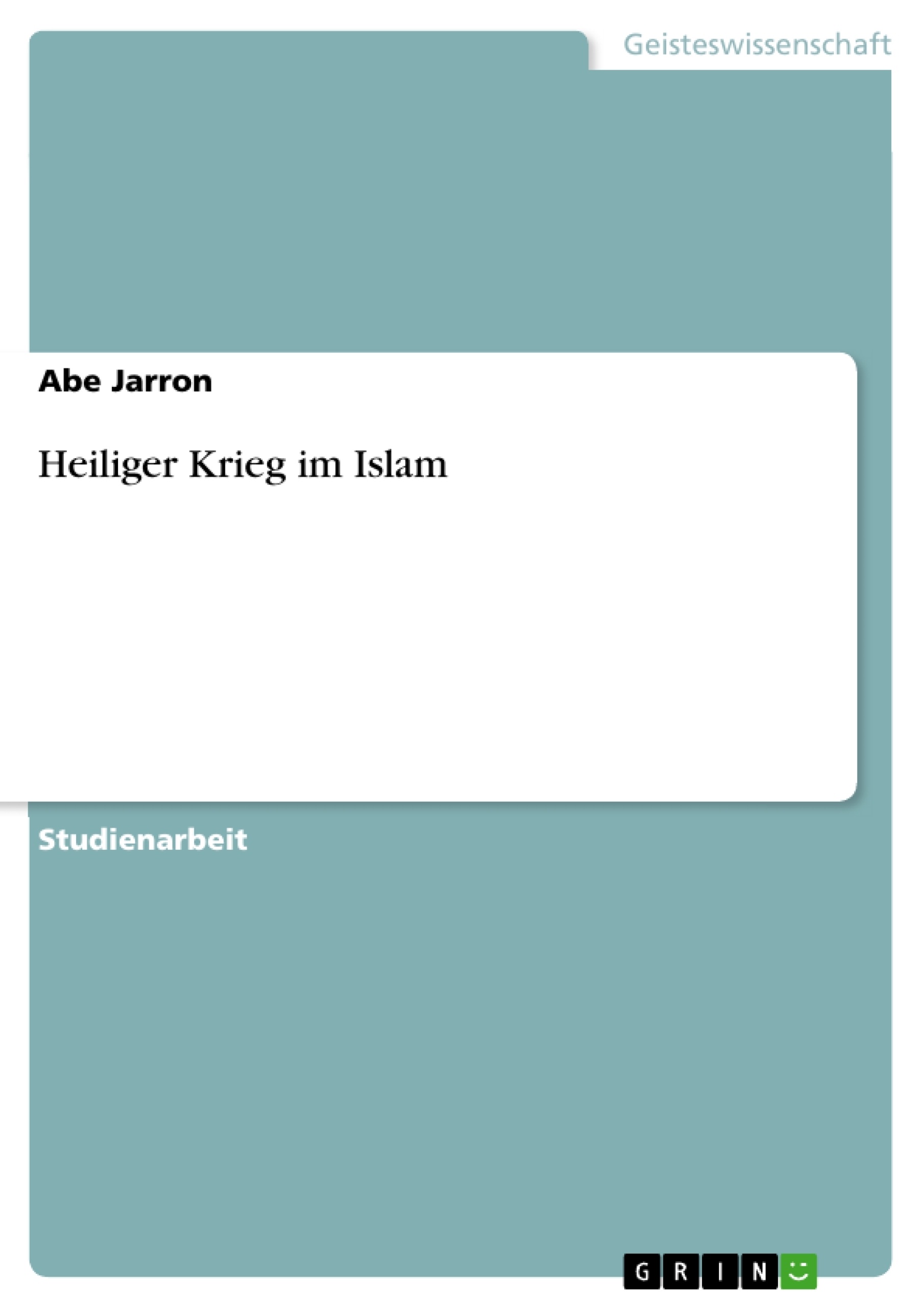1. Einleitung
Diese Arbeit soll das Verhältnis der Gewalt zum Islam untersuchen. Dabei wird die Aufmerksamkeit besonders auf den sogenannten „Heiligen Krieg“ gerichtet. Dem Verfasser ist bewusst, dass es zu diesem Thema sehr vielfältige Meinungen gibt. Sie schwanken von einem Extrem zum anderen. Einerseits ist vom Islam als eine von Grund auf gewaltsame Religion die Rede, andererseits wird die Gewalt im Islam als eine Verirrung einiger weniger fundamentalistischer Individuen beschrieben. Zudem kommt noch das Problem der Politisierung der Religion hinzu, welches in allen Religionen bedacht werden muss. So ist die Herangehensweise einer Untersuchung von Gewalt in den Religionen sehr unterschiedlich und zudem überaus prekär. Obwohl man als Wissenschaftler oder beim Versuch, einer zu sein, objektiv bleiben sollte, ist wohl nie zu vermeiden, dass die subjektiven Annahmen mit im Spiel sind. Daher lege ich gleich offen, dass ich in Bezug auf die Religionen sehr wohlgesinnt bin und annehme, dass allen Religionen die Bemühung eines besseren Verständnisses der Welt und eines friedlichen Miteinanderlebens zu Eigen ist. Doch diese Annahmen stoßen allenthalben auf Widerstand und daher sehe ich mich gezwungen, diese meine Annahmen zum Teil zurückzunehmen. Liegt es etwa an den falschen Zeugen auf die man sich beruft? Es gibt so viele! Alle sind sie der Meinung, richtig recherchiert und das Material wahrheitsgemäß widergegeben zu haben. Wollte man dem entgehen und eigenständig die Quellen befragen, ergeben sich Fragen wie: Wurde die Quelle verfälscht? Wenn nicht, ist diese Quelle nicht selbst eine Widergabe eines Menschen? Man kann, ad fontes, die heiligen Schriften und ihre frühesten Kommentare studieren oder man lässt sich auf die jüngste Vergangenheit ein und analysiert zudem die Gegenwart. Außerdem kann man die ganze Geschichte einer Religion studieren (Religionsgeschichte). Hier zeichnen sich bereits Spezialisierungen von Wissenschaften ab, die in der Religionswissenschaft alle miteinbezogen werden müssen. Hinzu kommen noch die Religionspsychologie, Religionssoziologie und Religionsethnologie, um nur die wichtigsten zu nennen. Ein weites Feld ...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Bedeutung des Wortes Gewalt
- 2.2. Welche Gewalt kennzeichnet die Religionen?
- 2.3. Definition eines Heiligen Krieges
- 2.4. Überlegungen über die Herkunft der Meinung eines kriegerischen Islam
- 2.5. Bedeutung des Wortes Dschihad
- 2.6. Dschihad allein zur Verteidigung
- 2.7. „Es gibt keinen Zwang in der Religion.“
- 2.8. Alamiyyat al-islam
- 2.9. Staat und Religion
- 2.10. Vergleich: Gewalt im Christentum
- 3. Aussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Gewalt zum Islam, mit besonderem Fokus auf den „Heiligen Krieg“. Die Arbeit beabsichtigt, die verschiedenen Perspektiven auf dieses komplexe Thema zu beleuchten, von der Darstellung des Islam als grundsätzlich gewalttätig bis hin zur Sichtweise, die Gewalt im Islam als ein Phänomen weniger fundamentalistischer Individuen betrachtet. Die Politisierung der Religion wird ebenfalls berücksichtigt.
- Die Bedeutung des Begriffs „Gewalt“ im Kontext religiöser Auseinandersetzungen.
- Die unterschiedlichen Arten von Gewalt und ihre Legitimation innerhalb religiöser Systeme.
- Die Rolle des Dschihad im Islam und dessen Interpretationen.
- Ein Vergleich der Gewalt im Islam mit dem Christentum.
- Die Herausforderungen der wissenschaftlichen Untersuchung von Gewalt im Kontext der Religion.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, das Verhältnis von Gewalt zum Islam zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf den „Heiligen Krieg“. Es wird auf die divergierenden Meinungen zu diesem Thema hingewiesen, welche von einer grundsätzlichen Gewalttätigkeit des Islam bis hin zur Verirrung weniger Fundamentalisten reichen. Die Arbeit betont die Schwierigkeiten einer objektiven Betrachtung aufgrund der subjektiven Annahmen des Forschers und erklärt die eigene wohlwollende Haltung gegenüber Religionen, die jedoch durch die Realität herausgefordert wird. Die Komplexität der Forschungsmethodik und die Notwendigkeit interdisziplinärer Ansätze (Religionsgeschichte, Religionspsychologie, Religionssoziologie, Religionsethnologie) werden hervorgehoben.
2. Hauptteil: Der Hauptteil beginnt mit einer genauen Bestimmung des Begriffs „Gewalt“, indem er zwischen „potestas“ (legitimierte Gewalt) und „vis“ (Gewalt ohne Legitimation) unterscheidet. Der Abschnitt analysiert die Rolle der Gewalt in Religionen und argumentiert, dass nur „vis“ als Gewalt im eigentlichen Sinne zu betrachten ist. Es folgt eine Auseinandersetzung mit dem Verständnis von Gottesgewalt im Islam und Christentum und die Frage, wie dieses Verständnis mit dem Handeln von Gläubigen zusammenhängt. Die Herausforderungen einer rein rationalen Interpretation von Gottesgewalt und die Bedeutung des Phänomens Religion selbst werden diskutiert. Der Hauptteil bereitet den Weg für eine detaillierte Untersuchung des Islams und des Korans im Hinblick auf Gewalt und Heiligen Krieg.
Schlüsselwörter
Gewalt, Islam, Heiliger Krieg, Dschihad, Potestas, Vis, Religion, Christentum, Vergleichende Religionswissenschaft, Gott, Autorität, Legitimation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Gewalt im Islam
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Gewalt zum Islam, insbesondere den „Heiligen Krieg“. Sie beleuchtet verschiedene Perspektiven, von der Darstellung des Islam als grundsätzlich gewalttätig bis hin zur Sichtweise, die Gewalt als ein Phänomen weniger Fundamentalisten betrachtet. Die Politisierung der Religion wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung des Begriffs „Gewalt“ im Kontext religiöser Auseinandersetzungen, die unterschiedlichen Arten von Gewalt und ihre Legitimation innerhalb religiöser Systeme, die Rolle des Dschihad und dessen Interpretationen, einen Vergleich der Gewalt im Islam mit dem Christentum und die Herausforderungen der wissenschaftlichen Untersuchung von Gewalt im Kontext der Religion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Ausblick (Aussichten). Der Hauptteil unterteilt sich in verschiedene Unterkapitel, die sich mit der Bedeutung von Gewalt, den verschiedenen Ausprägungen von Gewalt in Religionen, dem Dschihad, dem Vergleich mit dem Christentum und weiteren Aspekten befassen.
Wie wird der Begriff "Gewalt" definiert?
Die Arbeit differenziert zwischen „potestas“ (legitimierte Gewalt) und „vis“ (Gewalt ohne Legitimation). Nur „vis“ wird als Gewalt im eigentlichen Sinne betrachtet. Die Arbeit analysiert auch die Rolle der Gottesgewalt im Islam und Christentum und deren Zusammenhang mit dem Handeln von Gläubigen.
Welche Rolle spielt der Dschihad in dieser Analyse?
Der Dschihad und dessen unterschiedliche Interpretationen spielen eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht, wie der Begriff im Kontext von Gewalt und „Heiligem Krieg“ verstanden wird und welche Rolle er in der Debatte um Gewalt im Islam spielt.
Wie wird der Islam mit dem Christentum verglichen?
Die Arbeit zieht einen Vergleich zwischen Gewalt im Islam und im Christentum, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Auseinandersetzung mit Gewalt im Kontext religiöser Systeme aufzuzeigen.
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit betont die Schwierigkeiten einer objektiven Betrachtung aufgrund subjektiver Annahmen des Forschers und die Notwendigkeit interdisziplinärer Ansätze (Religionsgeschichte, Religionspsychologie, Religionssoziologie, Religionsethnologie).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Gewalt, Islam, Heiliger Krieg, Dschihad, Potestas, Vis, Religion, Christentum, Vergleichende Religionswissenschaft, Gott, Autorität und Legitimation.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit liefert keine expliziten Schlussfolgerungen im FAQ. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen Ausblick auf die Thematik, deutet aber keine expliziten Schlussfolgerungen an. Nähere Informationen dazu finden sich im Volltext der Arbeit.
- Citar trabajo
- Magister Artium Abe Jarron (Autor), 2007, Heiliger Krieg im Islam, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188600