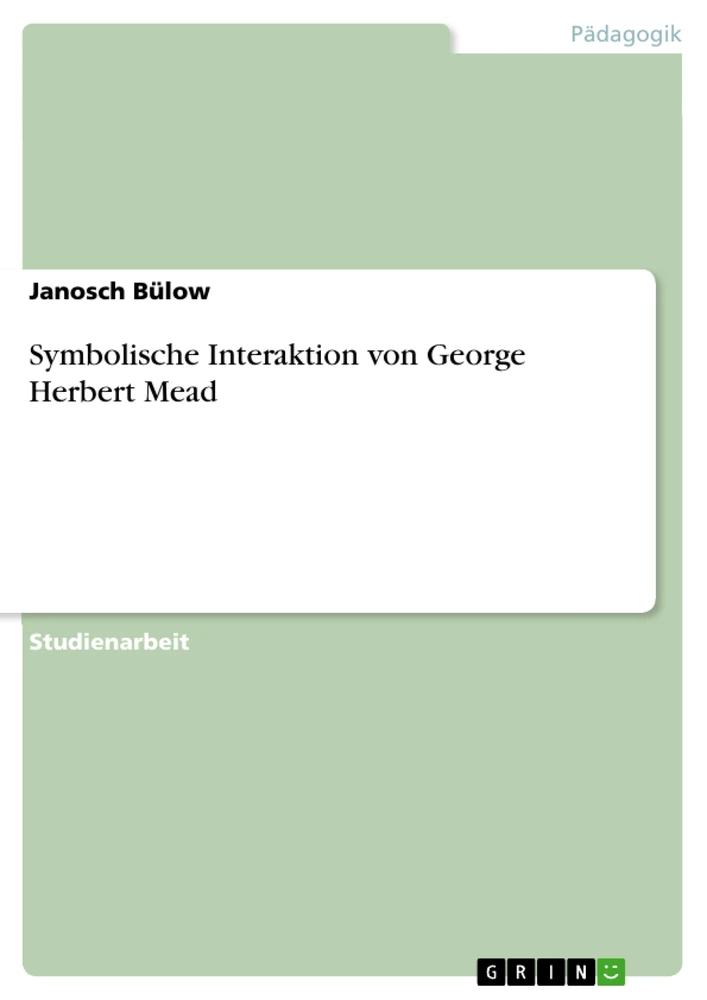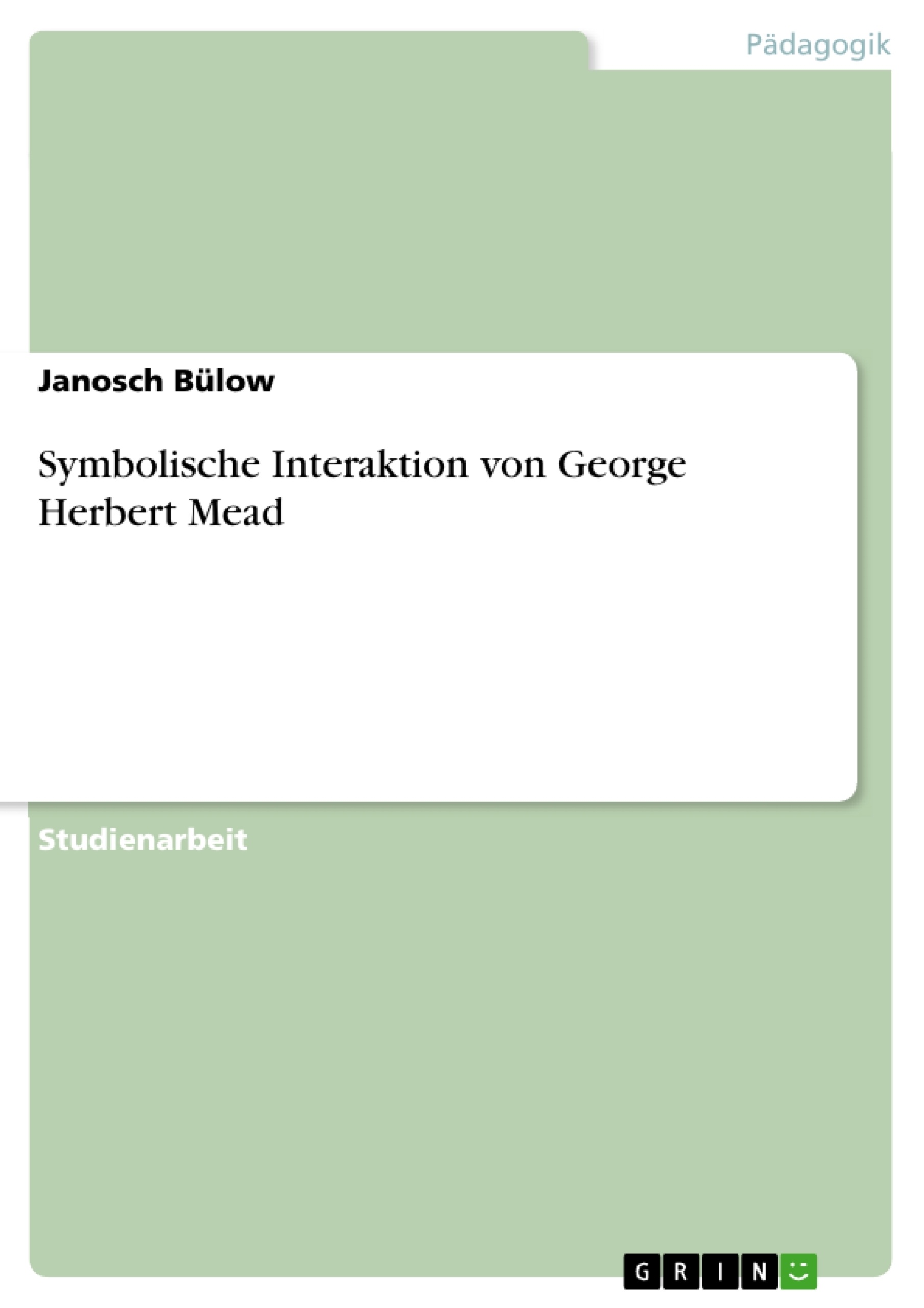Im Rahmen des Seminars „Sozialisation in der ausdifferenzierten Gesellschaft“ wurden verschiedene Theorien der Sozialisation von Referatsgruppen bearbeitet und vorgestellt. Meine Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der Sozialisationstheorie von George Herbert Mead, die er Symbolischer Interaktionismus nannte.
Als Einstieg für meine Ausarbeitung wähle ich, parallel zum Referat, einen biografischen Abriss, der sich bezogen auf Herkunft, Werdegang und Entstehung der späteren Theorie als aufschlussreich herausstellte. Anschließend soll erläutert werden, was der Begriff der Symbolischen Interaktion ausdrücken möchte. Hierzu wird genauer beschrieben, warum Symbole für Kommunikation unerlässlich sind und was Mead unter Interaktion verstand. Da Sprache nur eine der drei Sozialisationsstufen ist, sollen anschließend die anderen bei-den, das Play und das Game, erklärt werden. Hierzu möchte ich in Anlehnung an den Text Baumgarts versuchen, die theoretischen Überlegungen durch alltägliche Beispiele aus der Welt der Kinder zu verdeutlichen. Nach dieser Beschreibung, wie durch Spiel und Wett-kampf, das Einnehmen von Rollen sowie die Verinnerlichung allgemeiner Erwartungen Identität entsteht, sollen im Anschluss die zwei Phasen der Identität untersucht werden. Diesbezüglich soll erarbeitet werden, welche Merkmale personale und soziale Identität aufweisen und wie diese sich gegenseitig beeinflussen und so ausschlaggebend für die Identitätsentwicklung werden. Als Grundlage für diesen Hauptteil werden die Texte von Baumgart und Mead aus dem Werk „Theorien der Sozialisation“ (in: Baumgart 2000, 119 – 138) herangezogen.
Anders als dies im Referat geleistet werden konnte, möchte ich auf die Bedeutsamkeit die-ser Theorien für die spätere Arbeitswelt eingehen. Der ebenfalls im verwendeten Buch enthaltene Text von Tillmann (s.o., 139 – 150) liefert aufschlussreiche Ansätze über die Bedeutung von Meads Theorie in der Schule. So ist diese beispielsweise geeignet, um die Struktur von unterrichtlicher Kommunikation zu analysieren, um Etikettierung zu erklären und so darzustellen, wie Schule die Entwicklung der Identität beeinflusst.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Bezeichnungen wie Lehrer, Schüler, Wissen-schaftler, etc. als Gruppen- bzw. Berufsbezeichnungen gedacht sind und nicht als ge-schlechtsspezifische Zuweisungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Biografie
- 3 Symbolischer Interaktionismus
- 3.1 Symbole
- 3.2 Interaktion
- 3.3 Symbolische Interaktion
- 4 Sozialisation durch „Play“ und „Game“
- 4.1 „Play“ (Spiel)
- 4.2 „Game“ (Wettkampf)
- 4.3 Das „verallgemeinerte Andere“
- 5 Identität
- 5.1 Entstehung von Identität
- 5.2 „I“ (Personale Identität)
- 5.3 „Me“ (Soziale Identität)
- 5.4 „Self“ (Identität)
- 6 Bedeutung für die Schule
- 6.1 Schulische Kommunikation
- 6.2 Einfluss von Bewertung auf Identität
- 6.3 Etikettierung
- 7 Fazit und offene Fragen
- 8 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht George Herbert Meads Theorie des Symbolischen Interaktionismus und deren Bedeutung für die Sozialisation. Die Arbeit beleuchtet Meads Biografie, um seine Theorie besser zu verstehen. Der Fokus liegt auf der Erklärung des Symbolischen Interaktionismus, der Rolle von „Play“ und „Game“ in der Identitätsentwicklung, und der Anwendung der Theorie auf schulische Kontexte.
- Meads Biografie und die Entstehung seiner Theorie
- Erläuterung des Symbolischen Interaktionismus und seiner Kernkonzepte
- Die Bedeutung von „Play“ und „Game“ für die Identitätsbildung
- Die Entwicklung von personaler und sozialer Identität
- Anwendung der Theorie auf schulische Kommunikation und den Einfluss von Bewertung auf die Identität
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Ausarbeitung ein. Sie beschreibt den Kontext des Seminars „Sozialisation in der ausdifferenzierten Gesellschaft“ und benennt das Thema der Arbeit: die Sozialisationstheorie von George Herbert Mead. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Ausarbeitung und die verwendeten Quellen.
2 Biografie: Dieses Kapitel gibt einen biografischen Abriss über George Herbert Mead, seine akademische Laufbahn und die Einflüsse, die seine Theorie prägten. Es werden seine Studien in Oberlin, Harvard und Berlin thematisiert, sowie seine Auseinandersetzung mit der Evolutionslehre und dem christlichen Glauben. Der Einfluss von Persönlichkeiten wie William James, John Dewey und Charles Peirce wird hervorgehoben, und es wird auf die posthum veröffentlichten Arbeiten und die Rolle von Schülern wie Charles W. Morris und Herbert Blumer hingewiesen.
3 Symbolischer Interaktionismus: Dieses Kapitel erläutert Meads Theorie des Symbolischen Interaktionismus. Es definiert den Begriff „Symbol“ und zeigt dessen Bedeutung für die Kommunikation auf, unter Berücksichtigung von sprachlichen und nichtsprachlichen Ausdrucksformen. Der Abschnitt über „Interaktion“ präzisiert den begrifflichen Rahmen für die folgenden Kapitel und verdeutlicht die Wechselwirkung von Individuen durch Kommunikation und Handlung.
4 Sozialisation durch „Play“ und „Game“: Dieses Kapitel erklärt die Sozialisationsstufen „Play“ und „Game“ nach Mead. Es werden alltägliche Beispiele aus der Welt der Kinder verwendet, um die theoretischen Überlegungen zu veranschaulichen und die Entwicklung von Rollenverständnis und der Internalisierung von Normen und Werten zu verdeutlichen. Der Begriff des „verallgemeinerten Anderen“ wird im Kontext des „Game“ erläutert.
5 Identität: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung von Identität im Kontext der Meadschen Theorie. Es analysiert die Entwicklung der personalen Identität („I“) und der sozialen Identität („Me“) und deren gegenseitigen Einfluss. Der Begriff des „Self“ als Gesamtheit der Identität wird eingeordnet und die Bedeutung des „verallgemeinerten Anderen“ in diesem Kontext erneut hervorgehoben.
6 Bedeutung für die Schule: Dieses Kapitel wendet die Theorie des Symbolischen Interaktionismus auf den schulischen Kontext an. Es analysiert die schulische Kommunikation, den Einfluss von Bewertung auf die Identität und die Rolle der Etikettierung in der Schule. Es zeigt auf, wie die Meadsche Theorie zur Analyse und zum Verständnis von Prozessen in der Schule genutzt werden kann.
Schlüsselwörter
Symbolischer Interaktionismus, George Herbert Mead, Sozialisation, Identität, Play, Game, verallgemeinertes Anderes, personale Identität, soziale Identität, Schule, Kommunikation, Bewertung, Etikettierung.
Häufig gestellte Fragen zu: Sozialisationstheorie von George Herbert Mead
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Sozialisationstheorie von George Herbert Mead, insbesondere seinen Symbolischen Interaktionismus und dessen Bedeutung für die Identitätsentwicklung, mit einem Fokus auf die Anwendung der Theorie im schulischen Kontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Meads Biografie, den Symbolischen Interaktionismus (inkl. Symbole, Interaktion und symbolischer Interaktion), die Rolle von „Play“ und „Game“ in der Sozialisation, die Entwicklung von personaler („I“) und sozialer Identität („Me“) und dem „Self“, sowie die Anwendung dieser Konzepte auf schulische Kommunikation, Bewertung und Etikettierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Biografie Meads, Symbolischer Interaktionismus, Sozialisation durch „Play“ und „Game“, Identität, Bedeutung für die Schule und Fazit/offene Fragen. Zusätzlich enthält sie ein Literaturverzeichnis.
Was ist der Symbolische Interaktionismus nach Mead?
Der Symbolische Interaktionismus beschreibt, wie Individuen durch den Austausch von Symbolen (sprachlich und nichtsprachlich) miteinander interagieren und ihre Identität entwickeln. Die Bedeutung von Symbolen wird hierbei zentral betrachtet.
Welche Rolle spielen „Play“ und „Game“ in Meads Theorie?
„Play“ (Spiel) repräsentiert eine frühe Sozialisationsstufe, in der Kinder einzelne Rollen übernehmen. „Game“ (Wettkampf) beinhaltet das Verständnis mehrerer Rollen gleichzeitig und die Internalisierung des „verallgemeinerten Anderen“, also der gesellschaftlichen Erwartungen.
Was ist das „verallgemeinerte Andere“?
Das „verallgemeinerte Andere“ bezeichnet die internalisierten Erwartungen und Normen der Gesellschaft, die das Individuum im „Game“ erlernt und in sein Handeln integriert.
Wie unterscheidet Mead zwischen „I“, „Me“ und „Self“?
„I“ repräsentiert die spontane, personale Identität. „Me“ steht für die soziale Identität, die durch die Internalisierung gesellschaftlicher Erwartungen entsteht. „Self“ ist die Gesamtheit von „I“ und „Me“, also die Identität des Individuums.
Welche Bedeutung hat Meads Theorie für den schulischen Kontext?
Die Arbeit analysiert, wie schulische Kommunikation, Bewertung und Etikettierung die Identitätsentwicklung von Schülern beeinflussen. Meads Theorie bietet ein hilfreiches Werkzeug, um diese Prozesse zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Symbolischer Interaktionismus, George Herbert Mead, Sozialisation, Identität, Play, Game, verallgemeinertes Anderes, personale Identität, soziale Identität, Schule, Kommunikation, Bewertung, Etikettierung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Literaturverzeichnis der Arbeit listet die verwendeten Quellen auf, die weiterführende Informationen liefern.
- Quote paper
- Janosch Bülow (Author), 2010, Symbolische Interaktion von George Herbert Mead, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188525