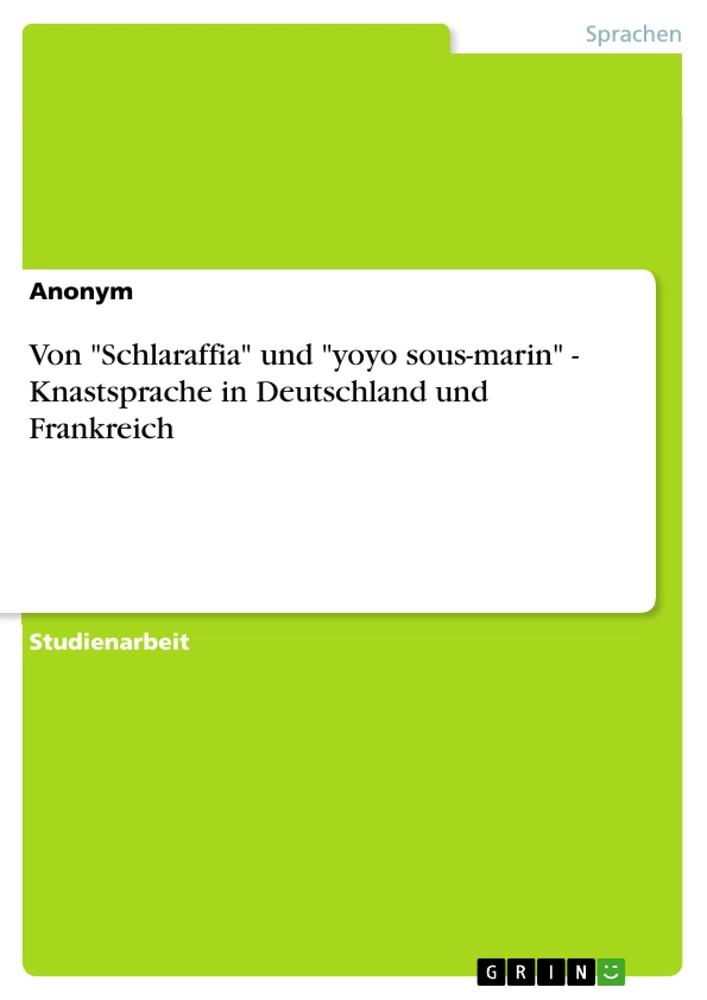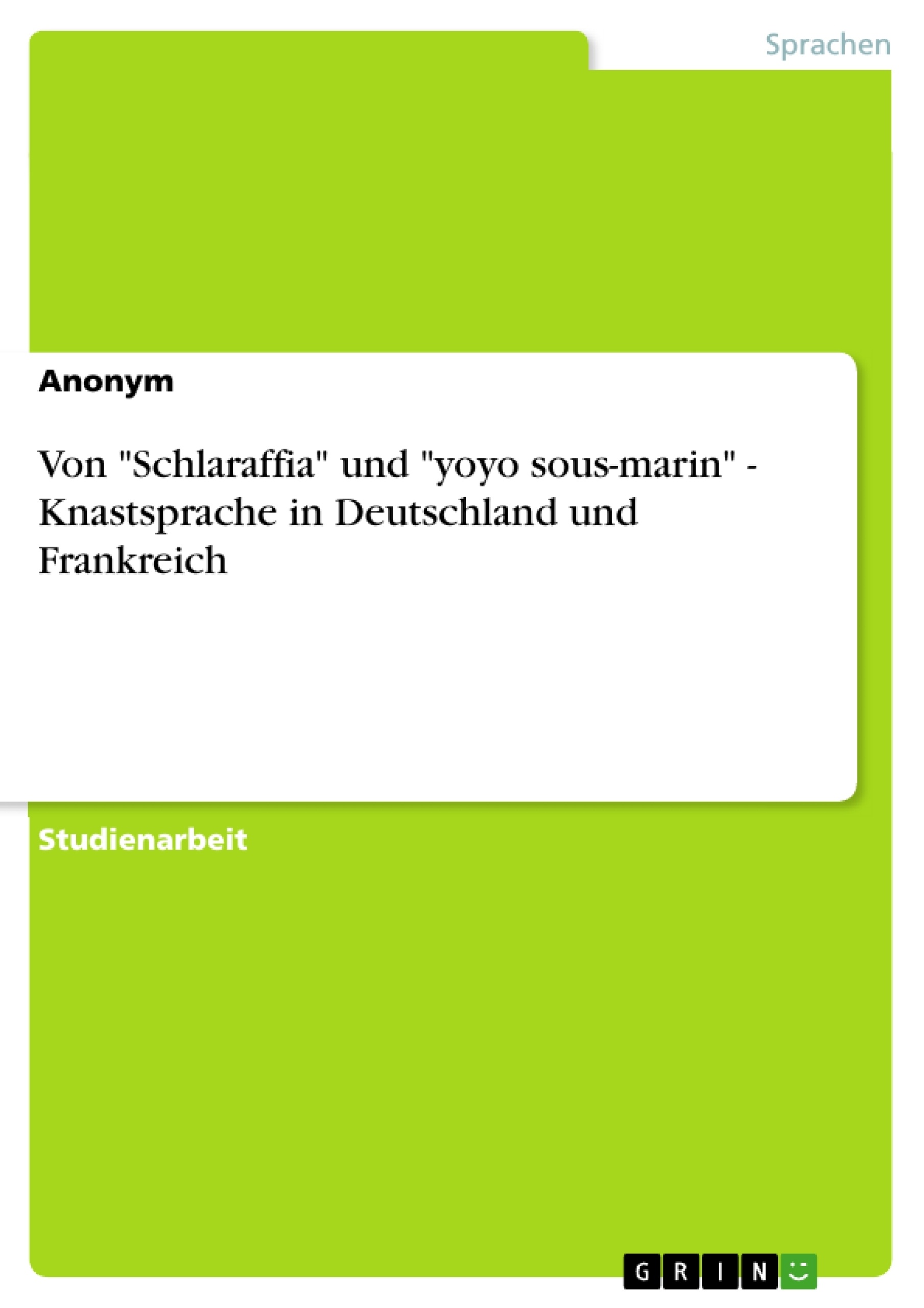Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines Seminars zum übersetzungsorientierten Textvergleich (Französisch – Deutsch) im Bereich Argot, Jargon und Jugendsprachen und möchte sich mit der Sprache von Strafgefangenen in deutschen und französischen Haftanstalten auseinandersetzen. Schlaraffia, Pistenboss oder yoyo sous-marin sind wohl Begriffe, deren Bedeutung den meisten Deutschen bzw. Franzosen verborgen bleibt, da die Welt innerhalb von Gefängnismauern (aus zum Teil guten Gründen) zu einem der abgeschlossensten und unbekanntesten Bereiche unserer Gesellschaft zählt. Das Fremde birgt aber gleichzeitig auch Geheimnisvolles, ja vielleicht sogar Faszinierendes, ist doch nahezu jede/r schon mit Gerüchten über todsichere Schmuggeltricks, knasteigene Währungen oder einer geheimen Rangordnung unter Häftlingen in Berührung gekommen. Für diejenigen aber, die in ihrem beruflichen Alltag mit Gefängnisinsassen Umgang haben (wie das Vollzugspersonal, SozialarbeiterInnen, PsychologInnen oder GerichtsdolmetscherInnen), ist die Kenntnis der Sprache und Gepflogenheiten der Inhaftierten für eine gelingende Tätigkeit unerlässlich. Und so wird diese Arbeit den Leser nicht nur in das Vokabular von Gefangenen in Frankreich und Deutschland einführen, sondern auch einen Einblick in die Bedingungen und Phänomene des Gefängnisalltages bieten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HAUPTTEIL
- Zum Begriff
- Das Gefängnis als Lebensraum
- Zahlen und Fakten
- Das Gefängnis als totale Institution
- Die Gefängnissubkultur
- Die Knastsprache in Deutschland und Frankreich
- Grundlegendes
- Funktionen der Knastsprache
- Verfahren zur Erweiterung des (Gefangenen-) Wortschatzes
- Vergleich dreier Begriffsfelder
- Zum Begriffsfeld „Gefängnis“
- Zum Begriffsfeld „Gefängniswärter/in“
- Zum Begriffsfeld „Häftling“
- Zusammenschau
- Analyse eines Videos zum Gefängnisalltag
- Das Projekt „Podknast“
- Inhalt des Kurzfilms
- Analyse der Dialoge
- Analyse der Bilder
- ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Sprache von Strafgefangenen in deutschen und französischen Haftanstalten. Sie analysiert die Knastsprache, ihre Funktionen, ihre Entstehung und Entwicklung sowie ihre Verwendung im Kontext des Gefängnisalltags.
- Definition und Einordnung der Knastsprache
- Das Gefängnis als Lebensraum und die Entstehung der Gefängnissubkultur
- Vergleichende Betrachtung der Knastsprache in Deutschland und Frankreich
- Analyse von Wortbildungsprozessen und Begriffsfeldern
- Einblick in die Funktionen und Verwendung der Knastsprache im Gefängnisalltag
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der Knastsprache vor, beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit und erläutert die Relevanz der Sprache für verschiedene Akteure im Gefängnisbereich.
- Zum Begriff: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Knastsprache und setzt ihn in den Kontext der Soziolinguistik. Es werden verschiedene Bezeichnungen in deutscher und französischer Sprache vorgestellt und die Sprachgemeinschaft der Häftlinge von anderen Gruppen im Gefängnis abgegrenzt.
- Das Gefängnis als Lebensraum: Dieses Kapitel befasst sich mit den Bedingungen des Gefängnislebens, einschließlich der Totalität der Institution, der Gefängnissubkultur und der Auswirkungen des Gefängnisalltags auf die Sprache der Häftlinge.
- Die Knastsprache in Deutschland und Frankreich: Dieses Kapitel analysiert die Knastsprache beider Länder, inklusive ihrer Funktionen, ihrer Herkunft und ihrer Entwicklung. Es werden Wortbildungsprozesse und relevante Begriffsfelder untersucht.
Schlüsselwörter
Knastsprache, Gefängnissprache, Argot, Jargon, Soziolekt, Gefängnisalltag, Gefängnissubkultur, Sprachgemeinschaft, Wortbildung, Lexik, Vergleichende Sprachwissenschaft, Deutschland, Frankreich
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2011, Von "Schlaraffia" und "yoyo sous-marin" - Knastsprache in Deutschland und Frankreich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188382