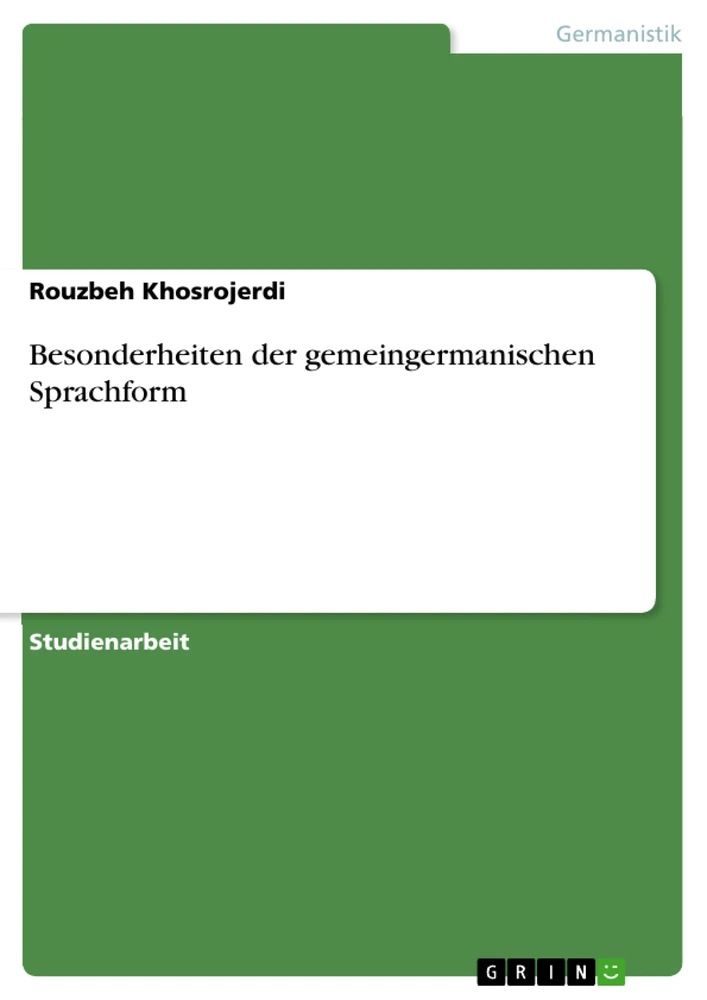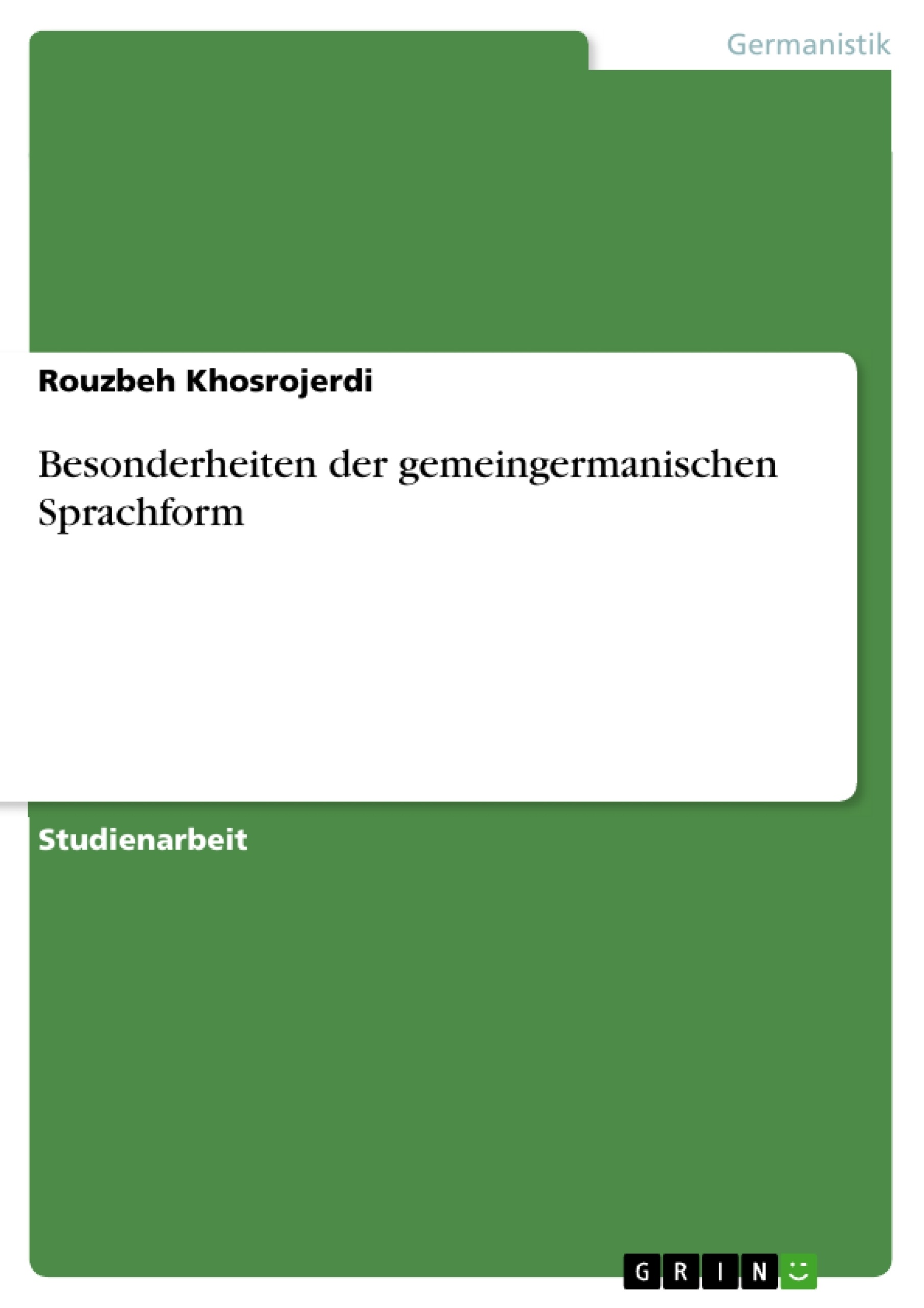Mit Ausnahme des Finnischen, des Ungarischen, Baskischen und des Türkischen sind alle heute noch lebenden europäischen Sprachen indogermanischen Ursprungs, das heißt sie gehen alle auf dieselben sprachlichen Wurzeln zurück. Darüber hinaus gehören außerhalb Europas die Hauptsprachen des indischen Subkontinents, Hindi und Urdu, sowie das Armenische und das Persische der indogermanischen Sprachenfamilie an. (Schmidt, W. 1996. Geschichte der deutschen Sprache, S.32) Wenn eine die verschiedenen Kulturen verbindende indogermanische Sprache angenommen wird, aus der sich, die heute erkennbaren Sprachfamilien entwickelt haben, so ist natürlich auch ein ursprüngliches Volk anzunehmen, das diese Sprache gesprochen haben muss. Für ein solches einheitliches Volk der Indogermanen gibt es weder archäologische, noch biologische, erst recht keine schriftlichen Beweise. Dennoch werden wissenschaftliche Theorien aufgestellt um das Leben und die Sprache der Indogermanen zu rekonstruieren. Der Wellentheorie von Johannes Schmidt zufolge waren die Indogermanen ursprünglich in Mittel- oder Südasien beheimatet, von wo aus sie zwischen 4000 und 1000 v.Chr. in mehreren, zeitlich weit auseinander liegenden Wellen nach Europa und Asien einwanderten. Die zeitliche Abstufung erklärt, wie aus einer gemeinsamen Ausgangssprache die späteren, deutlich unterscheidbaren Sprachfamilien entstehen. (Ebd, S.37) Alle diese modernen Sprachen haben untereinander Strukturen mit dem Sanskrit - das vor immerhin 2300 Jahren ausstarb -, mit dem Altgriechischen und sogar dem Hethitischen (um 1200 v. Chr. untergegangen) gemeinsam.
Manche Wörter, die in mehreren indogermanischen Sprachen vorkommen, sind heute frappierend ähnlich, und wie nahe sich die deutsche und die indische Grammatik sind, wird deutlich, wenn man sie mit der japanischen, einer indianischen oder afrikanischen Sprache vergleicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Indogermanische Sprachfamilie
- 2. Das Indogermanische
- 2.1. Lexikalische Gemeinsamkeiten
- 2.2. Morphologische Gemeinsamkeiten
- 2.2.1. Nominalformen
- 2.2.1.1. Vokalische Klassen
- 2.2.1.2. Konsonantische Klassen
- 2.2.2. Verbalformen
- 2.2.1. Nominalformen
- 2.3. Ablaut
- 2.4. Wortakzent
- 3. Germanisch
- 3.1. Lautbestand
- 3.1.1. Germanische Lautverschiebung
- 3.1.2. Das Vernersche Gesetz und der Grammatische Wechsel
- 3.1.3. Vokalische Veränderungen
- 3.1. Lautbestand
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Besonderheiten der Entwicklung vom Indogermanischen zum Deutschen zu verdeutlichen. Sie illustriert zunächst die Charakteristika der rekonstruierten indogermanischen Sprache anhand ihrer Tochtersprachen und beschreibt anschließend die Entwicklung zur ersten deutschen Sprachstufe, dem Germanischen.
- Die indogermanische Sprachfamilie und ihre Verbreitung
- Lexikalische und morphologische Gemeinsamkeiten indogermanischer Sprachen
- Das indogermanische Nominalsystem (Kasus, Numerus, Genus)
- Die Germanische Lautverschiebung
- Entwicklungsphasen vom Indogermanischen zum Germanischen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Indogermanische Sprachfamilie: Dieses Kapitel beleuchtet die weitreichende Verbreitung der indogermanischen Sprachfamilie, die von Europa bis nach Asien reicht und die meisten europäischen Sprachen sowie wichtige Sprachen des indischen Subkontinents umfasst. Es diskutiert die Wellentheorie von Johannes Schmidt, die die Ausbreitung der indogermanischen Sprachen über mehrere Wellen von Mittel- oder Südasien aus erklärt. Die These einer gemeinsamen indogermanischen Ursprache und eines damit verbundenen Volkes wird behandelt, wobei die fehlenden archäologischen, biologischen und schriftlichen Beweise hervorgehoben werden.
2. Das Indogermanische: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rekonstruktion der indogermanischen Sprache anhand von lexikalischen und morphologischen Gemeinsamkeiten ihrer Tochtersprachen. Die lexikalischen Gemeinsamkeiten werden durch Beispiele wie "Mutter" in verschiedenen indogermanischen Sprachen verdeutlicht, um die Verwandtschaft aufzuzeigen. Im morphologischen Bereich wird das komplexe Kasussystem der indogermanischen Nomina detailliert analysiert und anhand von Beispielen aus Latein, Altindisch und Griechisch illustriert. Die Kapitel behandeln weiterhin die Unterscheidung der Genera und die Stammbildungsklassen, unterteilt in vokalisches und konsonantische Klassen, und erläutert diese anhand von Beispielen aus verschiedenen Sprachen.
3. Germanisch: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung des Germanischen aus dem Indogermanischen, insbesondere auf die Veränderungen im Lautbestand. Die Germanische Lautverschiebung wird als ein zentraler Prozess beschrieben, der die germanischen Sprachen von anderen indogermanischen Sprachen unterscheidet. Das Vernersche Gesetz und der grammatische Wechsel werden erläutert, sowie vokalischer Veränderungen, die die Entwicklung der germanischen Sprachen weiter prägten. Der Fokus liegt auf den lautlichen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Struktur der germanischen Sprachen.
Schlüsselwörter
Indogermanisch, Germanisch, Sprachfamilie, Lautverschiebung, Morphologie, Lexik, Nominalformen, Kasus, Genus, Numerus, Rekonstruktion, Sprachvergleich, Wellentheorie, Johannes Schmidt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum indogermanischen Sprachvorbericht
Was ist der Inhalt dieses Sprachvorberichts?
Dieser Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung vom Indogermanischen zum Deutschen. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der indogermanischen Sprachfamilie, der Rekonstruktion des Indogermanischen anhand lexikalischer und morphologischer Gemeinsamkeiten, sowie der Germanischen Lautverschiebung und der Entwicklung des Germanischen aus dem Indogermanischen.
Welche Themen werden im Vorbericht behandelt?
Der Bericht behandelt die indogermanische Sprachfamilie und ihre Verbreitung, lexikalische und morphologische Gemeinsamkeiten indogermanischer Sprachen, das indogermanische Nominalsystem (Kasus, Numerus, Genus), die Germanische Lautverschiebung, Entwicklungsphasen vom Indogermanischen zum Germanischen, die Rekonstruktion der indogermanischen Sprache und die Wellentheorie von Johannes Schmidt.
Wie ist der Bericht strukturiert?
Der Bericht ist in drei Hauptkapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt die indogermanische Sprachfamilie und ihre Ausbreitung. Kapitel 2 konzentriert sich auf die Rekonstruktion des Indogermanischen, indem lexikalische und morphologische Gemeinsamkeiten in den Tochtersprachen analysiert werden (inkl. Nominalformen, Verbalformen, Ablaut und Wortakzent). Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung des Germanischen aus dem Indogermanischen, mit besonderem Fokus auf die Germanische Lautverschiebung, das Vernersche Gesetz und den grammatischen Wechsel.
Welche Methoden werden zur Rekonstruktion des Indogermanischen verwendet?
Die Rekonstruktion des Indogermanischen basiert auf dem Vergleich der Tochtersprachen. Der Bericht verwendet den Vergleich von Lexemen (z.B. "Mutter" in verschiedenen Sprachen) und die Analyse morphologischer Gemeinsamkeiten (z.B. Kasus, Numerus, Genus) um Gemeinsamkeiten und Entwicklungen aufzuzeigen.
Was ist die Germanische Lautverschiebung?
Die Germanische Lautverschiebung ist ein zentraler Prozess in der Entwicklung der germanischen Sprachen aus dem Indogermanischen. Sie beschreibt systematische Lautänderungen, die die germanischen Sprachen von anderen indogermanischen Sprachen unterscheiden. Der Bericht erläutert diesen Prozess detailliert und beschreibt seine Auswirkungen auf die Struktur der germanischen Sprachen.
Welche Bedeutung hat die Wellentheorie von Johannes Schmidt?
Die Wellentheorie von Johannes Schmidt ist eine alternative Erklärung zur Ausbreitung der indogermanischen Sprachen. Im Gegensatz zur Annahme einer einzigen Urheimat und -bevölkerung, postuliert die Wellentheorie eine allmähliche Ausbreitung durch Wellenbewegungen von Mittel- oder Südasien aus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Berichts?
Schlüsselwörter sind: Indogermanisch, Germanisch, Sprachfamilie, Lautverschiebung, Morphologie, Lexik, Nominalformen, Kasus, Genus, Numerus, Rekonstruktion, Sprachvergleich, Wellentheorie, Johannes Schmidt.
- Quote paper
- Rouzbeh Khosrojerdi (Author), 2010, Besonderheiten der gemeingermanischen Sprachform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188175