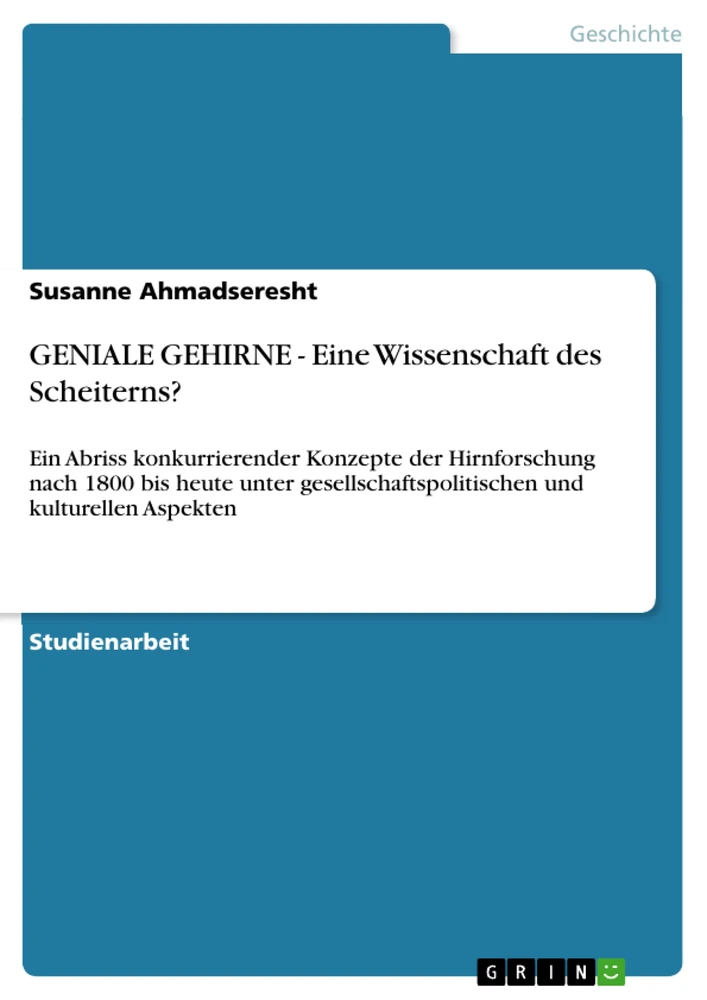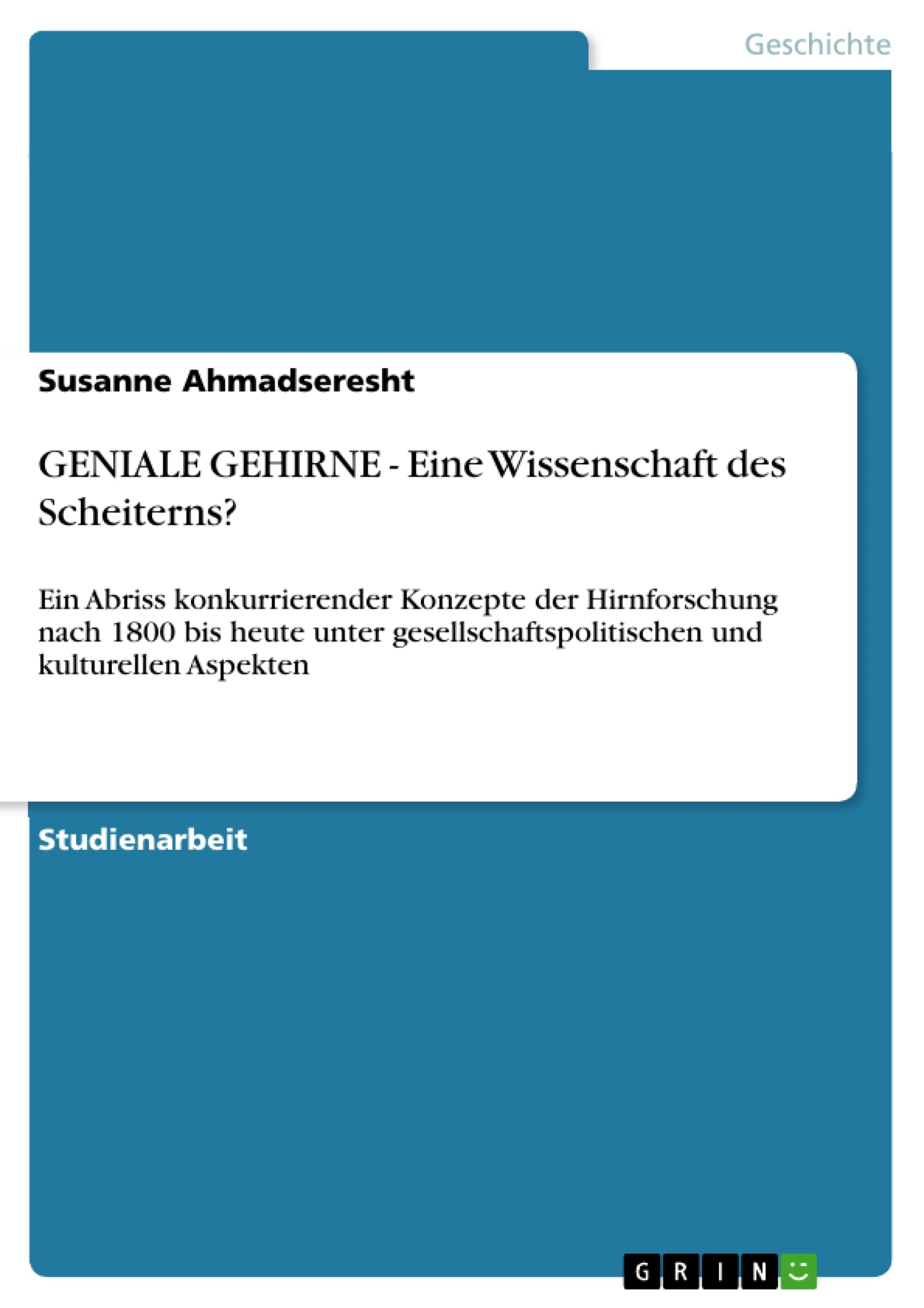In der folgenden Arbeit möchte ich einen Abriss der Hirnforschung nach 1800 bis heute geben. Dabei werde ich unterschiedliche Konzepte beleuchten und die damit verbundenen gesellschaftspolitischen und kulturellen Aspekte darstellen. Das Wechselspiel zwischen der gesellschaftspolitischen Entwicklung und den wissenschaftlichen Möglichkeiten in der Hirn-forschung nach 1800 soll im Fokus meiner Betrachtung stehen und die Frage nach Erfolg bzw. Misserfolg beantworten.
Hierfür werde ich mich mit der Literatur von Michael Hagner, Erhard Oeser, Jochen Schmidt, Edgar Zilsel und Christiane Frey auseinandersetzen, um Verbindungen zwischen der Hirn-forschung und den kulturellen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen darzustellen. Es wird von besonderem Interesse sein, zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Methoden, welche Ziele angestrebt wurden. Dies kann natürlich nur durch einen groben Abriss geschehen und erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Physiognomie, Phrenologie und Kraniologie im methodisch-historischen Kontext nach 1800
- Physiognomik - Das Geniale „ablesen“
- Der Zusammenhang von Gehirn und Geistesfähigkeit
- Neue Denkansätze
- Der Maschinenmensch
- Die Phrenologie
- Kulturelle Tabus und Gepflogenheiten
- Kant als Paradebeispiel für Galls Schädellehre
- Die Kraniologie
- Physiognomik - Das Geniale „ablesen“
- Der Schädel als Beweis für das Geniale
- Schädel versus Gehirn im 19. Jahrhundert
- Vermessung, Hagiographie und Erinnerungskultur
- Das Genie im soziokulturellen Kontext ab 1900
- Elitegehirnforschung
- Nach der Elitegehirnforschung
- Dem Gehirn beim Denken zusehen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Hirnforschung im Zeitraum von 1800 bis zur Gegenwart. Sie analysiert verschiedene Konzepte und deren gesellschaftliche und kulturelle Auswirkungen. Im Mittelpunkt steht das Wechselspiel zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und wissenschaftlichen Möglichkeiten in der Hirnforschung, insbesondere die Frage nach Erfolg und Misserfolg.
- Entwicklung verschiedener Hirnforschungskonzepte nach 1800
- Gesellschaftliche und kulturelle Aspekte der Hirnforschung
- Der Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen auf die Hirnforschung
- Die Frage nach Erfolg und Misserfolg in der Hirnforschung
- Methoden und Ziele der Hirnforschung im historischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Fokus auf die Entwicklung der Hirnforschung nach 1800 bis heute legt. Sie behandelt das Wechselspiel zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und wissenschaftlichen Möglichkeiten in der Hirnforschung.
Im zweiten Kapitel werden die Physiognomie, Phrenologie und Kraniologie im methodisch-historischen Kontext nach 1800 beleuchtet. Hier werden die Theorien und Methoden dieser frühen Hirnforschungskonzepte vorgestellt und deren kulturelle und gesellschaftliche Auswirkungen diskutiert.
Kapitel drei befasst sich mit dem Schädel als Beweis für das Geniale. Es werden die Methoden der Schädelvermessung und deren Einfluss auf das Verständnis von Intelligenz und Genialität im 19. Jahrhundert untersucht.
Kapitel vier stellt die Debatte um Schädel und Gehirn im 19. Jahrhundert dar. Es wird die Entwicklung der Hirnforschung vom Fokus auf den Schädel hin zum Studium des Gehirns selbst betrachtet.
Das fünfte Kapitel behandelt die Themen Vermessung, Hagiographie und Erinnerungskultur. Es werden die Methoden der Hirnforschung im Kontext der Erinnerungskultur des 19. Jahrhunderts untersucht.
Kapitel sechs befasst sich mit dem Genie im soziokulturellen Kontext ab 1900. Es werden die Veränderungen in der Hirnforschung im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen des 20. Jahrhunderts betrachtet.
Das siebte Kapitel behandelt die Elitegehirnforschung. Es werden die Methoden und Ziele der Elitegehirnforschung untersucht und deren gesellschaftliche und kulturelle Auswirkungen analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Hirnforschung, Genialität, Physiognomie, Phrenologie, Kraniologie, Schädelvermessung, gesellschaftliche und kulturelle Auswirkungen, Elitegehirnforschung, Methoden der Hirnforschung, historische Entwicklung der Hirnforschung, Erfolg und Misserfolg in der Hirnforschung.
- Quote paper
- Susanne Ahmadseresht (Author), 2010, GENIALE GEHIRNE - Eine Wissenschaft des Scheiterns?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188159