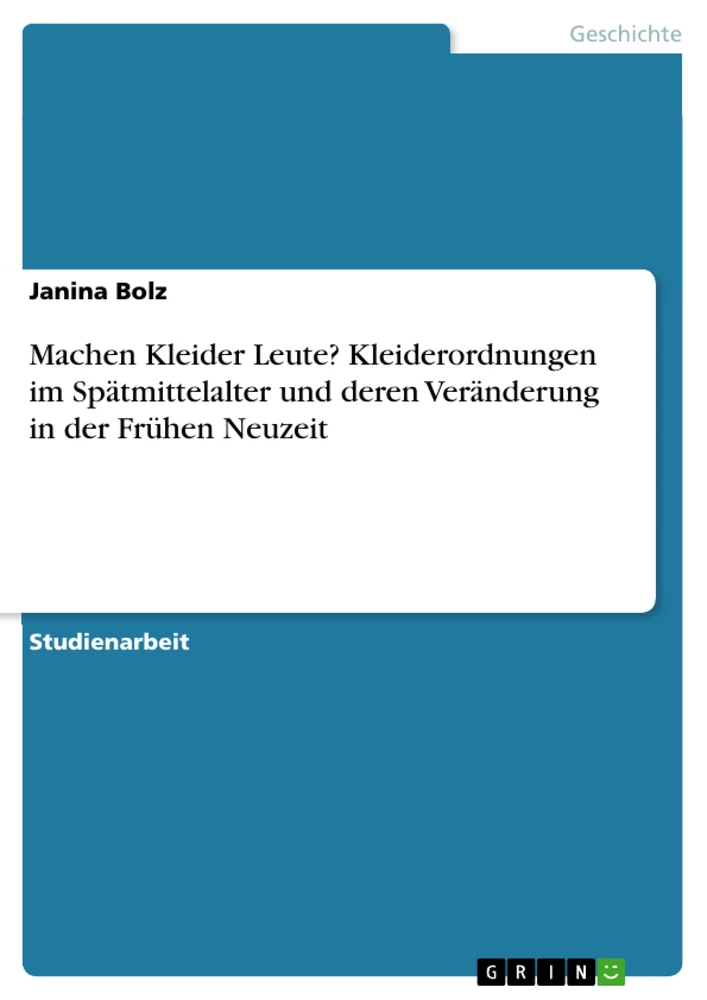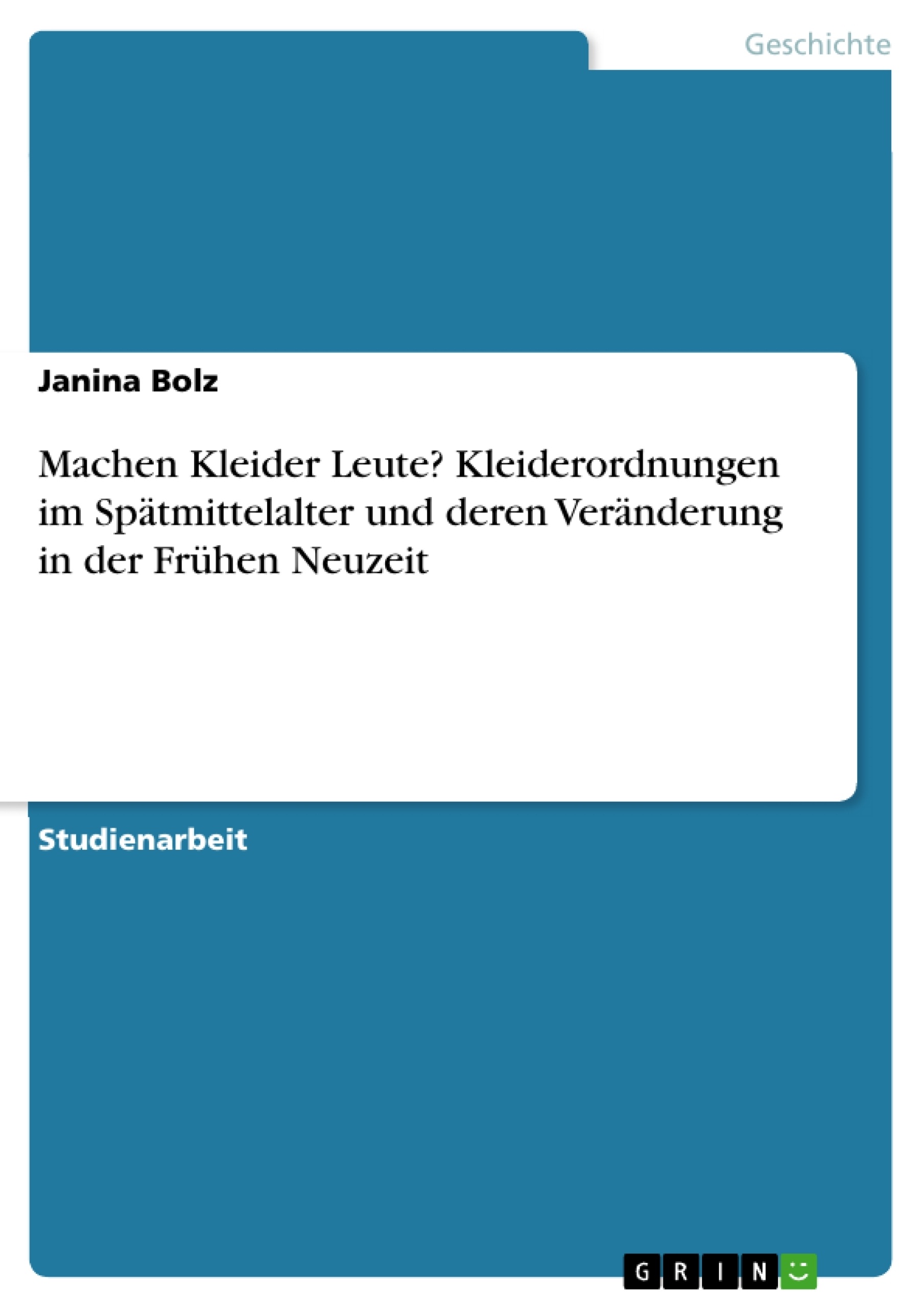Kleidung ist schon immer ein fester Bestandteil menschlichen Lebens. Für das Entstehen und die Entwicklung von Kleidung waren die Bedingungen der menschlichen Lebensweise und Umwelt sicher maßgeblicher als das Schamgefühl dieser.
Im Laufe des Mittelalters wurde es immer deutlicher, dass Kleidung Konventionen schuf, in dem Sinne, dass damit Sitten geschafften wurden. Man kleidete sich mit dem, was man hatte und trug dabei auch alte Kleidung auf. Wichtig war, dass man etwas am Leibe trug. Erst in Folge der Entwicklungen des 11. und 12.Jahrhunderts wurde das archaische System und dessen Hierarchie in Frage gestellt, der soziale Aufstieg einer neuen Schicht der Kaufleute und Handwerker möglich und so traten auch die Ideen von Nutzen und Wirklichkeit in das Bewusstsein der Bevölkerung. Das trug zur Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes bei. Soziale Schicht und Status waren vermehrt durch Farbe und Art der Kleidung abzulesen, bunte und phantasievolle Modekreationen setzten sich trotz Kleiderordnungen durch. Aus diesem Grund wurde eine ständige Veränderung in der Mode hervorgerufen, „denn das Allernötigste an Kleidung fand sich leichter […]“ so dass es auch vorkam, dass man die verschiedensten Dinge miteinander kombinierte.
Ab dem 13. Jahrhundert entwickelte sich die Kleidung immer mehr zum Ausdruckssymbol eines gesellschaftlichen Standes. Aus diesem Grunde kann man sagen, dass modischer Wandel oft mit einer bestimmten gesellschaftlichen Dynamik einher zu gehen scheint. So lassen Bildquellen darauf schließen, dass vor allem beim städtischen Bürgertum Kleidung einem stetigen Wandel unterzogen war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die städtische Gesellschaft: Kleidung als Mittel zur Abgrenzung
- 2. Kleiderordnungen
- 2.1 Sozialdisziplinierung durch Kleiderordnungen
- 2.2 Kleiderordnungen im Mittelalter
- 2.3 Kleiderordnungen in der Frühen Neuzeit
- 2.4 Kleidung von Randgruppen am Beispiel der Juden und Prostituierten
- 2.5 Durchführbarkeit von Kleiderordnungen
- 3. Abschlussbetrachtung: Machen Kleider Leute?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Kleiderordnungen im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit. Sie untersucht die Funktion von Kleidung als Mittel der sozialen Abgrenzung und der staatlichen Einflussnahme. Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel von Kleiderordnungen und deren Bedeutung im Kontext von gesellschaftlichen Veränderungen und sozialen Normen.
- Die Rolle von Kleiderordnungen in der Sozialdisziplinierung
- Der Einfluss von Kleiderordnungen auf die Entwicklung der Mode
- Die Bedeutung von Kleidung als Statussymbol und Ausdruck sozialer Zugehörigkeit
- Die Durchsetzung von Kleiderordnungen und deren Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen
- Der Zusammenhang zwischen Kleiderordnungen und anderen Formen der staatlichen Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert die Bedeutung von Kleidung im historischen Kontext und setzt die Kleiderordnungen im Rahmen des Wandels von gesellschaftlichen Normen und Strukturen. Sie stellt die These auf, dass Kleidung im Laufe der Geschichte zunehmend zu einem Ausdruck von sozialem Status wurde.
- Kapitel 1 untersucht die städtische Gesellschaft des Spätmittelalters und beschreibt die Rolle von Kleidung als Mittel zur Abgrenzung zwischen verschiedenen sozialen Schichten. Es wird gezeigt, wie Kleiderordnungen dazu beitrugen, die soziale Ordnung zu stabilisieren.
- Kapitel 2 behandelt Kleiderordnungen im Detail. Es wird die Funktion von Kleiderordnungen als Mittel der Sozialdisziplinierung und der staatlichen Einflussnahme erläutert. Zudem werden die Unterschiede in Kleiderordnungen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kleiderordnungen, Sozialdisziplinierung, Mode, Ständegesellschaft, Bürgertum, Spätmittelalter, Frühe Neuzeit, Statussymbol, soziale Abgrenzung, staatliche Ordnung, Polizeiordnungen, Volkskultur, Kulturgeschichte.
- Quote paper
- Janina Bolz (Author), 2009, Machen Kleider Leute? Kleiderordnungen im Spätmittelalter und deren Veränderung in der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188077