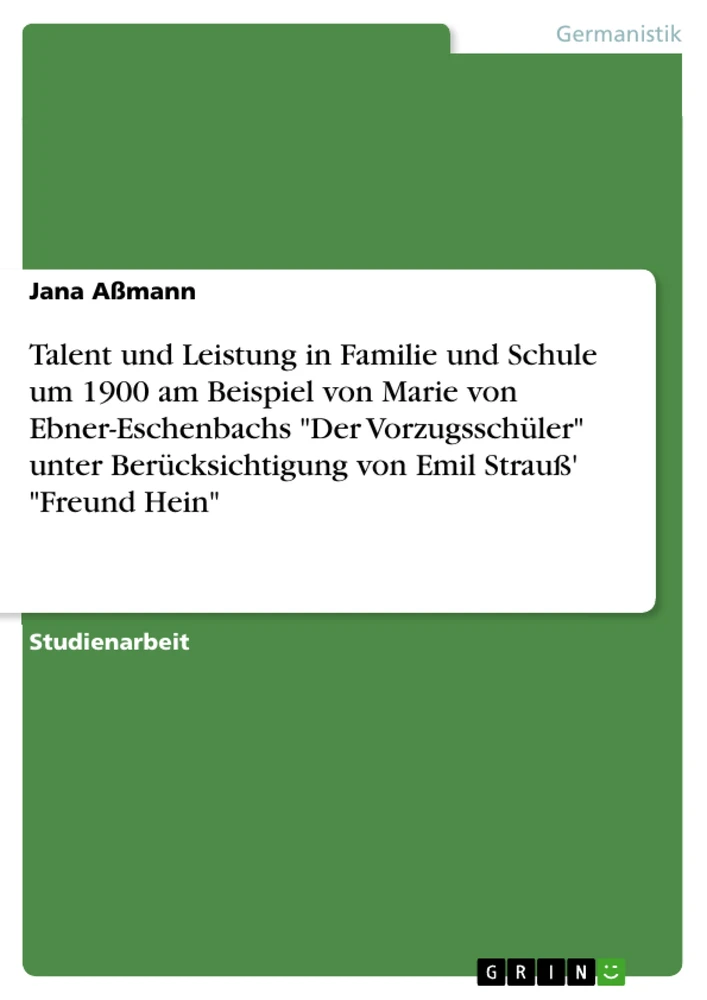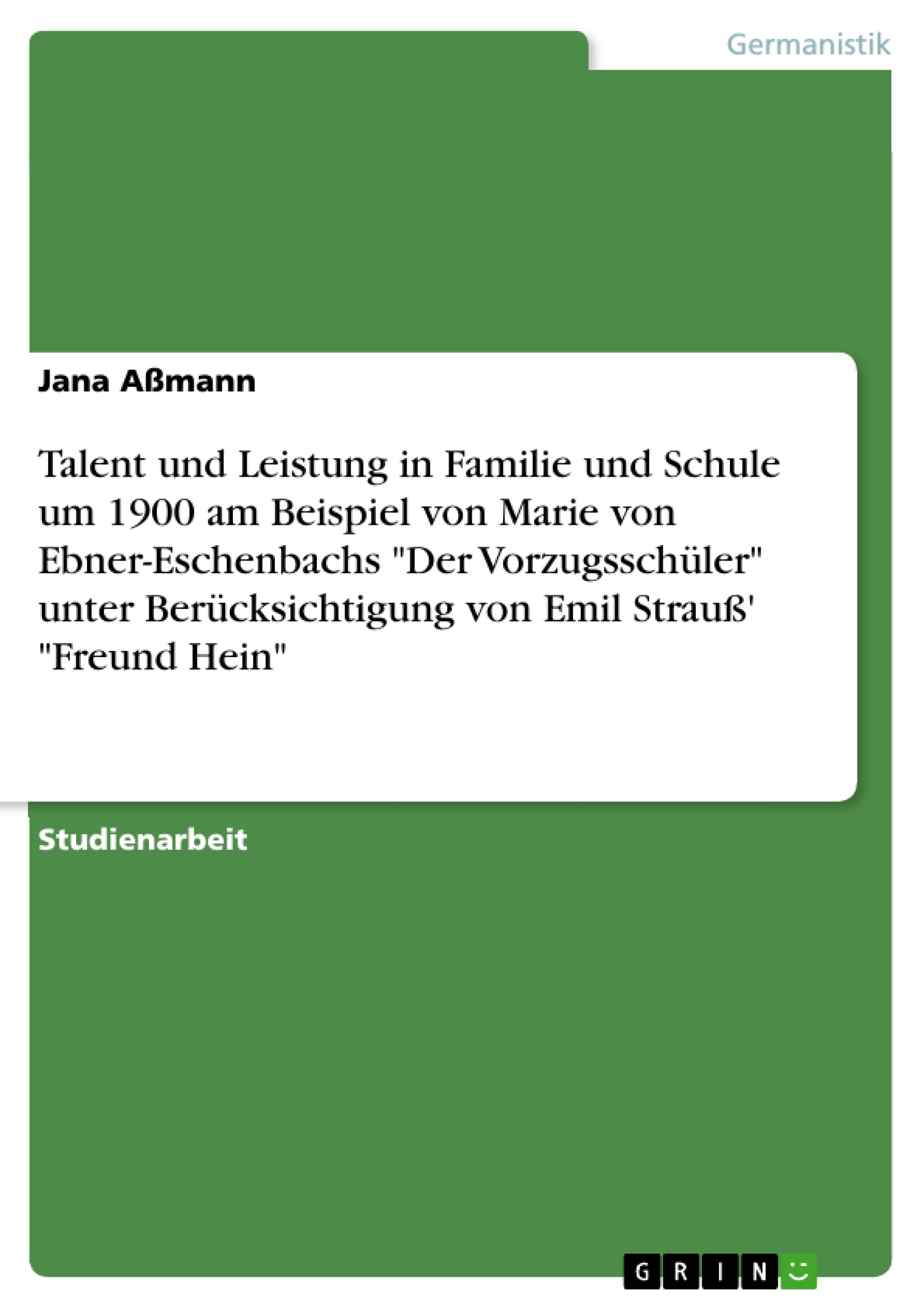Das ausgehende 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts kennzeichnet das Bestreben der Pädagogik, die dem Kind eigenen Wesenszüge bei der Erziehung in den Vordergrund zu stellen. Galten Kinder vordem als „kleine Erwachsene“, wird nun die Kindheit als eigenständiger Lebensabschnitt anerkannt.
Die in der vorliegenden Arbeit behandelten Werke, Marie von Ebner-Eschenbachs „Vorzugsschüler“ und Emil Strauß’ „Freund Hein“ befassen sich mit eben dieser Entwicklungsphase, in der sich der individuelle Charakter des Kindes auszubilden beginnt und mit ihm auch Interessen, Fähigkeiten und Talente. Um Letztere soll es in dieser Arbeit gehen. Dabei wird in Augenschein genommen, wie das Talent präsentiert wird, welche Entwicklung es erfährt und wie auf die Begabung reagiert wird. Die Familie des Kindes sowie die Gesellschaft, mit der es spätestens in der Schule konfrontiert wird, sorgen hierbei für Konfliktpotential: Die Frage nach dem, was für das Kind wichtig ist, wird sowohl von den Erziehungsmaximen der Väter als auch von den Anforderungen der Leistungsgesellschaft bestimmt – der Wunsch des Kindes nach freier Entfaltung muss zwischen diesen beiden Polen zwangsläufig auf Probleme treffen. Nach einer Übersicht über die Bedeutung der zentralen Begriffe ‚Talent’, ‚Begabung’ und ‚Fleiß’ sowie über das Verhältnis von schulischer und familiärer Autorität zum Talent analysiert die vorliegende Arbeit diese Problematik anhand des Gegensatzes zwischen musikalischem Talent und schulischen Anforderungen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. „Talent“, „Begabung“, „Leistung“: Definitionen der Schlüsselbegriffe
- 2. Autorität und Begabung
- 3. Marie von Ebner-Eschenbach: „Der Vorzugsschüler“ (1901)
- 3.1 Die Beziehung zwischen Vater und Sohn
- 3.2 Die Darstellung der Schule
- 3.3 Das Verhältnis von Talent und Fleiß sowie Künstler- und Beamtentum
- 4. Emil Strauß: „Freund Hein“ (1902) – Ein Vergleich
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Talent und Leistung in der Familie und Schule um 1900 anhand der Werke „Der Vorzugsschüler“ von Marie von Ebner-Eschenbach und „Freund Hein“ von Emil Strauß. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Talent, seiner Entwicklung und den Reaktionen auf Begabung in der Kindheits- und Jugendphase. Die Arbeit betrachtet die Konflikte, die entstehen, wenn das individuelle Talent des Kindes mit den Erwartungen der Familie und der Leistungsgesellschaft kollidiert.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Talent“
- Das Verhältnis von Autorität und Begabung in Familie und Schule
- Die Darstellung des Verhältnisses von Talent und Fleiß in den Werken
- Der Konflikt zwischen künstlerischem Talent und schulischen Anforderungen
- Die Rolle der Gesellschaft und ihrer Erwartungshaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Arbeit vor und erklärt die Relevanz der gewählten Werke. Sie skizziert die zentrale Problematik des Verhältnisses von Talent und Leistung in Familie und Schule. Kapitel 1 befasst sich mit der Definition der Schlüsselbegriffe „Talent“, „Begabung“ und „Leistung“ und untersucht deren Bedeutung im Kontext der Zeit. In Kapitel 2 wird das Verhältnis von Autorität und Begabung in Familie und Schule analysiert. Kapitel 3 beleuchtet „Der Vorzugsschüler“ von Marie von Ebner-Eschenbach und analysiert die Darstellung der Beziehung zwischen Vater und Sohn, die Rolle der Schule und die Verbindung von Talent, Fleiß und Berufswahl. Kapitel 4 setzt „Freund Hein“ von Emil Strauß in Bezug zu „Der Vorzugsschüler“ und vergleicht die beiden Werke in Bezug auf die Themen Talent und Leistung.
Schlüsselwörter
Talent, Begabung, Leistung, Autorität, Familie, Schule, Künstler- und Beamtentum, „Der Vorzugsschüler“, „Freund Hein“, Marie von Ebner-Eschenbach, Emil Strauß, 19. Jahrhundert, Pädagogik, Entwicklungspsychologie
- Quote paper
- Jana Aßmann (Author), 2010, Talent und Leistung in Familie und Schule um 1900 am Beispiel von Marie von Ebner-Eschenbachs "Der Vorzugsschüler" unter Berücksichtigung von Emil Strauß' "Freund Hein", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187883