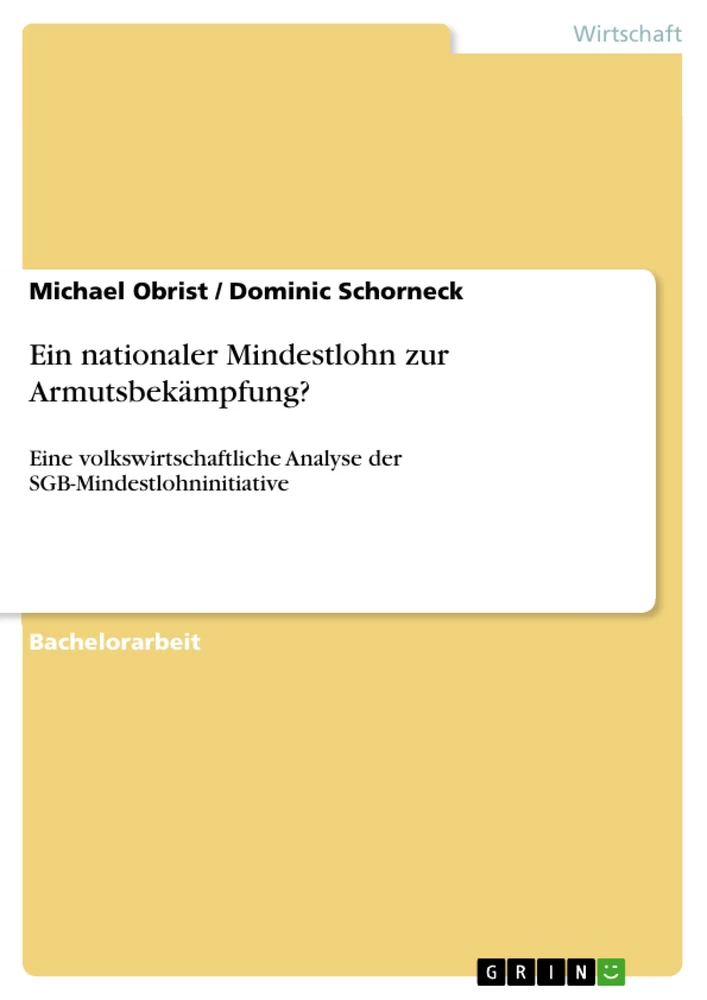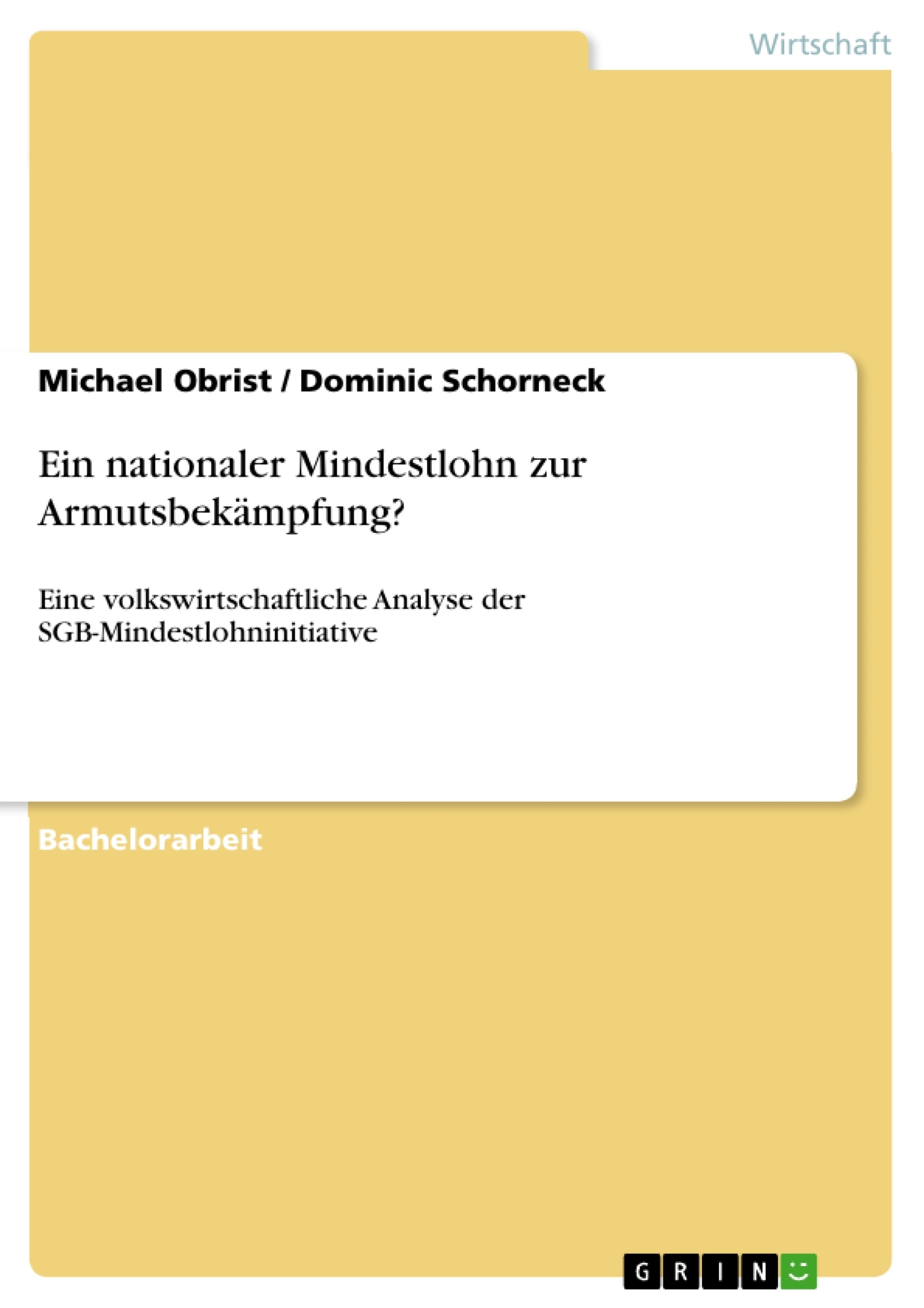** BEISPIEL***
6.1 Beschäftigungseffekte
6.1.1 Diskussionsverlauf und wegweisende Studien
Beschäftigungseffekte gehören in der Debatte um das Für und Wider von Mindestlöhnen mit Sicherheit zu den strittigsten Diskussionspunkten. Bis zum Anfang der 90er Jahre war man sich in ökonomischen Fachkreisen weitgehend einig, dass eine 10 Prozentige Erhöhung des Mindestlohns die Beschäftigung der Jugendlichen um ein- bis drei Prozent reduziert und die Beschäftigungswirkungen auf die Erwachsenen nicht signifikant sind.
Die beiden amerikanischen Ökonomen Card und Krueger veröffentlichten 1994 eine bis heute vielzitierte Fallstudie im Bereich der Fast-Food Industrie. Der Ausgangspunkt war eine Anhebung des Mindestlohns im Bundesstaat New Jersey im Jahr 1992 von 4.25 USD auf 5.05 USD. 45 Die beiden Ökonomen untersuchten in der Folge mittels eines natürlichen Experiments die Beschäftigungseffekte des erhöhten Mindestlohns auf die 410 betroffenen Restaurants. Die Beschäftigungsentwicklung wurde mit zwei Kontrollgruppen verglichen: Restaurants in New Jersey, die nicht von der Mindestlohnerhöhung betroffen waren46 und die ebenfalls nicht betroffenen Fast-Food-Restaurants im benachbarten Bundesstaat Pennsylvania. Die empirische Studie kam zu einem überraschenden Ergebnis: Während die Beschäftigung in den vom Mindestlohn betroffenen Restaurants in New Jersey anstieg, hatten die beiden Kontrollgruppen negative Beschäftigungseffekte zu verzeichnen. Die Schlussfolgerung lautete folglich, dass „we find no evidence that the rise in New Jerseys’s minimum wage reduced employment at fast-food restaurants in the state“ (vgl. Card et. al. 1994, S 792).
Eine weitere einflussreiche Studie ist die Untersuchung der OECD (1998a) bezüglich den Beschäftigungseffekten von Mindestlöhnen in neun OECD-Ländern49 zwischen 1975 und 1996. Mittels einer gepoolten, länderübergreifenden Zeitreihenanalyse kamen die Autoren zum Schluss, dass eine Erhöhung der Mindestlöhne die Beschäftigung der Jugendlichen (15- 19 Jahre) leicht aber signifikant reduziere, während die Beschäftigung der jungen Erwachsenen (20-24 Jahre) und Erwachsenen (25-54 Jahre) nicht signifikant durch eine Erhöhung der Mindestlöhne betroffen ist. Ebenso stellten die Autoren fest, dass es kaum Hinweise gibt, dass negative Beschäftigungseffekte in Ländern mit höheren Mindestlöhnen grösser sind, als in Ländern mit tieferen Mindestlohnlevels.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Themenwahl, Fragestellungen und Forschungsfrage
- 2. Armut und Working Poor
- 2.1 Definitionen von Armut
- 2.2 Entstehung von Armut
- 2.2.1 Armut ohne Erwerbstätigkeit
- 2.2.2 Working-Poor (Armut mit Erwerbstätigkeit)
- 3. Theorie zu Mindestlöhnen
- 3.1 Mindestlöhne und Grundbedarf
- 3.2 Die Geschichte von Mindestlöhnen
- 4. Mindestlöhne im Modell
- 4.1 Neoklassisches Arbeitsmarktmodell
- 4.2 Auswirkungen eines Mindestlohns im Modell
- 4.2.1 Komparativ-Statische Argumentation
- 4.2.2 Keynesianische Theorien
- 4.2.3 Monopsonfall
- 4.2.4 Effizienzlöhne
- 5. Schweizer Arbeitsmarkt
- 5.1 Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Schweiz
- 5.2 Gründe für die niedrige Arbeitslosigkeit in der Schweiz
- 5.2.1 Rolle der ausländischen Arbeitskräfte
- 5.2.2 Teilzeitarbeit
- 5.2.3 Niedrige Besteuerung
- 5.2.4 Gutes Bildungsniveau
- 5.3 Tieflohnbranchen in der Schweiz
- 6. Empirische Studien über die Wirkungen der Mindestlöhne
- 6.1 Beschäftigungseffekte
- 6.1.1 Diskussionsverlauf und wegweisende Studien
- 6.2 Empirische Ergebnisse zu Beschäftigungseffekten
- 6.2.1 USA
- 6.2.2 Grossbritannien
- 6.2.3 Frankreich
- 6.2.4 Vergleichende Länderpanel
- 6.2.5 Literaturüberblicke
- 6.2.6 Zwischenfazit: Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen
- 6.3 Lohn- und Einkommenseffekte der Mindestlöhne
- 6.3.1 Lohneffekte
- 6.3.2 Einfluss auf die Armut und die Einkommensverteilung
- 6.4 Fazit: Lohn und Einkommenseffekte von Mindestlöhnen
- 6.5 Unternehmensmargen
- 6.1 Beschäftigungseffekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Mindestlohninitiative, wie sie in der Schweiz diskutiert wird, mit dem Fokus auf deren Potential zur Armutsbekämpfung. Die Arbeit untersucht theoretische Modelle und empirische Befunde zu Mindestlöhnen, um die möglichen Folgen für Beschäftigung, Löhne und Einkommensverteilung zu bewerten.
- Auswirkungen eines nationalen Mindestlohns auf die Armut
- Theoretische Modelle und empirische Evidenz zu Mindestlöhnen
- Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen
- Einfluss von Mindestlöhnen auf Löhne und Einkommensverteilung
- Analyse der Schweizerischen Situation im Kontext der Mindestlohn-Debatte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Themenwahl, Fragestellungen und Forschungsfrage: Dieses Kapitel führt in die Thematik des nationalen Mindestlohns ein und erläutert den Hintergrund der Arbeit im Kontext der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Debatten in der Schweiz. Es beleuchtet die gegensätzlichen Positionen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden bezüglich der Einführung eines Mindestlohns und formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit.
2. Armut und Working Poor: Dieses Kapitel definiert Armut und den Begriff "Working Poor" und analysiert die Ursachen von Armut, sowohl im Kontext von Erwerbslosigkeit als auch von Erwerbstätigkeit mit niedrigem Einkommen. Es legt die Grundlage für die spätere Untersuchung der Wirksamkeit eines Mindestlohns als Instrument der Armutsbekämpfung.
3. Theorie zu Mindestlöhnen: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen der Mindestlohn-Debatte. Es untersucht den Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen und dem Grundbedarf, sowie die historische Entwicklung von Mindestlöhnen in verschiedenen Ländern. Es dient als Basis für das Verständnis der komplexen wirtschaftlichen Mechanismen, die durch die Einführung eines Mindestlohns beeinflusst werden.
4. Mindestlöhne im Modell: Dieses Kapitel modelliert die Auswirkungen eines Mindestlohns unter verschiedenen Annahmen. Es analysiert das neoklassische Arbeitsmarktmodell und berücksichtigt keynesianische Theorien sowie den Monopsonfall und Effizienzlöhne. Diese Modellierungen helfen, die möglichen Auswirkungen auf Beschäftigung und Löhne vorherzusagen.
5. Schweizer Arbeitsmarkt: Das Kapitel beschreibt den Schweizer Arbeitsmarkt, einschließlich der Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Gründe für die vergleichsweise niedrige Arbeitslosenquote. Es analysiert die Rolle ausländischer Arbeitskräfte, die Bedeutung der Teilzeitarbeit, die niedrige Besteuerung und das gute Bildungsniveau. Außerdem werden Tieflohnbranchen in der Schweiz untersucht, um den Kontext für die Mindestlohn-Debatte zu schaffen.
6. Empirische Studien über die Wirkungen der Mindestlöhne: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse empirischer Studien zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen auf Beschäftigung, Löhne und Einkommen. Es analysiert Studien aus verschiedenen Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich) und fasst die Ergebnisse zusammen, um ein umfassendes Bild der empirischen Evidenz zu schaffen.
Schlüsselwörter
Mindestlohn, Armut, Working Poor, Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Löhne, Einkommensverteilung, Schweiz, Empirische Studien, Volkswirtschaftliche Analyse, SGB-Mindestlohninitiative.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Mindestlohninitiative in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Mindestlohninitiative in der Schweiz und konzentriert sich dabei auf deren Potenzial zur Armutsbekämpfung. Sie untersucht sowohl theoretische Modelle als auch empirische Befunde zu Mindestlöhnen, um die möglichen Folgen für Beschäftigung, Löhne und Einkommensverteilung zu bewerten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Auswirkungen eines nationalen Mindestlohns auf die Armut, theoretische Modelle und empirische Evidenz zu Mindestlöhnen, Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen, Einfluss von Mindestlöhnen auf Löhne und Einkommensverteilung sowie eine Analyse der Schweizer Situation im Kontext der Mindestlohn-Debatte. Dabei werden verschiedene Aspekte der Armut (inkl. Working Poor), Mindestlohn-Theorien, das neoklassische Arbeitsmarktmodell, keynesianische Theorien, der Monopsonfall, Effizienzlöhne und empirische Studien aus verschiedenen Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich) betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Kapitel 1 führt in die Thematik ein und formuliert die Forschungsfrage. Kapitel 2 definiert Armut und den Working Poor und analysiert deren Ursachen. Kapitel 3 präsentiert die theoretischen Grundlagen der Mindestlohn-Debatte. Kapitel 4 modelliert die Auswirkungen eines Mindestlohns unter verschiedenen Annahmen. Kapitel 5 beschreibt den Schweizer Arbeitsmarkt. Kapitel 6 präsentiert und analysiert Ergebnisse empirischer Studien zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen auf Beschäftigung, Löhne und Einkommen.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit verwendet das neoklassische Arbeitsmarktmodell und berücksichtigt keynesianische Theorien, den Monopsonfall und Effizienzlöhne, um die Auswirkungen eines Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt zu modellieren.
Welche empirischen Studien werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht empirische Studien aus verschiedenen Ländern ein, darunter die USA, Großbritannien und Frankreich. Ein Vergleichender Länderpanel und Literaturüberblicke werden ebenfalls berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der empirischen Evidenz zu schaffen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse der theoretischen Modellierungen und empirischen Studien zusammen, um die möglichen Auswirkungen eines Mindestlohns auf Beschäftigung, Löhne und Einkommensverteilung in der Schweiz zu bewerten und deren Potenzial zur Armutsbekämpfung zu untersuchen. Ein Fazit zu den Lohn- und Einkommenseffekten von Mindestlöhnen wird explizit gezogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mindestlohn, Armut, Working Poor, Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Löhne, Einkommensverteilung, Schweiz, Empirische Studien, Volkswirtschaftliche Analyse, SGB-Mindestlohninitiative.
- Citar trabajo
- Michael Obrist (Autor), Dominic Schorneck (Autor), 2011, Ein nationaler Mindestlohn zur Armutsbekämpfung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187876