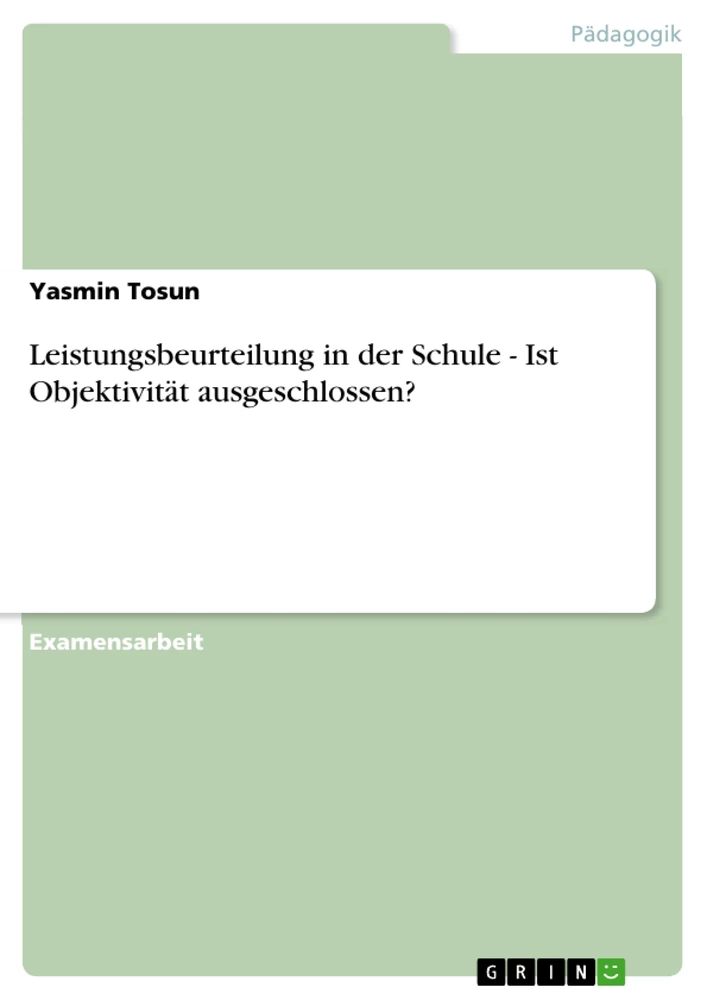Der Begriff Leistung ist uns im Alltag gegenwärtig. Doch was genau ist Leistung, wie und vor allem wie genau kann man sie messen? Spiegeln Zensuren wirklich immer die Leistung des Schülers wider, oder unterlaufen auch Lehrern bei ihren Beurteilungen im Schulalltag Fehler?
Im Schulsystem begegnet man immer häufiger dem Begriff Leistungsschule. Doch ist dieser Ausdruck in Zusammenhang mit pädagogischen Zielen überhaupt in Einklang zu bringen? Furck (1975) meinte, dass ‚Leistung‘ kein pädagogischer Begriff im eigentlichen Sinne ist, weil er nicht von der Person des Heranwachsenden, sondern von den Forderungen des Staates, der Gesellschaft, der Kultur usf. bestimmt wird.1
Hauptsächlich sollten nicht die Forderungen der Gesellschaft, sondern die Fördermöglichkeiten eines Jeden im Vordergrund stehen.
Die Beurteilung der Leistung in Form von Zensuren ist aus dem heutigen Schulalltag kaum noch wegzudenken. Gerade deshalb ist es wichtig zu erforschen, ob sie gerechtfertigt sind. Die diagnostische Kompetenz der Lehrer spiegelt sich nicht nur in der Qualität der Notengebung wider, sie schlägt sich auch im objektiven Schulerfolg nieder. Nicht selten bestimmen die Noten unseren zukünftigen Lebensweg. Sie beeinflussen unser Leben enorm, indem sie darüber entscheiden, auf welche Schule wir empfohlen werden und ob wir später studieren werden – ja sogar welchen Beruf wir ergreifen werden. Da so viele Entscheidungen unseres Lebens mit der Leistungsbeurteilung in der Schule zusammenhängen, sollte eine Objektivität bei der Bewertung gewährleistet werden. Dass dieses zu hundert Prozent kaum möglich ist, kann man sich denken, jedoch sollte man darauf achten, dass das Urteil weitestgehend frei von sachfremden und subjektiven Einflüssen ist.
Auch spätere pädagogische Maßnahmen sind von der Leistungsbeurteilung
abhängig, weshalb eine sorgfältige Diagnose von Nöten ist.
Wenn subjektive Einstellungen der Examinatoren das Ergebnis eines Beurteilungsverfahrens nicht beeinflussen können, dann nennt man es objektiv.2
Objektiv heißt also nicht, ob das Urteil gerecht ist, oder nicht. Es bedeutet lediglich, dass verschiedene Beurteiler beim Prüfen auf nahezu dasselbe Ergebnis kommen würden.
Diese Arbeit wird sich der Leistungsbeurteilung widmen, ihrer Messung und den damit verbundenen Konsequenzen für jedes Individuum und die Gesellschaft. Es soll erforscht werden, welche Eigenschaften uns bei der Diagnose von Leistung beeinflussen und wie man sie ggfs. vorbeugen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Funktionen der Leistungsbeurteilung
- 2.1 Selektionsfunktion
- 2.2 Berichts- und Kontrollfunktion
- 2.3 Pädagogische Funktion
- 3. Gütekriterien der Leistungsbeurteilung
- 4. Probleme bei der Leistungsbeurteilung
- 4.1 Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung
- 4.1.1 Soziale Bezugsnorm
- 4.1.2 Individuelle Bezugsnorm
- 4.1.3 Sachliche Bezugsnorm
- 4.2 Verzerrungen der Leistungsbeurteilung
- 4.2.1 Urteilsheuristiken
- 4.2.1.1 Verfügbarkeitsheuristik
- 4.2.1.2 Repräsentativitätsheuristik
- Vernachlässigung von Basisraten
- Missachtung des Extensionalitätsprinzips
- Fehlwahrnehmung von Zufälligkeit
- 4.3 Ankereffekt
- 4.3.1 Wie kommt der Ankereffekt zustande?
- 4.3.1.1 Selektive Zugänglichkeit
- 4.3.1.2 Verankerung und Anpassung
- 4.4 Pygmalion-Effekt
- 4.2.1 Urteilsheuristiken
- 4.1 Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung
- 5. Alternative Form der Leistungsbeurteilung
- 5.1 Das Portfolio
- 5.1.1 Was ist ein Portfolio oder was verstehen wir unter einem Portfolio
- 5.1.2 Die Anwendung des Portfolios in der Grundschule
- 5.1.3 Vorarbeit und Implementierung
- 5.1.4 Beispiele für die Unterrichtsarbeit
- 5.1.5 Instrumente, die den Lernprozess begleiten
- 5.1.6 Schlussfolgerungen für die Grundschule
- 5.1 Das Portfolio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Objektivität in der Leistungsbeurteilung in der Schule überhaupt erreichbar ist. Sie untersucht die Funktionen der Leistungsbeurteilung, die Gütekriterien, die Probleme, die bei der Beurteilung auftreten können, und alternative Formen der Bewertung.
- Funktionen der Leistungsbeurteilung
- Gütekriterien der Leistungsbeurteilung
- Probleme der Leistungsbeurteilung, wie Bezugsnormen, Verzerrungen und der Pygmalion-Effekt
- Alternative Formen der Leistungsbeurteilung, insbesondere das Portfolio
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt den Leser in das Thema der Leistungsbeurteilung ein und beleuchtet die Relevanz der Frage nach der Objektivität in der schulischen Leistungsbewertung. Sie stellt die Frage, ob Zensuren die tatsächliche Leistung des Schülers widerspiegeln und ob Lehrern bei der Beurteilung Fehler unterlaufen.
- Kapitel 2: Funktionen der Leistungsbeurteilung
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Funktionen der Leistungsbeurteilung, wie z.B. die Selektionsfunktion, die Berichts- und Kontrollfunktion sowie die pädagogische Funktion.
- Kapitel 3: Gütekriterien der Leistungsbeurteilung
Dieses Kapitel behandelt die Gütekriterien der Leistungsbeurteilung, wie z.B. Objektivität, Reliabilität und Validität.
- Kapitel 4: Probleme bei der Leistungsbeurteilung
In diesem Kapitel werden verschiedene Probleme der Leistungsbeurteilung beleuchtet. Es wird auf Bezugsnormen, Verzerrungen, wie z.B. Urteilsheuristiken und den Ankereffekt, sowie auf den Pygmalion-Effekt eingegangen.
- Kapitel 5: Alternative Form der Leistungsbeurteilung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit alternativen Formen der Leistungsbeurteilung. Es werden die Vorteile des Portfolios als Bewertungsinstrument erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den folgenden zentralen Themen und Konzepten: Leistungsbeurteilung, Objektivität, Gütekriterien, Bezugsnormen, Urteilsheuristiken, Ankereffekt, Pygmalion-Effekt, Portfolio.
Häufig gestellte Fragen
Kann schulische Leistungsbeurteilung jemals vollkommen objektiv sein?
Vollkommene Objektivität ist kaum möglich, da Lehrer subjektiven Einflüssen und Urteilsfehlern unterliegen. Ziel sollte jedoch ein Urteil sein, das weitestgehend frei von sachfremden Einflüssen ist.
Was ist der Pygmalion-Effekt in der Schule?
Er beschreibt das Phänomen, dass die (positive oder negative) Erwartung eines Lehrers gegenüber einem Schüler dessen tatsächliche Leistung langfristig beeinflusst.
Welche Bezugsnormen gibt es bei der Notengebung?
Man unterscheidet die soziale Bezugsnorm (Vergleich mit der Klasse), die individuelle Bezugsnorm (Vergleich mit früheren Leistungen des Schülers) und die sachliche Bezugsnorm (Vergleich mit Lernzielen).
Was ist der Ankereffekt bei der Korrektur?
Der Ankereffekt tritt auf, wenn sich ein Korrektor von einer ersten Information (z.B. einer sehr guten ersten Seite oder dem Vorwissen über den Schüler) unbewusst bei der weiteren Bewertung leiten lässt.
Bieten Portfolios eine gerechtere Leistungsbewertung?
Portfolios ermöglichen eine prozessorientierte Beurteilung, die individuelle Fortschritte besser sichtbar macht als eine punktuelle Klassenarbeit, erfordern aber klare Kriterien zur Bewertung.
- Quote paper
- Yasmin Tosun (Author), 2011, Leistungsbeurteilung in der Schule - Ist Objektivität ausgeschlossen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187866