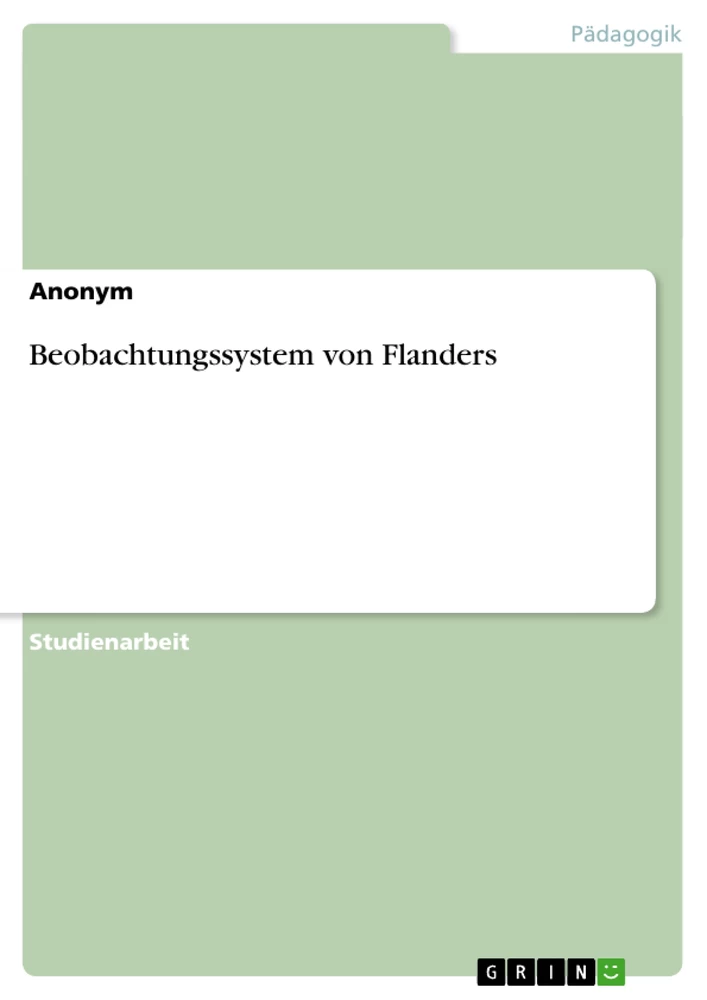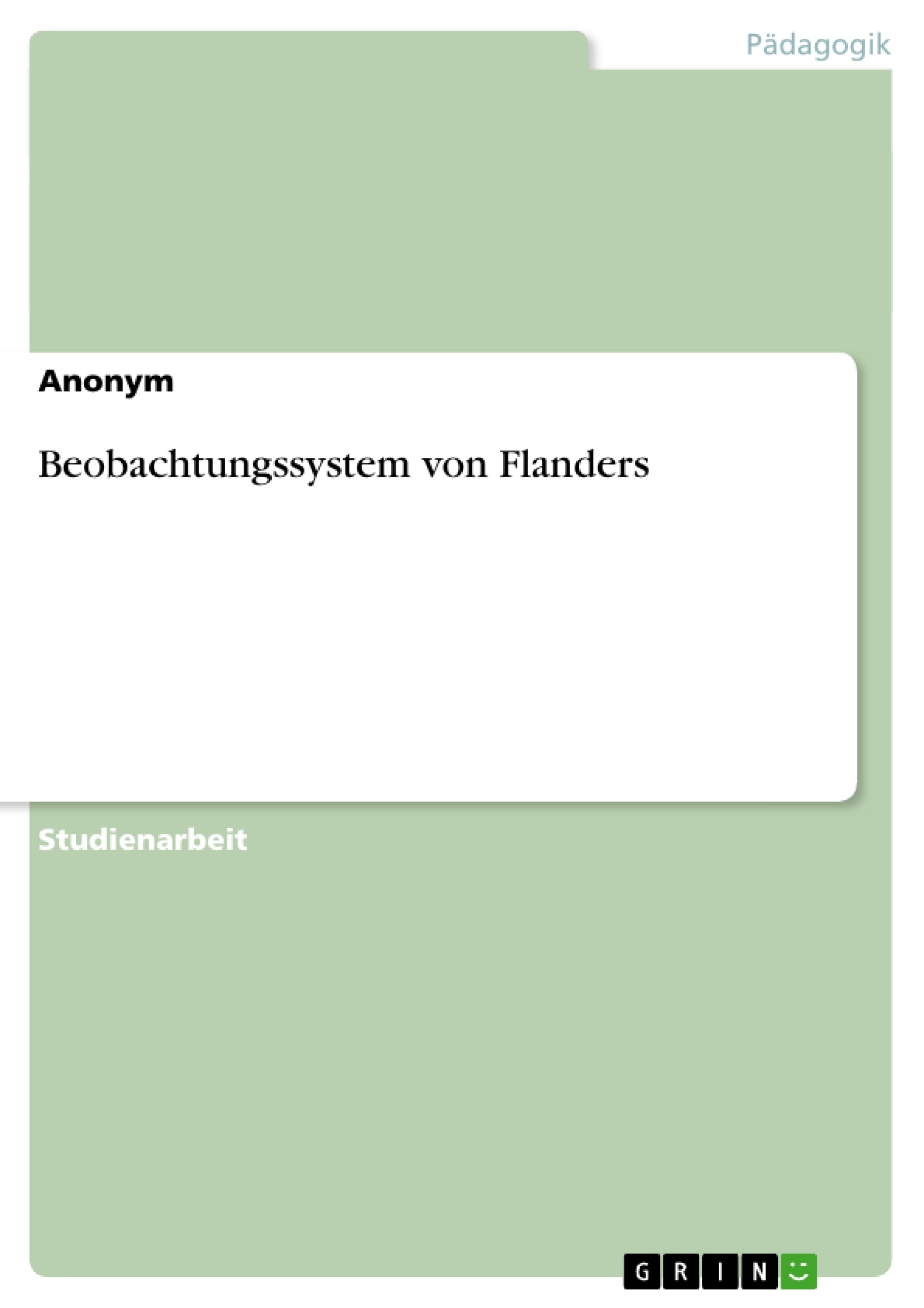„Teaching behavior, by its very nature, exists in a context of social interaction“ (Flanders, 1970, S. 1). Von sozialer Interaktion wird gemäß Definition immer dann gesprochen, wenn zwei oder mehr Individuen zueinander in Beziehung treten und kommunikative Handlungen austauschen (Wragge-Lange, 1980, S. 7). Im Schulunterricht nimmt die Sprache einen großen Teil dieser kommunikativen Handlungen ein (Spanhel 2001, S. 931). Sowohl für Referendare1, die am Anfang ihrer Schullaufbahn stehen, als auch für ihre erfahrenen Kollegen, ist es wichtig, den Einfluss ihres sprachlichen Verhaltens auf die Schulklasse zu kennen, um die Interaktion und die Lernprozesse im Unterricht zu optimieren. Auf Basis der sprachlichen Äußerungen von Lehrern und Schülern hat Ned A. Flanders daher das System FIAC (Flanders' Interaction Analysis Categories) zur Interaktionsanalyse im Unterricht entwickelt (Merkens & Seiler 1978, S. 79ff.), das es ermöglicht, „Lehrertraining kontrollierbar und damit optimal zu machen“ (Wragge-Lange, 1980, S. 38). Das ist ein hoher Anspruch und es entsteht die Frage, ob das System diesem Anspruch gerecht wird. Ziel der folgenden Arbeit ist es demnach herauszuarbeiten, welche Chancen und Möglichkeiten das Beobachtungssystem von Flanders in der Praxis der Lehreraus- und Weiterbildung bietet und anhand einer kritischen Betrachtung festzustellen, wo die Grenzen des Systems liegen. Es wird jedoch nicht Thema dieser Arbeit sein Verbesserungsvorschläge an der Interaktionsanalyse zu formulieren, sondern lediglich die Kritikpunkte aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Die Grundlagen von Flanders Interaktionsanalysesystem
- Allgemeines und Beschreibung der Kategorien
- Vorgehensweise bei der Beobachtung
- Auswertung und Interpretation der Interaktionsanalyse
- Darstellung und Auswertung der Datenmatrix
- Systematische Interpretation der Datenmatrix
- Kritische Betrachtung der Interaktionsanalyse von Flanders
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Unterrichtsbeobachtungssystem von Flanders, um dessen Chancen und Grenzen in der Lehreraus- und Weiterbildung aufzuzeigen. Dabei wird besonders auf die praktische Anwendung und die Kritikpunkte des Systems fokussiert.
- Beschreibung der zehn Beobachtungskategorien des FIAC-Systems
- Erläuterung der Vorgehensweise bei der Unterrichtsbeobachtung
- Darstellung und Interpretation der gewonnenen Daten
- Kritische Analyse des Systems hinsichtlich seiner Stärken und Schwächen
- Beurteilung der Anwendbarkeit des Systems in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Problemstellung beleuchtet die Bedeutung von Interaktion im Unterricht und stellt das FIAC-System von Flanders als ein Instrument zur Optimierung von Lehrerverhalten vor.
- Kapitel 2.1: Die zehn Kategorien des FIAC-Systems werden erläutert, wobei der Fokus auf die Unterscheidung zwischen direktem und indirektem Lehrerverhalten liegt.
- Kapitel 2.2: Die Vorgehensweise bei der Unterrichtsbeobachtung wird dargestellt, um dem Leser die Gewinnung der Daten für die Auswertung zu verdeutlichen.
- Kapitel 3.1: Die Verarbeitung und Auswertung der beobachteten Daten anhand einer Matrix wird beschrieben. Die Ergebnisse dieser Aufbereitung dienen als Grundlage für die Interpretation.
- Kapitel 3.2: Die systematische Interpretation der Datenmatrix anhand eines Beispiels wird illustriert, um die Vorgehensweise zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Unterrichtsbeobachtung, Interaktionsanalyse, Flanders' Interaction Analysis Categories (FIAC), Lehrerverhalten, Schülerverhalten, Direktes und Indirektes Verhalten, Datenmatrix, Interpretation, Kritikpunkte, Praxisanwendung, Lehreraus- und Weiterbildung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2009, Beobachtungssystem von Flanders, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187753