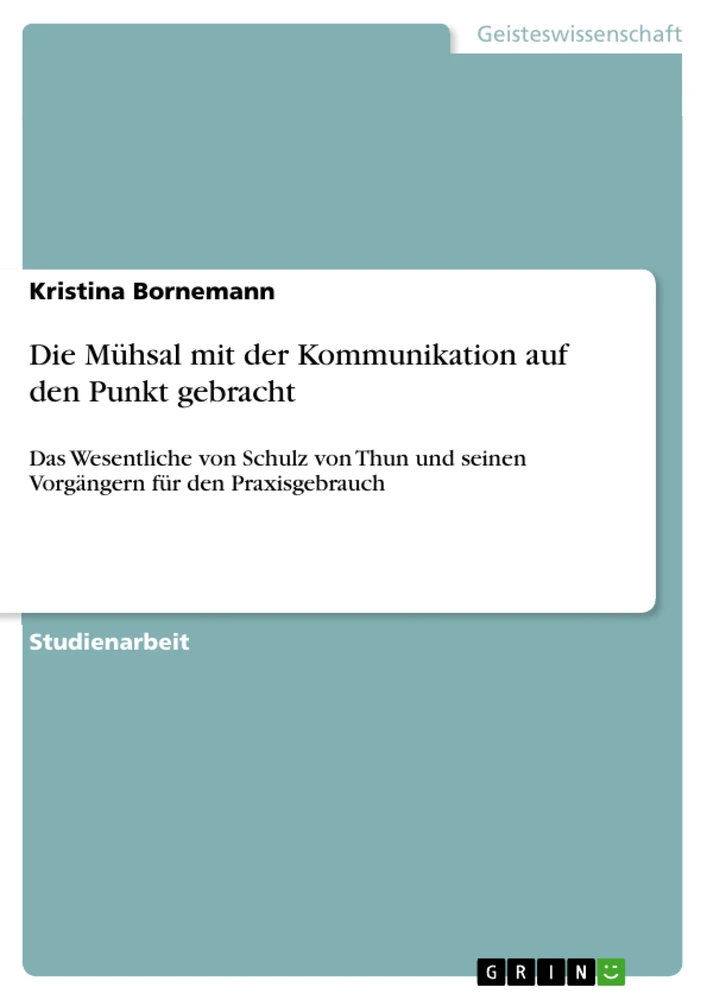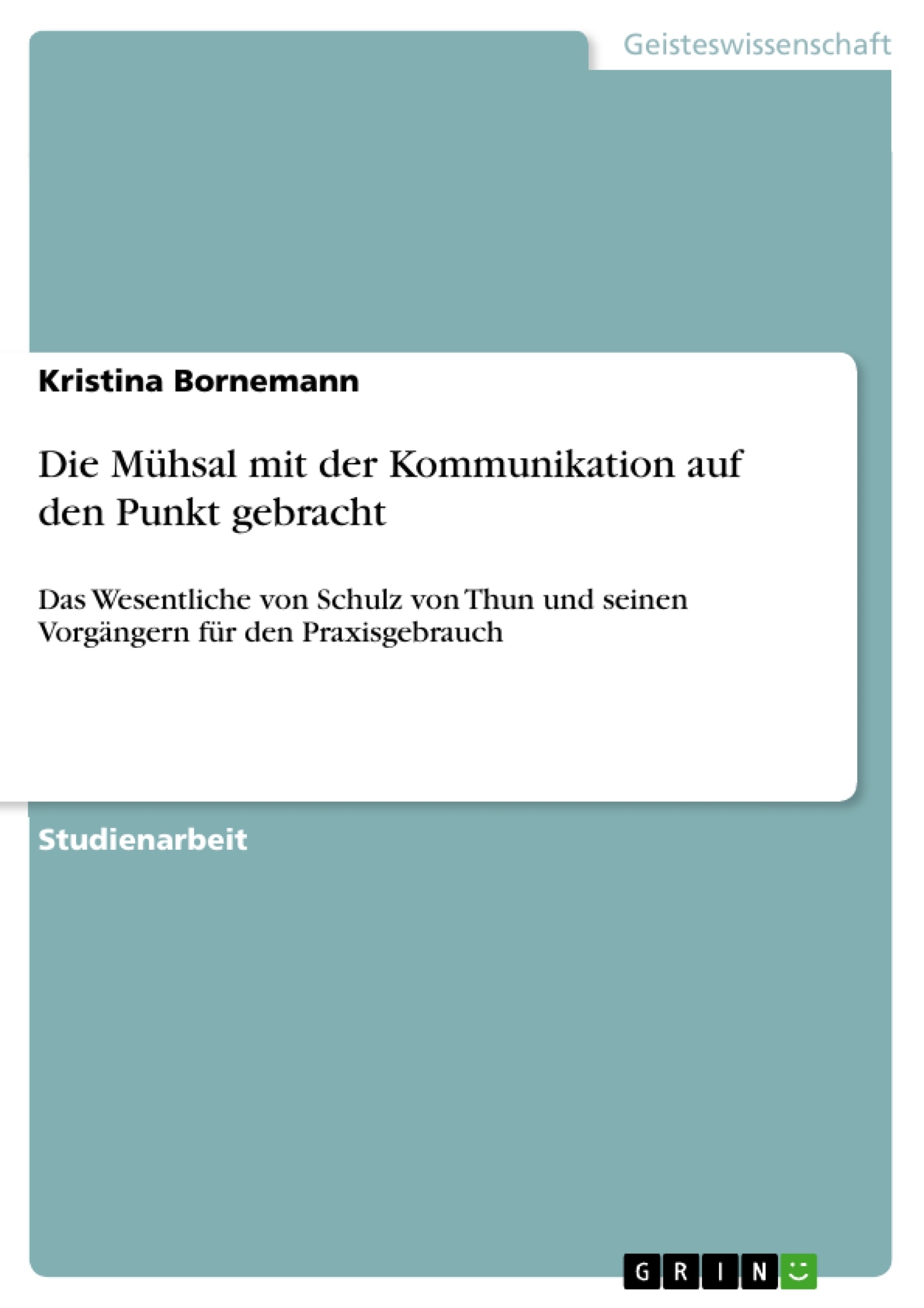Die Aufklärer des 17. und 18. Jahrhunderts glaubten, dass man nur alle Menschen aufklären müsse, um eine ideale Gesellschaft schaffen zu können. Diese „Vision“ der Aufklärung erwies sich viel komplizierter, als sie sich es vorstellen konnten. In einem Gespräch, 20 Jahre nach dem Erscheinen seines bekannt gewordenen Buches, zieht Schulz von Thun Bilanz. „Wir glaubten zu wissen, wie gute Kommunikation aussieht und wie man sie den Leuten beibringt. Aber wir waren auf dem Holzweg". (Schulz von Thun 2000, S. 8). Es hat sich gezeigt, dass man kein Ideal-Kommunikations-Verhalten lernen kann oder auch soll. „Kommunikation muss aus dem Holz sein, aus dem der Mensch geschnitzt ist." (Schulz von Thun 2000, S. 8). Und doch ist das Modell von Schulz von Thun ein wichtiger Beitrag zu Verbesserung unseres Kommunikationsverhaltens geworden, wenigstens für die, die dafür Zeit und Interesse aufwenden wollen. Es ist ein wichtiges Werkzeug und eine Hilfe im Umgang mit Mitmenschen, weil es nicht zu vereinfachend aber auch nicht so kompliziert ist, dass es für einen Laien nicht nachvollziehbar sein könnte. Die wichtigsten Vorteile dieses Modells kann man so zusammenfassen: Klarlegung und Bewusstmachung des Faktums, dass man mit einem „Sprechakt“ mehrere Botschaften aussendet; man soll sich am besten dessen bewusst sein, dass seine Nachricht „missverstanden“ werden kann, d.h. anders ankommen kann, als es gemeint war. Die Anzahl der Missverständnisse und Störungen kann mit Hilfe dieses Modells reduziert werden. Wenigstens ist ein recht praktisches Werkzeug da, der jedem die Möglichkeit gibt, die Entscheidung zu treffen, sich mit seinem eigenen Kommunikationsverhalten zu befassen, es besser zu verstehen und zu kontrollieren (z.B. wenigstens nicht zu viele Gedankenlosigkeiten von sich zu geben). Anfangen soll man bei sich selbst: „Man muss sich selbst erst kennen, um andere zu sehen und zu verstehen“.
Inhaltsverzeichnis
- Einstieg
- Einleitung
- Das Bühlersche Organon-Modell der Sprache
- Karl Bühler - ein kurzes Porträt
- Die Vorgänger - Platon, de Saussure, Wundt, Husserl
- „Dreifach ist die Leistung der menschlichen Sprache ...“ (Bühler 1978, S. 28) - Darstellung des Organon-Modells
- Darstellungsfunktion
- Appellfunktion
- Ausdrucksfunktion
- Kritik des Organon-Modells
- Das 2.e Axiom von Paul Watzlawick: Inhalts- und Beziehungsaspekt
- Das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun
- Schulz von Thun - kurze Vorstellung
- Darstellung des Kommunikationsmodells
- Grundlagen: Ableitungen, Begriffe, Definitionen
- Die vier Seiten der Nachricht
- Beispiel einer Nachricht-Analyse
- Der „vierohrige“ Empfänger
- Gesendete und empfangene Nachricht
- Kritik des Kommunikationsmodells von Schulz von Thuns
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit hat zum Ziel, das weit verbreitete Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun vorzustellen und im Kontext seiner historischen und theoretischen Vorgänger zu betrachten. Die Arbeit analysiert die zentralen Aspekte des Modells und setzt sie in Beziehung zu dem Bühlerschen Organon-Modell. Kritische Auseinandersetzungen mit beiden Modellen werden ebenfalls einbezogen.
- Das Bühlersche Organon-Modell der Sprache und seine Bedeutung für spätere Kommunikationsmodelle.
- Das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun: seine zentralen Elemente und Anwendungsbereiche.
- Vergleich und Kontrast zwischen dem Bühlerschen Modell und dem Modell von Schulz von Thun.
- Kritikpunkte und Limitationen beider Modelle.
- Die praktische Relevanz von Kommunikationsmodellen für die zwischenmenschliche Interaktion.
Zusammenfassung der Kapitel
Einstieg: Der Einstieg präsentiert zwei exemplarische Gesprächssituationen, die die Komplexität der menschlichen Kommunikation und die Notwendigkeit eines differenzierten Kommunikationsmodells veranschaulichen. Die Beispiele zeigen, wie leicht Missverständnisse entstehen können, wenn verschiedene Aspekte der Botschaft nicht berücksichtigt werden. Dies dient als anschauliche Einleitung in die Thematik der Arbeit.
Einleitung: Die Einleitung verortet die Bedeutung von Kommunikation im 20. und 21. Jahrhundert und hebt die Entstehung der Kommunikationswissenschaft und -psychologie hervor. Sie zeigt die Vielschichtigkeit des Begriffs „Kommunikation“ auf, der in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und Kontexten unterschiedlich verstanden wird. Die Einleitung betont die Bedeutung der aktiven und konstruktiven Rolle von Sender und Empfänger im Kommunikationsprozess und kündigt die Vorstellung der Kommunikationsmodelle von Bühler und Schulz von Thun an.
Das Bühlersche Organon-Modell der Sprache: Dieses Kapitel widmet sich dem Organon-Modell von Karl Bühler, einem grundlegenden Modell der Sprachtheorie. Es beschreibt die drei Funktionen der Sprache – Darstellungs-, Ausdrucks- und Appellfunktion – und erläutert ihre Bedeutung für das Verständnis von Kommunikation. Das Kapitel beleuchtet auch die historische Einordnung des Modells und seine Kritikpunkte, die als Ausgangspunkt für weiterführende Modelle wie das von Schulz von Thun dienten.
Das 2.e Axiom von Paul Watzlawick: Inhalts- und Beziehungsaspekt: Dieses Kapitel befasst sich mit dem zweiten Axiom von Paul Watzlawick, welches den Inhalts- und Beziehungsaspekt jeder Kommunikation herausstellt. Es wird erläutert, wie die Beziehungsseite die Interpretation der Inhaltsseite beeinflusst und wie Missverständnisse entstehen können, wenn die Beziehungsseite vernachlässigt wird. Dies bildet einen wichtigen Kontext für das Verständnis des Kommunikationsmodells von Schulz von Thun.
Das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun: Dieses Kapitel stellt das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun detailliert vor. Es erläutert die vier Seiten einer Nachricht – Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellaspekt – und demonstriert deren Interaktion anhand von Beispielen. Es wird der „vierohrige Empfänger“ eingeführt und die Bedeutung der unterschiedlichen Empfangsweisen für die erfolgreiche Kommunikation hervorgehoben. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Betrachtung des Modells.
Schlüsselwörter
Kommunikation, Kommunikationsmodell, Schulz von Thun, Bühler, Organon-Modell, Sprachtheorie, Inhaltsaspekt, Beziehungsaspekt, vier Seiten der Nachricht, Missverständnisse, Kommunikationspsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Kommunikationsmodelle von Bühler und Schulz von Thun
Was ist der Gegenstand der Studienarbeit?
Die Studienarbeit befasst sich mit dem Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun und setzt es in den Kontext seiner historischen und theoretischen Vorgänger, insbesondere des Bühlerschen Organon-Modells. Sie analysiert die zentralen Aspekte beider Modelle, vergleicht sie miteinander und kritisiert sie.
Welche Kommunikationsmodelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun mit dem Bühlerschen Organon-Modell der Sprache. Dabei wird der Fokus auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Modelle gelegt.
Was ist das Bühlersche Organon-Modell?
Das Bühlersche Organon-Modell beschreibt die drei Funktionen der Sprache: Darstellungsfunktion (Mitteilung von Sachverhalten), Ausdrucksfunktion (Ausdruck der Gefühle des Sprechers) und Appellfunktion (Aufforderung des Sprechers an den Hörer). Die Arbeit beleuchtet die historischen Wurzeln des Modells und seine Kritikpunkte.
Was sind die zentralen Aspekte des Kommunikationsmodells von Schulz von Thun?
Das Modell von Schulz von Thun beschreibt jede Nachricht als vierschichtig: Sach-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs- und Appellaspekt. Die Arbeit erläutert diese vier Seiten detailliert und zeigt, wie Missverständnisse entstehen können, wenn die verschiedenen Aspekte nicht berücksichtigt werden. Der "vierohrige Empfänger" wird ebenfalls erklärt.
Wie werden die beiden Modelle verglichen?
Die Arbeit vergleicht die beiden Modelle anhand ihrer jeweiligen Stärken und Schwächen, ihrer zentralen Konzepte und ihrer praktischen Relevanz für die zwischenmenschliche Kommunikation. Die historischen Zusammenhänge und Einflüsse werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kritikpunkte werden an den Modellen geübt?
Die Studienarbeit beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit beiden Modellen. Konkrete Kritikpunkte werden im Text dargelegt und diskutiert.
Welche Ziele verfolgt die Studienarbeit?
Die Studienarbeit zielt darauf ab, das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun verständlich darzustellen, seine theoretischen Grundlagen zu erläutern und es im Kontext des Bühlerschen Organon-Modells zu verorten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kritischen Reflexion beider Modelle und ihrer praktischen Relevanz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen Einstieg, eine Einleitung, ein Kapitel zum Bühlerschen Organon-Modell, ein Kapitel zum zweiten Axiom von Paul Watzlawick (Inhalts- und Beziehungsaspekt), ein Kapitel zum Kommunikationsmodell von Schulz von Thun und ein Schlusswort.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kommunikation, Kommunikationsmodell, Schulz von Thun, Bühler, Organon-Modell, Sprachtheorie, Inhaltsaspekt, Beziehungsaspekt, vier Seiten der Nachricht, Missverständnisse, Kommunikationspsychologie.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Kommunikationswissenschaft, Psychologie und verwandter Disziplinen, die sich mit Theorien und Modellen der menschlichen Kommunikation auseinandersetzen. Sie ist auch für alle interessant, die ihr Verständnis von Kommunikation vertiefen möchten.
- Quote paper
- Magister der Philologie (PL) Kristina Bornemann (Author), 2004, Die Mühsal mit der Kommunikation auf den Punkt gebracht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187727