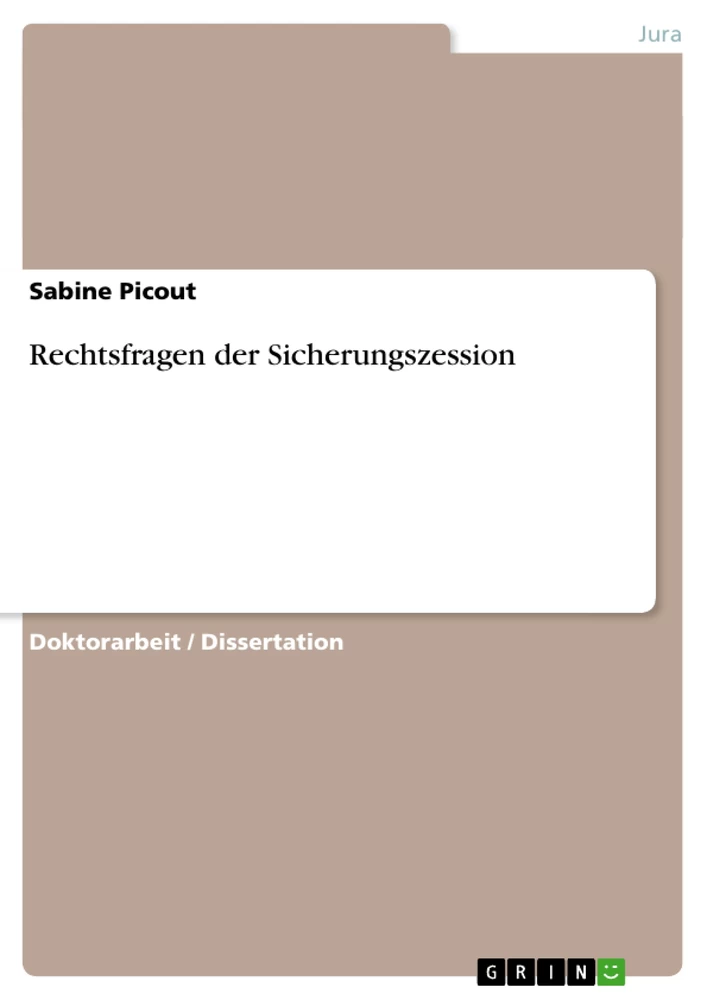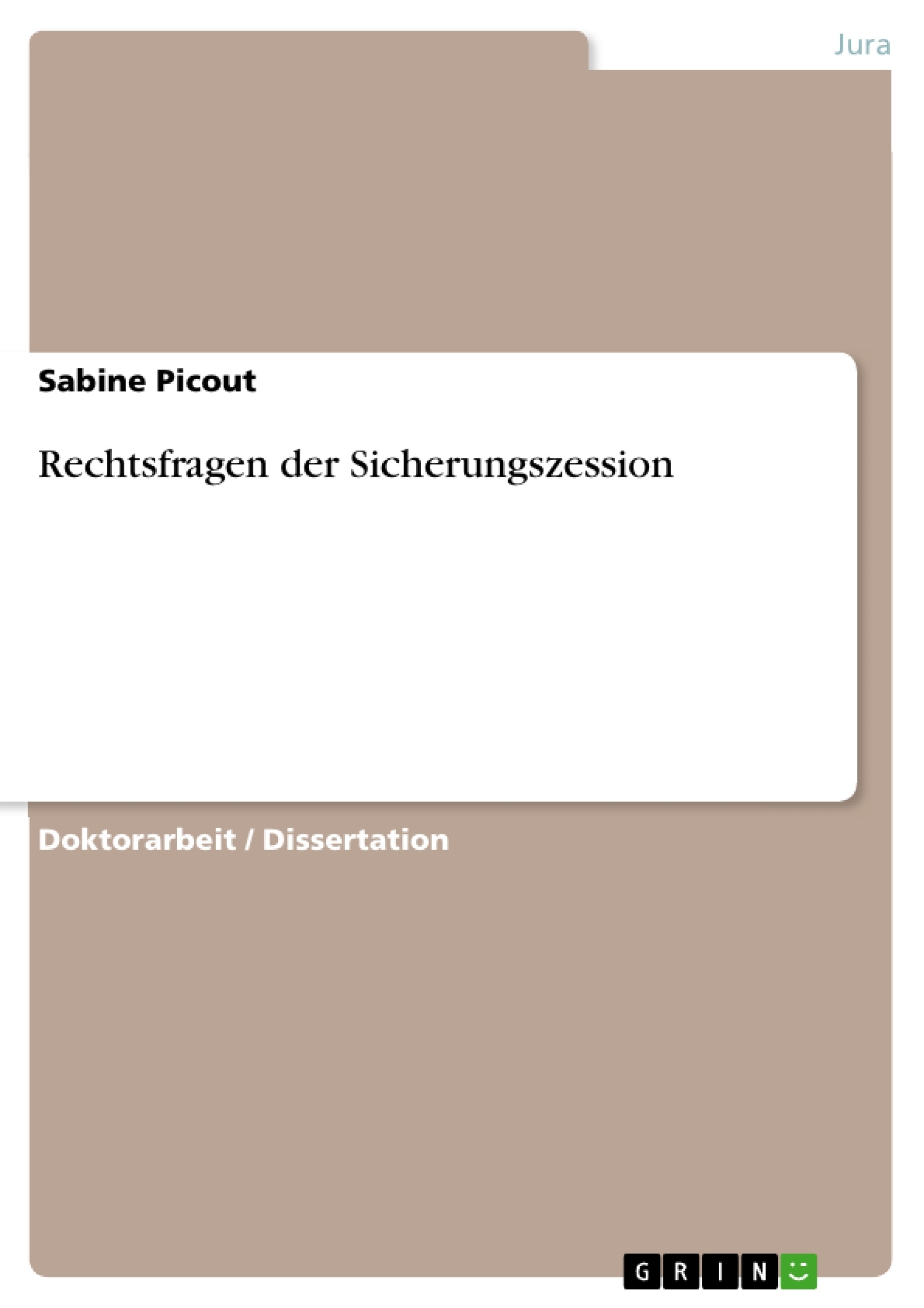Die Sicherungszession hat in ihrer Funktion als Kreditsicherungsmittel zur Beschaffung von Betriebsmitteln vor allem für mittelständische Unternehmen an Bedeutung zugenommen, denn Schätzungen zufolge gibt es über zehntausend (Global-) Zessionskredite österreichweit. Somit sind Rechtsfragen rund um die Sicherungszession nicht nur für Zessionsprüfer, Bankjuristen und Kreditinstitute, sondern insbesondere für zahlreiche Unternehmen von höchster Aktualität.
Als Gründe für die Beliebtheit dieses Kreditsicherungsmittels werden die zahlreichen Vorteile der Sicherungszession gegenüber anderen Sicherungsmitteln genannt: So ist die Befriedigung des Sicherungsgläubigers unkompliziert, denn es ist kein (oft so umständliches) gerichtliches Verwertungsverfahren nötig. Die Verwertung der Pfandsache muss gerichtlich geschehen, der Sicherungszessionar als Gläubiger der Forderung kann diese ohne gerichtliche Schritte einziehen. Ein weiterer, in der Praxis sehr gewichtiger Vorteil ist, dass die Verwertung sehr leise durchgeführt werden kann, ohne dass der abgetretene Schuldner die Vornahme einer solchen „stillen Zession“ überhaupt bemerkt, denn seine Zahlung erfolgt an eine Bank, wodurch kein Aufsehen erregt wird. Zudem können Unternehmen, seien sie auch noch so erfolgreich, den Banken oft nur ihre Kundenforderungen als Sicherheit anbieten, denn viele Unternehmen sind nicht Eigentümer ihrer Betriebsgebäude und können auch ihre Produktionsmaschinen, die oft geleast sind, nicht als Sicherungsmittel zur Verfügung stellen.
Trotz der praktischen Relevanz der Sicherungszession muss jedoch festgestellt werden, dass die Rechtsfragen rund um die Sicherungszession durch die Rechtsprechung und Lehre unzureichend beantwortet sind und noch eine Reihe von Unsicherheiten und Ri-siken bestehen bleiben.
In der Folge soll zuerst kurz auf die Arten der Zession eingegangen werden, da im Zuge der Behandlung der Sicherungszession immer wieder auf die gemeinsamen Strukturen zurückgegriffen wird. Dann wird auf die verschiedenen Formen der Zession und ihre Besonderheiten hingewiesen, was das Verständnis der Entscheidungen und der Lehre erleichtern soll.
Abschließend werden die Sicherungszession und die Globalzession ausführlicher behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arten der Zession
- 2.1 Die Einzelzession
- 2.1.1 Allgemeines
- 2.1.2 Die rechtsgeschäftliche (Einzel)Zession
- 2.2 Globalzession bzw. Generalzession
- 2.3 Mantelzession
- 2.1 Die Einzelzession
- 3. Sonderformen der Zession
- 3.1 Sicherungszession
- 3.2 Inkassozession
- 3.3 Factoring
- 3.4 Zession zahlungshalber
- 3.5 Stille Zession
- 4. Sicherungszession
- 4.1 Wesen der Sicherungszession
- 4.2 Treuhandverhältnis
- 4.3 Titel der Sicherungszession
- 4.4 Modus der Sicherungszession
- 4.4.1 Publizitätserfordernis
- 4.4.1.1 Verbriefte und nicht verbriefte Forderungen
- 4.4.1.2 Buchforderung und Nichtbuchforderung
- 4.4.1.2.1 Handelsrechtliche Abgrenzung
- 4.4.1.2.2 Abgabenrechtliche Abgrenzung
- 4.4.1.2.3 Abgrenzung anhand faktischer Buchführung
- 4.4.1.2.4 Lösung in der Praxis
- 4.4.2 Leichte und verlässliche Feststellbarkeit
- 4.4.3 Urkundliche Nachweisbarkeit
- 4.4.3.1 Schriftlichkeit der Abtretungsvereinbarung
- 4.4.3.2 Ausgestaltung des Publizitätsaktes
- 4.4.4 Drittschuldnerverständigung
- 4.4.4.1 Wirksame Verständigung durch den Zessionar?
- 4.4.4.2 Verständigung nur eines Schuldners bei Solidarschuld?
- 4.4.5 Buchvermerk
- 4.4.5.1 Von der traditionellen Buchhaltung zur EDV-Buchhaltung
- 4.4.5.2 Anforderungen an den Buchvermerk
- 4.4.5.2.1 Nachträglich leichte und verlässliche Feststellbarkeit der Sicherungszession
- 4.4.5.2.2 Sichere und leichte Feststellbarkeit des Buchungsinhaltes
- 4.4.5.2.3 Ort des Buchvermerks
- 4.4.5.2.4 Inhalt des Buchvermerks
- 4.4.1 Publizitätserfordernis
- 5. Vorrang des Buchvermerks vor Drittschuldnerverständigung bei Buchforderungen?
- 6. Globalzession
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die Rechtsfragen der Sicherungszession, insbesondere im Hinblick auf die Publizität. Ziel ist es, bestehende Unsicherheiten und Risiken in der Rechtsprechung und Lehre zu klären und Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Arten der Zession und ihre Besonderheiten
- Wesen und rechtliche Anforderungen der Sicherungszession
- Publizitätserfordernisse bei der Sicherungszession (Drittschuldnerverständigung und Buchvermerk)
- Untersuchung des Vorrangs von Buchvermerk gegenüber Drittschuldnerverständigung
- Rechtsfragen der Globalzession
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Sicherungszession als Kreditsicherungsmittel und die damit verbundenen Rechtsfragen. Kapitel 2 beschreibt verschiedene Arten der Zession. Kapitel 3 behandelt Sonderformen der Zession, einschließlich der Sicherungszession. Kapitel 4 analysiert detailliert die Sicherungszession, einschließlich des Wesens, des Treuhandverhältnisses, des Titels und des Modus, mit besonderem Fokus auf das Publizitätserfordernis und die Abgrenzung von Buch- und Nichtbuchforderungen. Kapitel 5 untersucht den Vorrang des Buchvermerks vor der Drittschuldnerverständigung bei Buchforderungen. Kapitel 6 befasst sich mit der Globalzession, einschließlich des Bestimmtheitserfordernisses und der Publizität.
Schlüsselwörter
Sicherungszession, Globalzession, Publizität, Drittschuldnerverständigung, Buchvermerk, Buchforderung, Nichtbuchforderung, Kreditsicherung, Treuhandverhältnis, Rechtsfragen, Österreichisches Recht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Sicherungszession?
Die Sicherungszession ist ein Kreditsicherungsmittel, bei dem Forderungen (z. B. Kundenforderungen) zur Besicherung eines Kredits an einen Gläubiger abgetreten werden.
Warum ist die Sicherungszession bei Banken und Unternehmen so beliebt?
Sie ermöglicht eine unkomplizierte Verwertung ohne gerichtliches Verfahren und kann als „stille Zession“ durchgeführt werden, ohne dass der Drittschuldner davon erfährt.
Was versteht man unter dem Publizitätserfordernis bei Zessionen?
Damit eine Sicherungszession rechtlich wirksam ist, muss sie nach außen erkennbar sein, entweder durch Drittschuldnerverständigung oder durch einen Buchvermerk in der Buchhaltung.
Was ist der Unterschied zwischen Einzelzession und Globalzession?
Bei der Einzelzession wird eine spezifische Forderung abgetreten, während bei der Globalzession alle gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus einem bestimmten Bereich übertragen werden.
Welche Anforderungen werden an einen gültigen Buchvermerk gestellt?
Ein Buchvermerk muss die Sicherungszession leicht und verlässlich feststellbar machen, insbesondere im Kontext moderner EDV-Buchhaltungssysteme.
- Citar trabajo
- MMag. Dr. Sabine Picout (Autor), 2006, Rechtsfragen der Sicherungszession, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187664