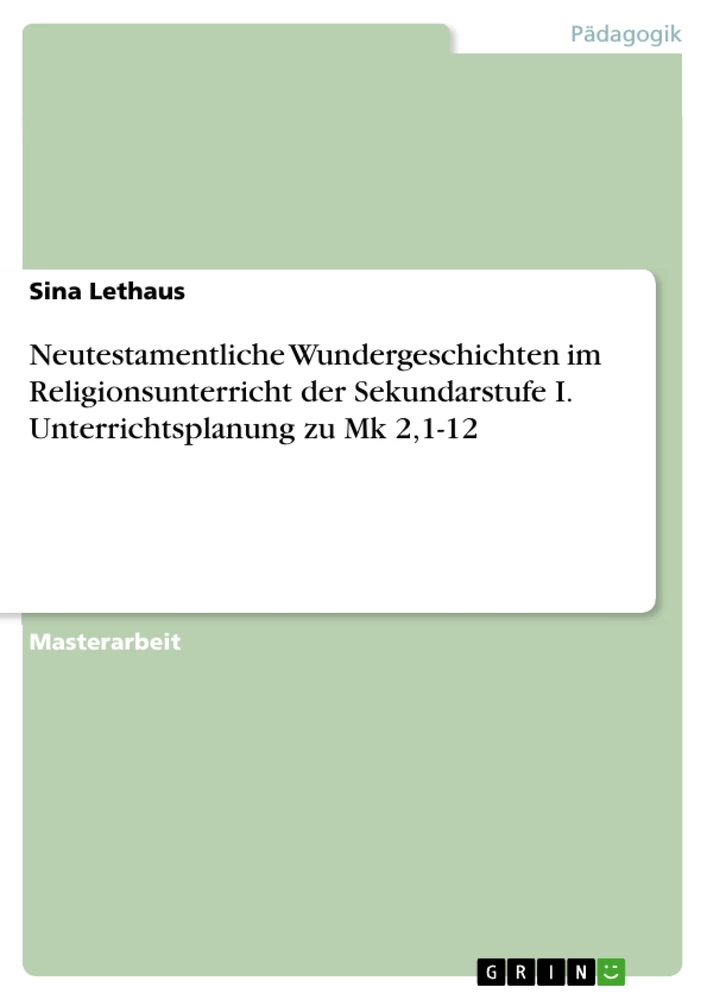Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Wunder in ihrer Vielfältigkeit darzulegen, um auf diese Weise ihre Bedeutsamkeit für die Schüler aufzuzeigen. Dabei soll deutlich werden, dass es bestimmte didaktische Zugangswege gibt, die den Schülern ein Einlassen auf die neutestamentlichen Wundertaten, losgelöst von ihrem rationalen Denken, ermöglichen. Mit einem abschließend skizzierten Unterrichtsentwurf wird eine mögliche Umsetzung von Wundergeschichten vorgestellt. Um diese Ziele erreichen zu können, werden Wunder zunächst in ihren fachwissenschaftlichen Kontext eingeordnet und aus theologischer Perspektive beleuchtet. Dazu wird der Begriff Wunder erläutert und die Wunder Jesu in ihrem Aufbau, ihren Merkmalen und Intentionen dargelegt.
Des Weiteren ist eine Betrachtung der entwicklungspsychologischen Voraussetzungen der Schüler erforderlich, um den Unterricht entsprechend ihrer Bedürfnisse und Voraussetzungen gestalten zu können. Aus diesen Ausführungen werden Grundfragen der Wunderdidaktik und zugleich Schwierigkeiten im Umgang mit Wundern herausgearbeitet. Daran anschließend werden didaktische Ansatzpunkte für die Gestaltung des Unterrichts formuliert, die Hilfestellungen bei den genannten Problematiken bieten.
Mit Hilfe eines Schulbuchvergleiches soll verdeutlicht werden, wie Unterrichtseinheiten zu diesem Themenbereich konzipiert sind und welche theoretischen und didaktischen Aspekte des Themas aufgegriffen werden.
Im Anschluss folgt zu Mk 2,1-12 – als Beispiel für eine neutestamentliche Wundergeschichte – eine Exegese, um auf diese Weise das für die nachfolgend skizzierte Unterrichtsstunde benötigte sachanalytische Wissen zu erarbeiten. Mit dem Unterrichtsentwurf wird dann aufgezeigt, wie „Die Heilung des Gelähmten“ im Unterricht thematisiert und erarbeitet werden kann. Im letzten Teil der Arbeit wird ein Fazit gezogen.
Der Arbeit wird die Bibelübersetzung nach Martin Luther zugrunde gelegt. Die darin enthaltenen Zwischenüberschriften werden als Überschriften für die Wundererzählungen verwendet. Zur Aufschlüsselung der verwendeten Abkürzungen wird auf das Abkürzungsverzeichnis der RGG verwiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Der Begriff des Wunders
- Die Wunder Jesu
- Die Überlieferung der Wunder Jesu
- Der Streit um die Wunder Jesu
- Zur Form neutestamentlicher Wundergeschichten
- Klassifizierung neutestamentlicher Wundergeschichten
- Exorzismen
- Therapien
- Normenwunder
- Rettungswunder
- Geschenkwunder
- Epiphanien
- Die Funktion von Wundergeschichten
- Überlegungen zur Didaktik von Wundererzählungen
- Entwicklungspsychologische Voraussetzungen der Schüler in der Jahrgangsstufe 7/8
- Grundfragen der Wunderdidaktik
- Didaktische Ansatzpunkte
- Schulbuchvergleich
- Konzeption des Religionsbuches „Kursbuch Religion 2000 7/8“
- Konzeption des Religionsbuches „Entdecken, verstehen und gestalten 7/8“
- Vergleich des Themas „Wunder“ in den Schulbüchern
- Äußere Gestaltung
- Aufbau der Unterrichtsreihen
- Inhaltliche Schwerpunktsetzungen
- Didaktische Konzeption
- Methodische Möglichkeiten
- Fazit
- Historisch-kritische Exegese zu Mk 2,1-12
- Verssegmentierung und Gliederung der Texteinheit
- Kontextanalyse
- Abgrenzung des Textes
- Einbettung in den Kontext des Markusevangeliums
- Makrokontext
- Mikrokontext
- Textanalyse
- Sprachlich-syntaktische Analyse
- Semantische Analyse
- Narrative Analyse
- Pragmatische Analyse
- Literarkritik
- Formgeschichte
- Motivgeschichte
- Redaktionsgeschichte
- Unterrichtsentwurf zu Mk 2,1-12
- Einleitung
- Bedingungsfeldanalyse
- Lerngruppe
- Vorwissen
- Ergebnissicherung
- Fachwissenschaftliche Analyse
- Thema der Unterrichtsreihe
- Reflexion der thematischen Aspekte der Unterrichtseinheit
- Einordnung der Unterrichtsstunde in die Unterrichtseinheit
- Reflexion der thematischen Aspekte der Unterrichtsstunde
- Ergebnissicherung
- Didaktische Analyse
- Lehrplanbezug
- Didaktische Konzeption der Unterrichtsstunde
- Methodische Entscheidungen
- Zielsetzung
- Lernziele der Einheit
- Kognitive Lernziele der Unterrichtsstunde
- Emotional-affektive Lernziele der Unterrichtsstunde
- Pragmatische Lernziele der Unterrichtsstunde
- Fazit
- Erklärung der Studierenden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Darstellung neutestamentlicher Wundergeschichten im Religionsunterricht der Sekundarstufe I. Das Hauptziel ist die Entwicklung eines didaktischen Konzepts für den Unterricht anhand des Beispiels von Markus 2,1-12. Die Arbeit analysiert den biblischen Text historisch-kritisch und entwickelt einen konkreten Unterrichtsentwurf.
- Didaktische Ansätze für die Vermittlung von Wundererzählungen im Religionsunterricht
- Historisch-kritische Exegese von Markus 2,1-12
- Entwicklung eines Unterrichtsentwurfs für die Sekundarstufe I
- Vergleich verschiedener Schulbücher und ihrer Konzeption zum Thema Wunder
- Der Begriff des Wunders in der Theologie und seine Relevanz für den Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit. Es definiert den Begriff des Wunders, untersucht die Wunder Jesu in ihrer Überlieferung und den damit verbundenen Debatten, analysiert die Form und Klassifizierung neutestamentlicher Wundergeschichten und beleuchtet schließlich deren Funktion. Der Abschnitt dient als fundierte Basis für die anschließende didaktische Betrachtung.
Überlegungen zur Didaktik von Wundererzählungen: Hier werden didaktische Aspekte der Vermittlung von Wundererzählungen im Religionsunterricht der Sekundarstufe I behandelt. Es werden entwicklungspsychologische Voraussetzungen der Schüler berücksichtigt und verschiedene didaktische Ansatzpunkte diskutiert, um einen altersgerechten und verständlichen Unterricht zu gewährleisten. Die Kapitel legt den Fokus auf die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich bei der Unterrichtung dieses komplexen Themas ergeben.
Schulbuchvergleich: In diesem Kapitel werden verschiedene Schulbücher für den Religionsunterricht der Sekundarstufe I hinsichtlich ihrer Behandlung des Themas „Wunder“ verglichen. Der Fokus liegt auf der äußeren Gestaltung, dem Aufbau der Unterrichtsreihen, inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, der didaktischen Konzeption und den methodischen Möglichkeiten. Dieser Vergleich soll zeigen, wie das Thema in der Praxis umgesetzt wird und welche Unterschiede es in den didaktischen Ansätzen gibt.
Historisch-kritische Exegese zu Mk 2,1-12: Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte historisch-kritische Exegese des Markusevangeliums, Kapitel 2, Verse 1-12. Die Analyse umfasst eine Verssegmentierung, Kontextanalyse (Makro- und Mikrokontext), Textanalyse (sprachlich-syntaktisch, semantisch, narrativ, pragmatisch), Literarkritik, Formgeschichte, Motivgeschichte und Redaktionsgeschichte. Es wird eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Text geboten, die die Grundlage für den späteren Unterrichtsentwurf bildet.
Unterrichtsentwurf zu Mk 2,1-12: Dieses Kapitel präsentiert einen detaillierten Unterrichtsentwurf zur Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12) für die Sekundarstufe I. Es beinhaltet eine Bedingungsfeldanalyse (Lerngruppe, Vorwissen, Ergebnissicherung), eine fachwissenschaftliche Analyse (Thema, thematische Aspekte, Einordnung in die Unterrichtseinheit, Reflexion der Unterrichtsstunde, Ergebnissicherung) und eine didaktische Analyse (Lehrplanbezug, didaktische Konzeption, methodische Entscheidungen, Zielsetzung – kognitive, emotional-affektive und pragmatische Lernziele). Der Entwurf dient als Beispiel für eine praxisorientierte Umsetzung der vorherigen theoretischen Überlegungen.
Schlüsselwörter
Neutestamentliche Wundergeschichten, Markus 2,1-12, Religionsunterricht, Sekundarstufe I, Didaktik, Exegese, Unterrichtsentwurf, Schulbuchvergleich, Wunderbegriff, Entwicklungspsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Didaktische Konzepte für die Vermittlung neutestamentlicher Wundergeschichten im Religionsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Darstellung neutestamentlicher Wundergeschichten im Religionsunterricht der Sekundarstufe I. Das Hauptziel ist die Entwicklung eines didaktischen Konzepts für den Unterricht anhand des Beispiels von Markus 2,1-12. Die Arbeit analysiert den biblischen Text historisch-kritisch und entwickelt einen konkreten Unterrichtsentwurf.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Didaktische Ansätze für die Vermittlung von Wundererzählungen, historisch-kritische Exegese von Markus 2,1-12, Entwicklung eines Unterrichtsentwurfs für die Sekundarstufe I, Vergleich verschiedener Schulbücher und ihrer Konzeption zum Thema Wunder, und der Begriff des Wunders in der Theologie und seine Relevanz für den Religionsunterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (inkl. Begriff des Wunders, Wunder Jesu, Form und Klassifizierung neutestamentlicher Wundergeschichten, Funktion von Wundergeschichten), Überlegungen zur Didaktik von Wundererzählungen (inkl. entwicklungspsychologische Voraussetzungen, Grundfragen der Wunderdidaktik, didaktische Ansatzpunkte), Schulbuchvergleich (inkl. Konzeption verschiedener Schulbücher, Vergleich des Themas "Wunder"), Historisch-kritische Exegese zu Mk 2,1-12 (inkl. Verssegmentierung, Kontextanalyse, Textanalyse, Literarkritik, Formgeschichte, Motivgeschichte, Redaktionsgeschichte), Unterrichtsentwurf zu Mk 2,1-12 (inkl. Bedingungsfeldanalyse, fachwissenschaftliche Analyse, didaktische Analyse), Fazit und Erklärung der Studierenden.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Theoretischer Hintergrund"?
Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen. Es definiert den Begriff des Wunders, untersucht die Wunder Jesu und die damit verbundenen Debatten, analysiert die Form und Klassifizierung neutestamentlicher Wundergeschichten und deren Funktion. Es dient als Basis für die didaktische Betrachtung.
Was wird im Kapitel "Überlegungen zur Didaktik von Wundererzählungen" behandelt?
Hier werden didaktische Aspekte der Vermittlung von Wundererzählungen im Religionsunterricht der Sekundarstufe I behandelt. Es werden entwicklungspsychologische Voraussetzungen der Schüler berücksichtigt und verschiedene didaktische Ansatzpunkte diskutiert, um einen altersgerechten Unterricht zu gewährleisten.
Worauf konzentriert sich der Schulbuchvergleich?
Der Schulbuchvergleich konzentriert sich auf die Behandlung des Themas "Wunder" in verschiedenen Schulbüchern der Sekundarstufe I. Verglichen werden äußere Gestaltung, Aufbau der Unterrichtsreihen, inhaltliche Schwerpunktsetzungen, didaktische Konzeption und methodische Möglichkeiten.
Wie wird Mk 2,1-12 exegetisch behandelt?
Mk 2,1-12 wird einer detaillierten historisch-kritischen Exegese unterzogen. Die Analyse umfasst Verssegmentierung, Kontextanalyse (Makro- und Mikrokontext), Textanalyse (sprachlich-syntaktisch, semantisch, narrativ, pragmatisch), Literarkritik, Formgeschichte, Motivgeschichte und Redaktionsgeschichte.
Was beinhaltet der Unterrichtsentwurf zu Mk 2,1-12?
Der Unterrichtsentwurf beinhaltet eine Bedingungsfeldanalyse (Lerngruppe, Vorwissen, Ergebnissicherung), eine fachwissenschaftliche Analyse (Thema, thematische Aspekte, Einordnung, Reflexion, Ergebnissicherung) und eine didaktische Analyse (Lehrplanbezug, didaktische Konzeption, methodische Entscheidungen, Lernziele – kognitiv, emotional-affektiv, pragmatisch).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neutestamentliche Wundergeschichten, Markus 2,1-12, Religionsunterricht, Sekundarstufe I, Didaktik, Exegese, Unterrichtsentwurf, Schulbuchvergleich, Wunderbegriff, Entwicklungspsychologie.
- Quote paper
- Sina Lethaus (Author), 2011, Neutestamentliche Wundergeschichten im Religionsunterricht der Sekundarstufe I. Unterrichtsplanung zu Mk 2,1-12, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187517