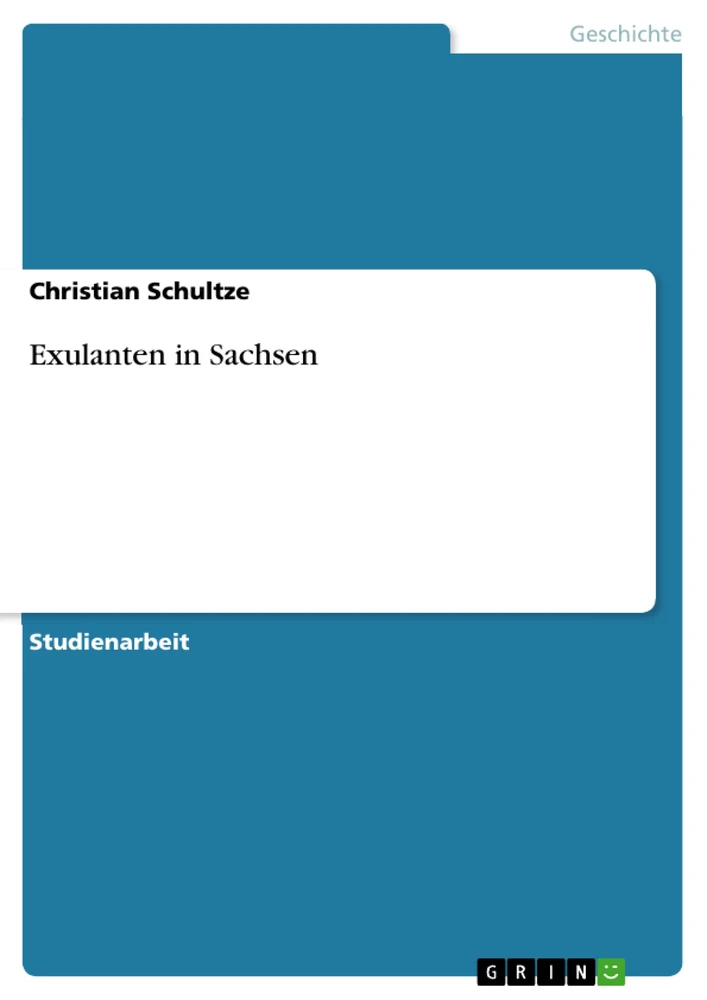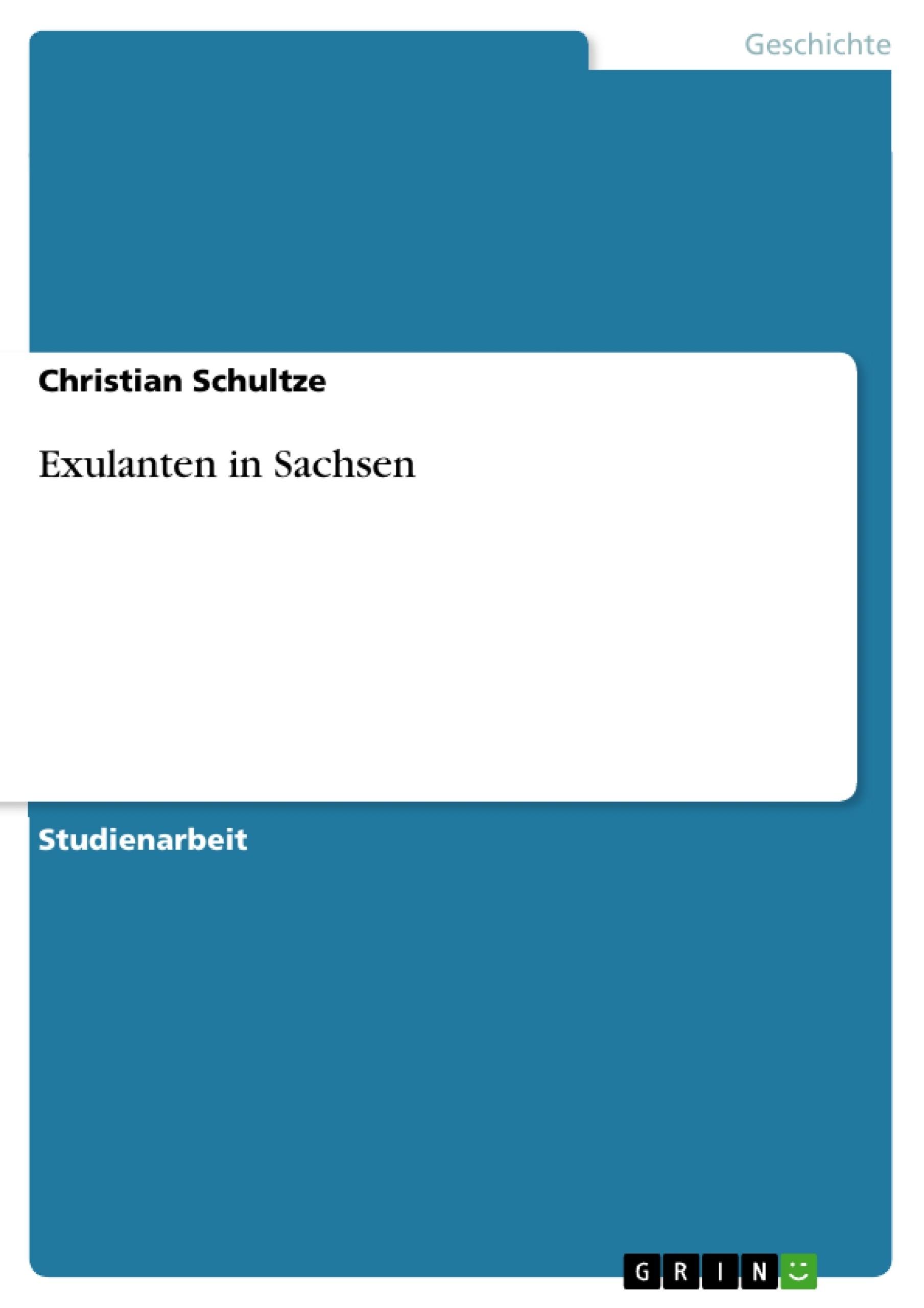Mit der Niederlage der böhmischen Stände in der Schlacht am Weißen Berg am 8. November 1620 unter ihrem König Friedrich V. von der Pfalz gegen die katholische Liga begann in Böhmen die Gegenreformation. Nachdem der überwiegende Teil der böhmischen Bevölkerung bereits zum protestantischen Christentum übergetreten war (besonders in Richtung der Lutheraner und Hussiten ), wurde nun mit Zwangsmaßnahmen die Rekatholisierung vorangetrieben. 1621 wurde der Majestätsbrief von 1609, in dem den böhmischen Ständen Religionsfreiheit gewährt wurde, von Kaiser Ferdinand II. aufgehoben. Wer nicht zum Katholizismus konvertieren wollte, musste das Land verlassen, oftmals ohne die Möglichkeit, den Besitz zu veräußern oder die bewegliche Habe mitnehmen zu können. Viele zehntausend Böhmen verließen daraufhin ihr Land und fanden im protestantischen Kurfürstentum Sachsen eine Zuflucht. Durch die meist recht überstürzt erfolgende Flucht verloren die meisten ihr gesamtes Hab und Gut und mussten in Sachsen ein neues Leben beginnen. Zunächst waren besonders die Träger der Gesellschaft, wie beispielsweise Pfarrer und Lehrer, von der Verfolgung in Böhmen betroffen , später mussten dann auch Handwerker und Bauern fliehen. Diese Flüchtlinge waren erheblich am Neuaufbau Sachsens, das vom Dreißigjährigen Krieg und der Pest wie die meisten Teile Deutschlands stark betroffen war, beteiligt. Um ihren Status als Glaubensflüchtlinge deutlich zu machen, erhielten sie wie alle protestantischen Flüchtlinge zu dieser Zeit die Bezeichnung Exulanten.
Die Aufnahme vieler Flüchtlinge musste unweigerlich Auswirkungen auf das Kurfürstentum Sachsen haben. Jedoch sollte man die Exulanten nicht als eine einheitliche Gruppe betrachten. Sie zerfällt in viele kleine Einheiten, die besonders durch ihre Herkunft und durch ihre Sprache zu unterscheiden sind. Außerdem erfolgte ihre Auswanderung über einen Zeitraum von ungefähr 300 Jahren, was die Homogenität noch zusätzlich als sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt. Wie wurden nun diese unterschiedlichen Gruppen in der sächsischen Gesellschaft erlebt und wie verhielten sie sich in ihrer neuen Umwelt? Wie änderten sich die Sichtweisen im Verlauf der Zeit und inwiefern beeinflussten die eingewanderten „deutschen“, bzw. „tschechischen“ Böhmen dieses Bild in der sächsischen Bevölkerung durch ihr Verhalten? Das Hauptaugenmerk soll hierbei auf der Sichtweise des 19. Jahrhunderts liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Fragestellung
- Literatur
- Aufbau
- Vorbemerkungen zur Flucht der Exulanten
- Die Bedeutung des Dreißigjährigen Krieges
- Der Grenzraum
- Immigranten
- Der Exulantenbegriff
- Erinnerungskultur und Identitätsstiftung
- Sichtweise des 19. Jahrhunderts
- Religiöse Darstellung
- Wirtschaftliche Darstellung
- Exulanten als politische Flüchtlinge
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Aufnahme und Integration böhmischer Exulanten in Sachsen im 17. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf die Sichtweise des 19. Jahrhunderts. Die Arbeit untersucht, wie die Exulanten in der sächsischen Gesellschaft wahrgenommen wurden und wie sich diese Sichtweise im Laufe der Zeit entwickelte.
- Die Rolle der Exulanten beim Wiederaufbau Sachsens nach dem Dreißigjährigen Krieg
- Die unterschiedlichen Herkünfte und Erfahrungen der Exulanten
- Die Instrumentalisierung der Exulanten in der protestantischen Literatur des 19. Jahrhunderts
- Die Entwicklung des Begriffs "Exulanten" und die Herausforderungen der historischen Rekonstruktion ihrer Lebensgeschichten
- Die Frage nach der Homogenität der Exulanten als Gruppe
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung und die Fragestellung der Arbeit ein. Es bietet einen Überblick über die historischen Rahmenbedingungen der Exulantenflucht im 17. Jahrhundert, insbesondere die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges und die religiösen Konflikte in Böhmen. Das Kapitel beleuchtet auch die Definition des Begriffs "Exulanten" und die Einordnung der Flüchtlinge in die sächsische Gesellschaft. Das zweite Kapitel widmet sich der komplexen Thematik der Inhomogenität der Exulanten und der Instrumentalisierung ihrer Geschichte in der protestantischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Exulanten und die Herausforderungen, die sich aus ihrer unterschiedlichen Herkunft, Sprache und sozialen Herkunft ergeben. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Schlussbetrachtung, die die unterschiedlichen Sichtweisen zwischen der Gegenwart und dem 19. Jahrhundert bewertet.
Schlüsselwörter
Böhmische Exulanten, Dreißigjähriger Krieg, Gegenreformation, Sachsen, Flüchtlinge, Integration, Identität, Erinnerungskultur, Historiografie des 19. Jahrhunderts, Inhomogenität, Instrumentalisierung.
- Quote paper
- Christian Schultze (Author), 2008, Exulanten in Sachsen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187515