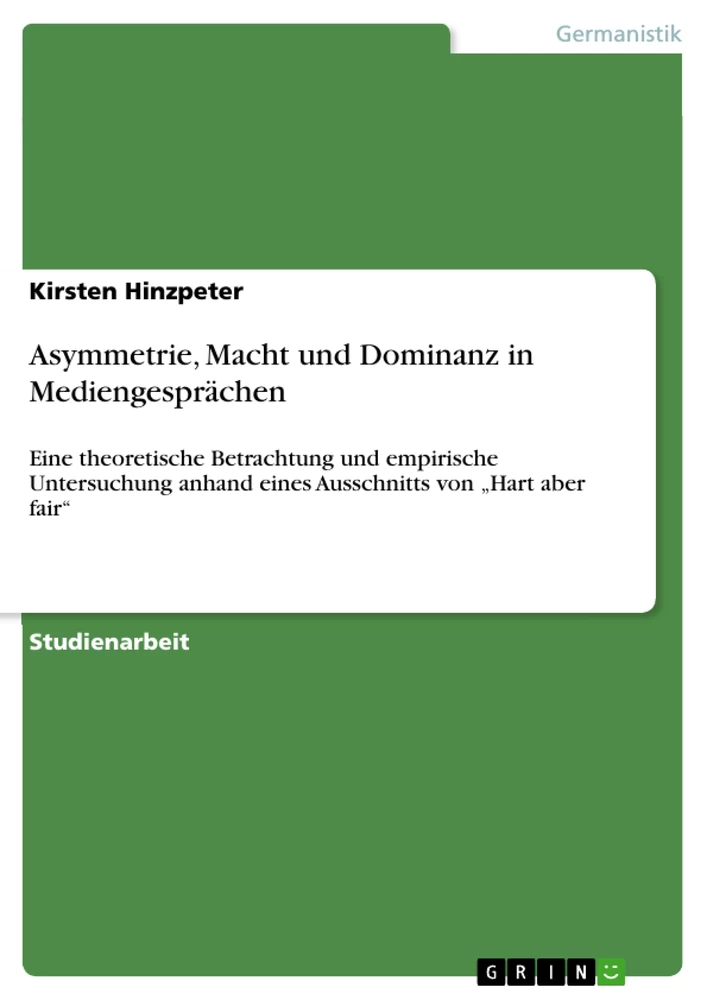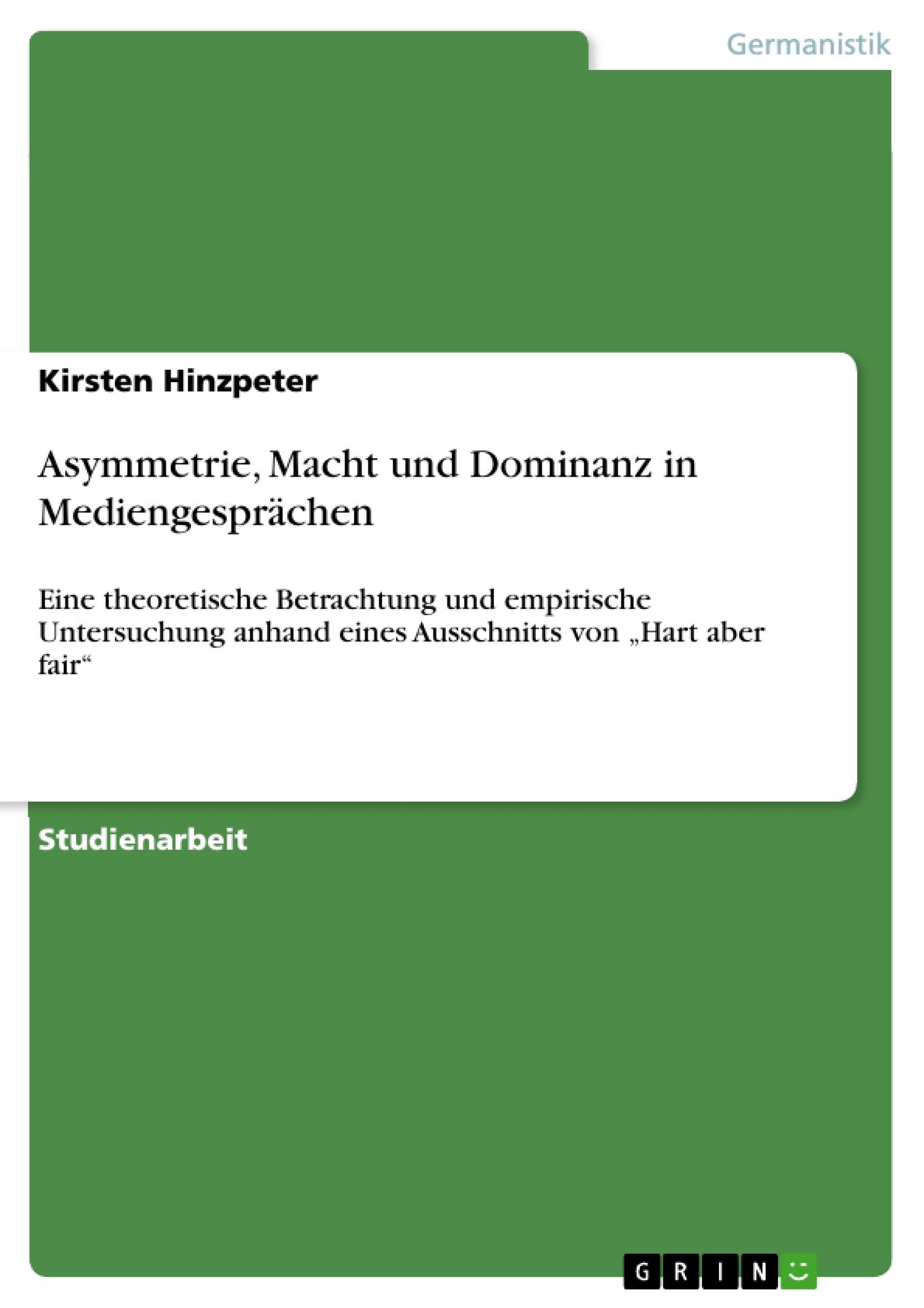Macht findet sich immer dort, so Foucault (Thornborrow 2002:7), wo mehrere Menschen in einem Netzwerk von sozialen und diskursiven Beziehungen interagieren. Machtstrukturen sind also in jeder alltäglichen Situation zu beobachten. Diese Arbeit wird sich jedoch mit der Frage der Machtbeziehungen im Gespräch in einem bestimmten Kontext beschäftigen, nämlich dem des Mediengesprächs. Die Rolle des Moderators und die Rollen der Gäste sind in diesem Kontext üblicherweise deutlich voneinander abgegrenzt, was sich, so ist zu vermuten, auch in der Struktur des Gesprächs widerspiegelt. Ob diese angelegten Rollen sich tatsächlich auch empirisch in der konkreten Interaktionsdynamik erkennen lassen, ist jedoch eine andere Frage. Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit soll also die Beziehung zwischen „power in discourse and power behind discourse“ (Fairclough 1989 :43) sein, d.h. die Untersuchung, ob es tatsächlich möglich ist, die zu vermutenden Asymmetrien anhand des Diskurses herauszukristallisieren.
Um jedoch diese Problematik genauer untersuchen zu können, bedarf es zunächst der Klärung einiger wichtiger Begriffe. Es wird demnach zunächst einmal die Begriffsklärung von Macht, Dominanz und Asymmetrie/Symmetrie der eigentlichen Diskussion vorgeschaltet, um eine differenzierte Betrachtung zu gewährleisten. Nach der folgenden theoretischen Betrachtung, die den aktuellen Forschungsstand aufgreifen soll, folgt abschließend die Analyse eines Ausschnitts aus der Sendung „Sekten, Gurus und Gehirnwäsche“ des Formats „Hart aber fair“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Asymmetrie
- Macht und Dominanz
- Der institutionelle Kontext
- Rahmenbedingungen
- Interaktionsdynamik
- Machtressourcen der Institution
- Machtressourcen des Moderators
- Machtressourcen der Gesprächsteilnehmer
- Sekten, Gurus und Gehirnwäsche – Eine empirische Untersuchung anhand eines Beispiels aus „Hart aber fair“
- Asymmetrien zugunsten der Institution
- Asymmetrien zugunsten des Moderators und der Gesprächsteilnehmer
- Zeile 1-9
- Zeile 9-20
- Zeile 20-34
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Machtbeziehungen in Mediengesprächen, insbesondere die Interaktion zwischen „power in discourse and power behind discourse“. Das Ziel ist es, anhand eines Ausschnitts der Sendung „Hart aber fair“ zu analysieren, ob sich vermutete Asymmetrien im Diskurs empirisch nachweisen lassen. Die Arbeit klärt zunächst die Begriffe Macht, Dominanz und Asymmetrie. Anschließend wird der institutionelle Kontext von Mediengesprächen betrachtet, bevor eine empirische Analyse folgt.
- Macht und Dominanz in Mediengesprächen
- Asymmetrien in der Gesprächsführung und -struktur
- Der Einfluss institutioneller Rahmenbedingungen auf die Interaktion
- Analyse von Machtressourcen verschiedener Akteure (Moderator, Institution, Gäste)
- Empirische Untersuchung anhand eines Beispiels aus „Hart aber fair“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Machtbeziehungen in Mediengesprächen ein und skizziert die Forschungsfrage: Lässt sich die vermutete Asymmetrie zwischen Moderator, Gästen und Institution im Diskurs nachweisen? Foucault wird zitiert, um den allgegenwärtigen Charakter von Machtstrukturen zu betonen. Die Arbeit kündigt die begriffliche Klärung von Macht, Dominanz und Asymmetrie an, gefolgt von einer theoretischen Betrachtung und einer empirischen Analyse eines Ausschnitts aus „Hart aber fair“.
Begriffsklärung: Dieses Kapitel beleuchtet die vielschichtigen Definitionen von Asymmetrie, Macht und Dominanz. Es hebt die uneinheitliche Verwendung dieser Begriffe in der Forschung hervor und diskutiert verschiedene Perspektiven, etwa die Conversation Analysis (CA) und Habermas' Ansatz. Die Unterscheidung zwischen globalen und lokalen sowie vertikalen und horizontalen Asymmetrien wird erläutert, ebenso die komplexe Beziehung zwischen beobachteter Kommunikation und institutionellem Rahmen. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung dieser Konzepte.
Der institutionelle Kontext: Dieses Kapitel befasst sich mit dem institutionellen Kontext von Mediengesprächen, speziell den Rahmenbedingungen und der Interaktionsdynamik. Es untersucht die Machtressourcen der beteiligten Akteure: der Institution (Sender), des Moderators und der Gesprächsteilnehmer. Es analysiert, wie diese Ressourcen die Gesprächsdynamik prägen und zu Asymmetrien führen können. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der Machtstrukturen, die die spätere empirische Analyse prägen.
Sekten, Gurus und Gehirnwäsche – Eine empirische Untersuchung anhand eines Beispiels aus „Hart aber fair“: Dieses Kapitel präsentiert die empirische Analyse eines Ausschnitts aus der Sendung „Hart aber fair“. Es untersucht die Asymmetrien zugunsten der Institution und die Asymmetrien zugunsten des Moderators und der Gesprächsteilnehmer, indem es den Diskurs Zeile für Zeile analysiert und die Verteilung von Sprechanteilen und Gesprächsführung bewertet. Die Analyse verdeutlicht die Interaktion von institutionellen und interaktiven Asymmetrien.
Schlüsselwörter
Mediengespräch, Macht, Dominanz, Asymmetrie, Institution, Moderator, Gesprächsteilnehmer, Diskursanalyse, „Hart aber fair“, Interaktionsdynamik, Machtressourcen, Institutionelle Rahmenbedingungen, Empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Machtbeziehungen in Mediengesprächen - Eine Analyse von "Hart aber fair"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Machtbeziehungen in Mediengesprächen, insbesondere die Interaktion zwischen "power in discourse and power behind discourse". Im Fokus steht die Frage, ob sich vermutete Asymmetrien im Diskurs empirisch nachweisen lassen. Die Analyse basiert auf einem Ausschnitt der Sendung "Hart aber fair".
Welche Begriffe werden geklärt?
Die Arbeit klärt die vielschichtigen Definitionen von Asymmetrie, Macht und Dominanz. Es werden unterschiedliche Perspektiven aus der Forschung diskutiert, z.B. die Conversation Analysis (CA) und Habermas' Ansatz. Die Unterscheidung zwischen globalen und lokalen sowie vertikalen und horizontalen Asymmetrien wird erläutert.
Wie wird der institutionelle Kontext betrachtet?
Der institutionelle Kontext von Mediengesprächen wird untersucht, einschließlich der Rahmenbedingungen und der Interaktionsdynamik. Die Machtressourcen der beteiligten Akteure (Institution, Moderator, Gesprächsteilnehmer) und deren Einfluss auf die Gesprächsdynamik werden analysiert.
Wie wird die empirische Analyse durchgeführt?
Die empirische Analyse erfolgt anhand eines konkreten Ausschnitts aus der Sendung "Hart aber fair". Es werden Asymmetrien zugunsten der Institution sowie zugunsten des Moderators und der Gesprächsteilnehmer untersucht, indem der Diskurs Zeile für Zeile analysiert und die Verteilung von Sprechanteilen und Gesprächsführung bewertet wird.
Welche konkreten Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Lässt sich die vermutete Asymmetrie zwischen Moderator, Gästen und Institution im Diskurs nachweisen? Zusätzlich werden Fragen zur Definition und Operationalisierung von Macht, Dominanz und Asymmetrie im Kontext von Mediengesprächen behandelt.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit kombiniert begriffliche Klärung und theoretische Betrachtung mit einer empirischen Diskursanalyse eines konkreten Beispiels aus "Hart aber fair". Die empirische Analyse beinhaltet eine detaillierte Untersuchung der Sprechanteile und der Gesprächsführung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Mediengespräch, Macht, Dominanz, Asymmetrie, Institution, Moderator, Gesprächsteilnehmer, Diskursanalyse, "Hart aber fair", Interaktionsdynamik, Machtressourcen, Institutionelle Rahmenbedingungen, Empirische Untersuchung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Begriffsklärung, die Betrachtung des institutionellen Kontextes, eine empirische Untersuchung anhand eines Beispiels aus "Hart aber fair" und ein Fazit.
Welche theoretischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene theoretische Ansätze, darunter die Conversation Analysis (CA) und den Ansatz von Habermas. Der Einfluss von Foucault bezüglich allgegenwärtiger Machtstrukturen wird ebenfalls erwähnt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende im Bereich der Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft und Soziologie, die sich mit Machtstrukturen in Mediengesprächen beschäftigen. Sie bietet eine detaillierte Analyse von Machtbeziehungen anhand eines konkreten Beispiels.
- Quote paper
- Kirsten Hinzpeter (Author), 2010, Asymmetrie, Macht und Dominanz in Mediengesprächen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187481