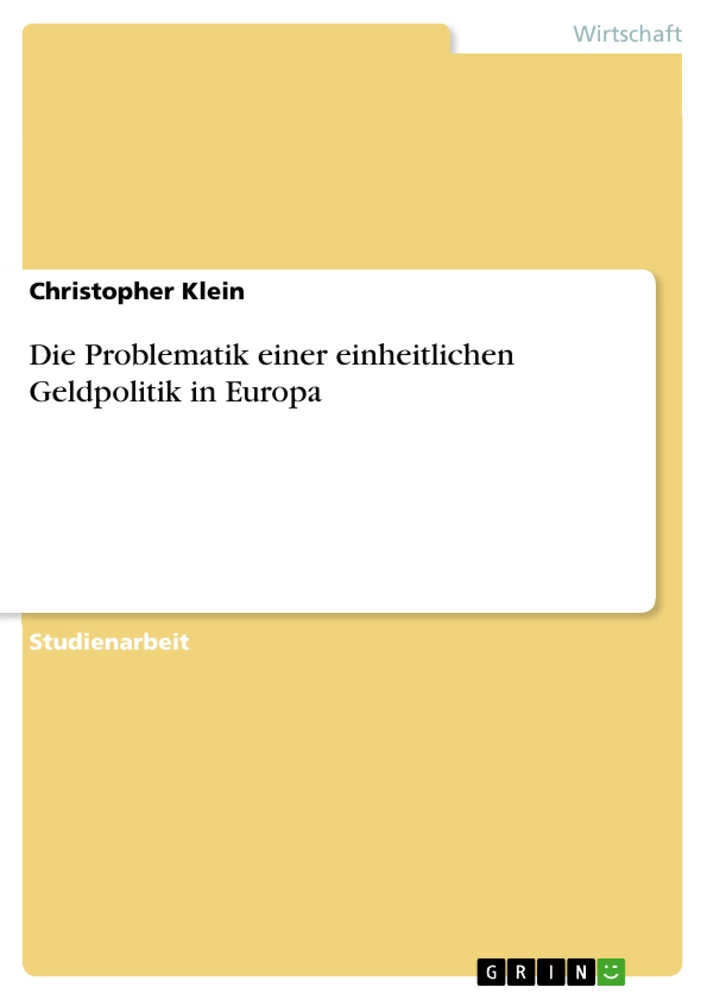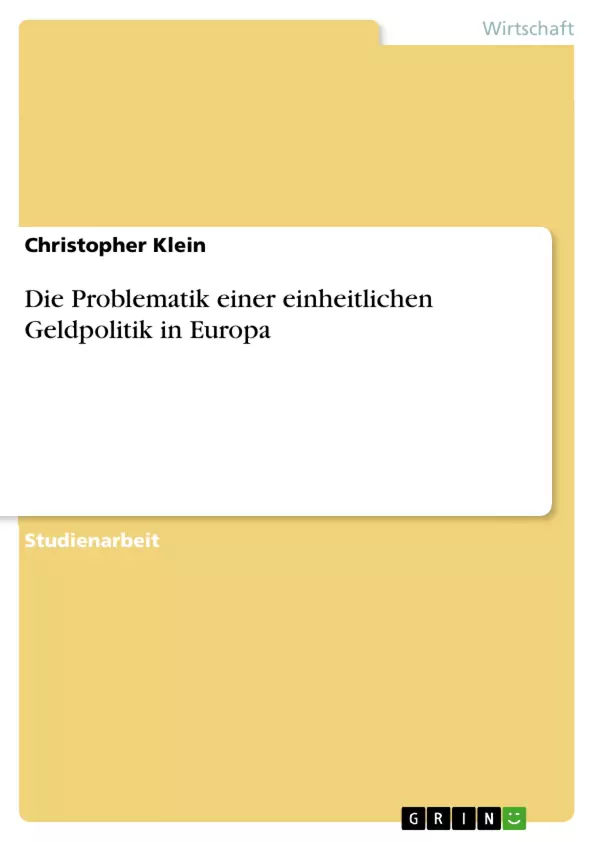Um eine Aussage über die einheitliche Geldpolitik in Europa und den damit verbundenen Problematiken machen zu können, ist es von Bedeutung, sich das ausübende Organ, die Europäische Zentralbank (EZB), näher anzusehen. Das geldpolitische Ziel, welches von der EZB ausgegeben wird, ist die Wahrung der Preisstabilität, im Artikel 105 Absatz 1 des EG-Vertrages auch schriftlich dargelegt. Zur Durchsetzung dieses Ziels, wurde der EZB und den nationalen Zentralbanken nach Artikel 108 des EG-Vertrages Unabhängigkeit zugesichert.1 Im Einklang mit diversen Meinungsumfragen in der europäischen Bevölkerung würde der Großteil das Leben am liebsten weder mit Inflation noch mit Deflation bestreiten. Das ausgegebene Ziel der Preisstabilität bewirkt, dass die Geldpolitik auf das wirtschaftliche Wohlergehen aller ausgerichtet ist, also gleichbedeutend mit hoher wirtschaftlicher Aktivität und Beschäftigung. Dies bedeutet auf Dauer, den Menschen einen stetigen Anstieg des Lebensstandards zu gewährleisten.2 Die EZB hat das Ziel folgendermaßen definiert: „Price stability shall be defined as a year-on-year increase in the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) for the euro area of below 2%.”3 Demzufolge ist das Ziel der EZB eine jährliche Inflation von weniger, jedoch so nahe wie möglich des 2%-Wertes in den Euroländern zu erreichen. Diese Aussage wurde dann in 2003 erweitert, indem dieses Ziel über die mittlere Frist für den Fall unerwarteter Marktströmungen erreicht werden sollte. Die EZB stellte jedoch nicht klar, welcher Zeitraum damit gemeint ist.4 Oft wird gesagt, dass es für die EZB vielleicht von Vorteil gewesen wäre, zunächst ein höheres Inflationsziel auszugeben und dieses dann über die Zeit zu reduzieren.5
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung, Strategie und Instrumentarium der Europäischen Zentralbank
- Theorie optimaler Währungsräume
- Asymmetrische und symmetrische Schocks
- Länderspezifische Unterschiede
- Einschränkung durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Auslöser
- Auswirkungen in Modellanalysen
- Geld vs. Fiskalpolitik am Beispiel der deutschen Wiedervereinigung
- Empirisches Beispiel: Die Finanzkrise und die Geldpolitik der EZB
- Zusammenfassende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik einer einheitlichen Geldpolitik in Europa. Die Zielsetzung besteht darin, die Herausforderungen und Einschränkungen einer solchen Politik zu analysieren und zu bewerten.
- Zielsetzung und Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB)
- Theorie optimaler Währungsräume und ihre Anwendbarkeit auf die Europäische Währungsunion (EWU)
- Auswirkungen asymmetrischer und symmetrischer Schocks auf die Mitgliedsstaaten
- Länderspezifische Unterschiede und ihre Relevanz für die Geldpolitik
- Einschränkungen durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Zielsetzung, Strategie und den Instrumenten der EZB. Kapitel zwei erläutert die Theorie optimaler Währungsräume. Kapitel drei analysiert asymmetrische und symmetrische Schocks, während Kapitel vier länderspezifische Unterschiede im Kontext der einheitlichen Geldpolitik beleuchtet. Kapitel fünf untersucht die Einschränkungen durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt, inklusive Auslöser, Auswirkungen in Modellanalysen und einem Vergleich von Geld- und Fiskalpolitik am Beispiel der deutschen Wiedervereinigung. Das sechste Kapitel bietet ein empirisches Beispiel anhand der Finanzkrise und der Reaktion der EZB.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank (EZB), Europäische Währungsunion (EWU), Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), Geldpolitik, asymmetrische Schocks, symmetrische Schocks, optimale Währungsräume, Länderspezifische Unterschiede, Finanzkrise.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Europäischen Zentralbank (EZB)?
Das primäre Ziel der EZB ist die Wahrung der Preisstabilität innerhalb der Eurozone, definiert als Inflationsrate von unter, aber nahe 2 %.
Was ist ein asymmetrischer Schock?
Ein wirtschaftliches Ereignis, das nur einzelne Mitgliedstaaten einer Währungsunion trifft, was eine einheitliche Geldpolitik für alle Länder schwierig macht.
Was besagt die Theorie optimaler Währungsräume?
Sie analysiert die Kriterien, unter denen es für Länder ökonomisch sinnvoll ist, eine gemeinsame Währung einzuführen, wie etwa Arbeitsmobilität und Preisflexibilität.
Wie schränkt der Stabilitäts- und Wachstumspakt die Staaten ein?
Der Pakt setzt Grenzen für Haushaltsdefizite und Gesamtverschuldung, um die Stabilität des Euro zu sichern, schränkt aber den fiskalischen Spielraum der Länder ein.
Warum ist die Unabhängigkeit der EZB so wichtig?
Die Unabhängigkeit von politischer Einflussnahme soll sicherstellen, dass die Preisstabilität langfristig und ohne Rücksicht auf Wahlzyklen verfolgt werden kann.
- Quote paper
- Christopher Klein (Author), 2009, Die Problematik einer einheitlichen Geldpolitik in Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187328