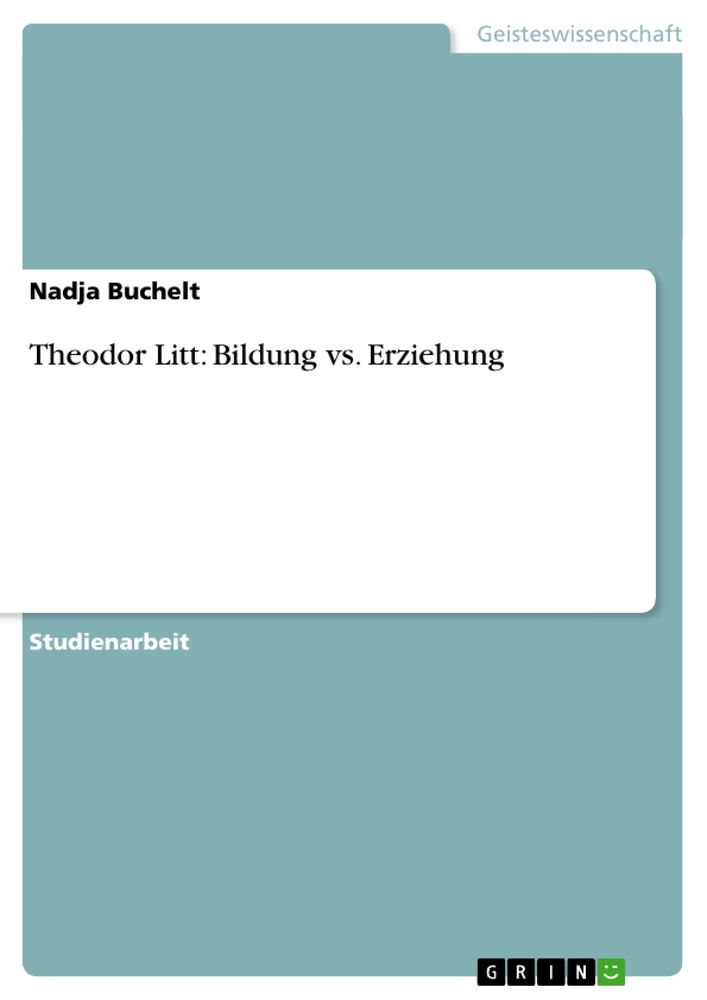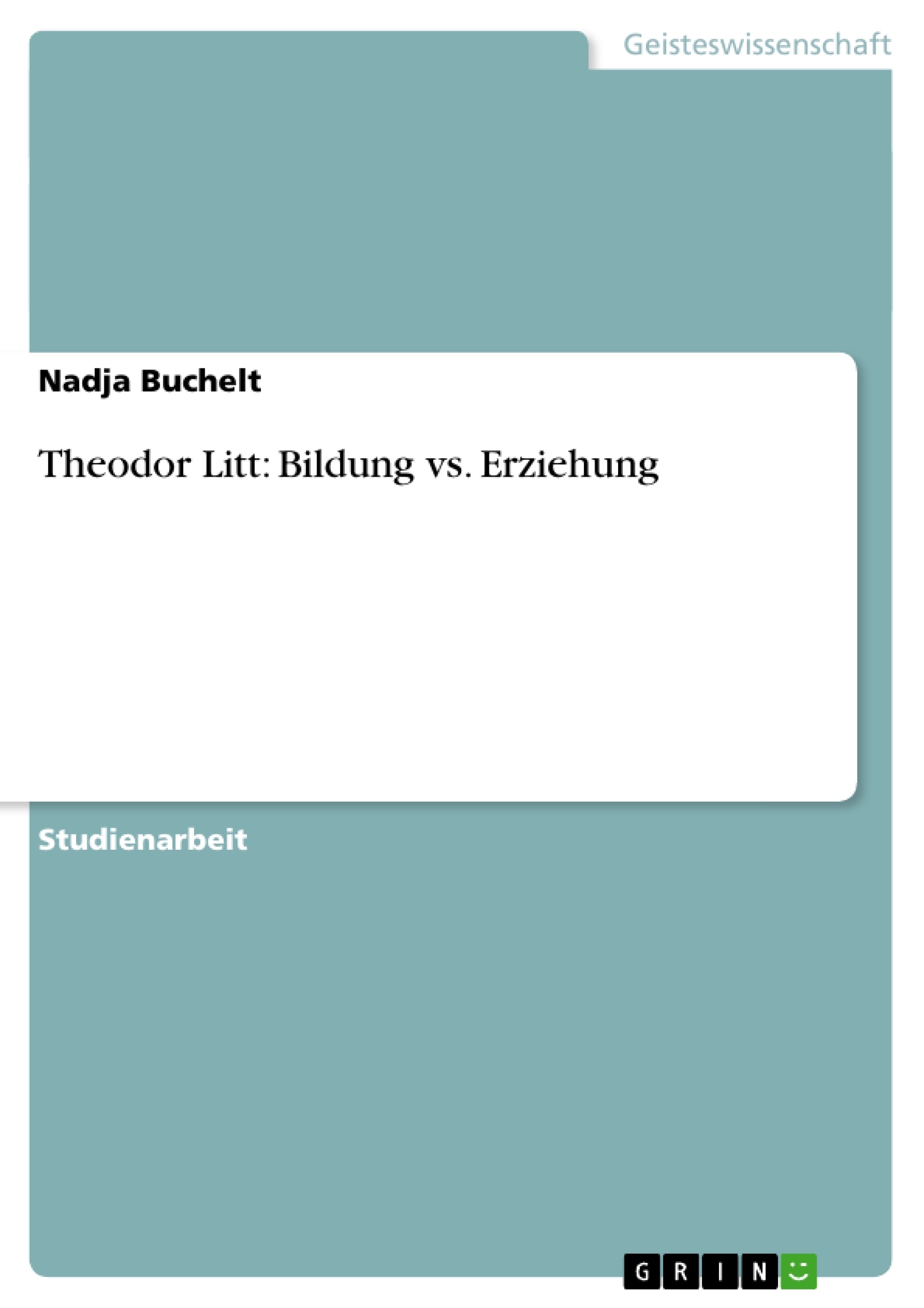Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Streitfrage, wie Bildung und Erziehung zu sein haben und zu verstehen sind.
„Der einzelne Mensch ist in der Dynamik der großen kollektiven Mächte hineinverflochten, hat jedoch trotz dieser schicksalshaften Verflechtung sein je eigenes, unableitbares und unaufgebbares, mit persönlicher Verantwortung und Entscheidung beladenes Sein“ (Reble 1999: 369). Dieser Zusammenhang ist als existentielle Aufgabe zu bewältigen und muss anerkannt werden nach Theodor Litt.
Die Erziehung soll dem Menschen dabei helfen durchzuhalten bei anthropologischen Spannungen und Einseitigkeiten und Selbsttäuschungen verhüten (nach Reble 1999: 369). Der Erzieher soll „Anwalt des Geistes“ als auch „Anwalt des Kindes“ sein. Das heißt, er setzt sich auseinander mit der geistlich geschichtlichen Gesamtlage und er zwängt dem Kind nicht seine Haltung auf. Weder führt er noch lässt er wachsen, sondern er führt in die „Welt der Werte, Gehalte und Aufgaben des Kulturlebens“ ein (Reble 1999: 371).
Um die demokratische Grundordnung zu schützen benötigt man Haltung und die Einübung des rechten Stils, die durch politische Bildung vermittelt werden soll.
Litt „bestimmt die Pädagogik als Geisteswissenschaft, deren Organ das konkrete, lebenerfüllte, in der Ich-du-Beziehung wurzelnde >>Verstehen<< ist“ (Reble 1999: 370).
Erziehung als Führung zu identifizieren ist verhängnisvoll, wie das Dritte Reich zeigte. Jedoch ist Pädagogik als Wachsenlassen genauso verhängnisvoll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Theodor Litt: Bildung vs. Erziehung
- 2. Theodor Litt: Führen oder Wachsen lassen
- 3. Kritik an Theodor Litt
- 4. Bildung und Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland
- 5. Verbesserungsvorschläge und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die kontroverse Frage nach dem Wesen von Bildung und Erziehung, basierend auf den Ansichten Theodor Litts. Sie analysiert Litts Konzept von "Führen" und "Wachsenlassen" und deren Auswirkungen auf den Bildungsprozess. Die Arbeit bewertet kritisch Litts Position und setzt sie in den Kontext des deutschen Bildungssystems.
- Differenzierung von Bildung und Erziehung nach Theodor Litt
- Kritik an Litts Konzept von "Führen" und "Wachsenlassen"
- Der Zustand von Bildung und Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland
- Verbesserungsvorschläge für das deutsche Bildungssystem
- Mündigkeit als Ziel der Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie sind Bildung und Erziehung zu verstehen? Sie führt in Litts Ansatz ein und betont die existentielle Bedeutung der Auseinandersetzung mit anthropologischen Spannungen.
Kapitel 2: Dieses Kapitel differenziert Litts Verständnis von "Führen" und "Wachsenlassen" als zwei gegensätzliche pädagogische Ansätze. "Führen" wird als zielorientiert und traditionell beschrieben, während "Wachsenlassen" als ein mögliches Vermeiden von Verantwortung dargestellt wird. Der Text untersucht die jeweiligen Vor- und Nachteile beider Konzepte.
Kapitel 3: Hier wird Litts Arbeit kritisch beleuchtet. Es werden Einwände gegen seine Definition von Erziehung formuliert und ein alternatives Verständnis von Bildung präsentiert, welches den Fokus auf die Aneignung von Kultur legt.
Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert den Zustand des deutschen Bildungssystems und kritisiert dessen Mängel hinsichtlich der Förderung von Schülern und der ungleichen Verteilung von Bildungschancen.
Schlüsselwörter
Bildung, Erziehung, Theodor Litt, Führen, Wachsenlassen, Bildungsideal, Mündigkeit, deutsches Bildungssystem, pädagogische Grundproblem, gesellschaftliche Verantwortung, Verbesserungsvorschläge.
- Quote paper
- Nadja Buchelt (Author), 2010, Theodor Litt: Bildung vs. Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187252