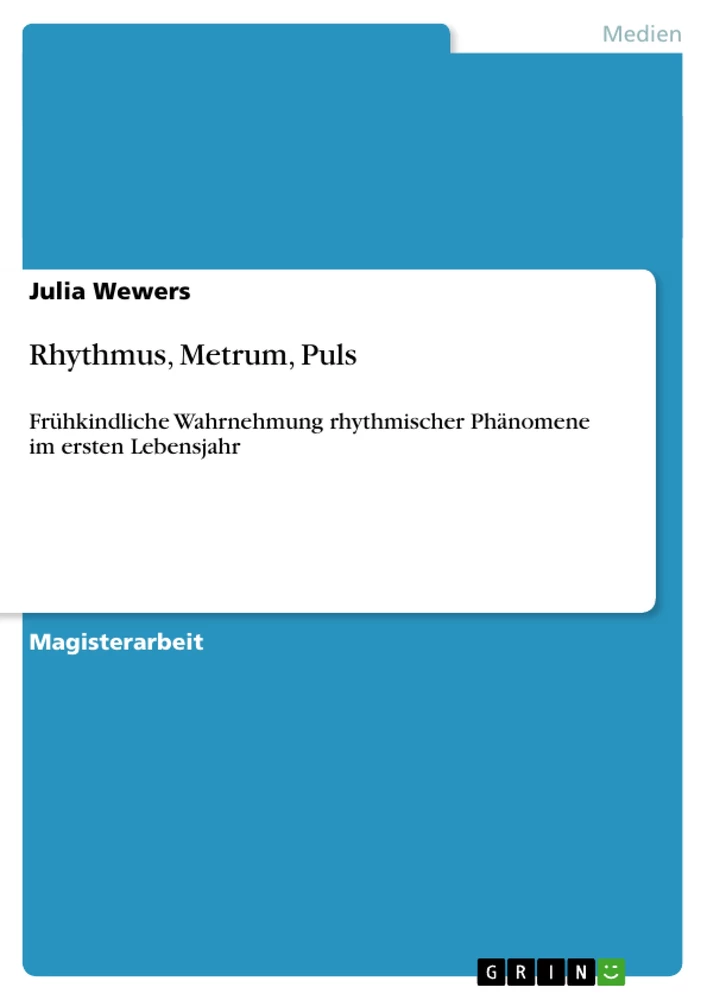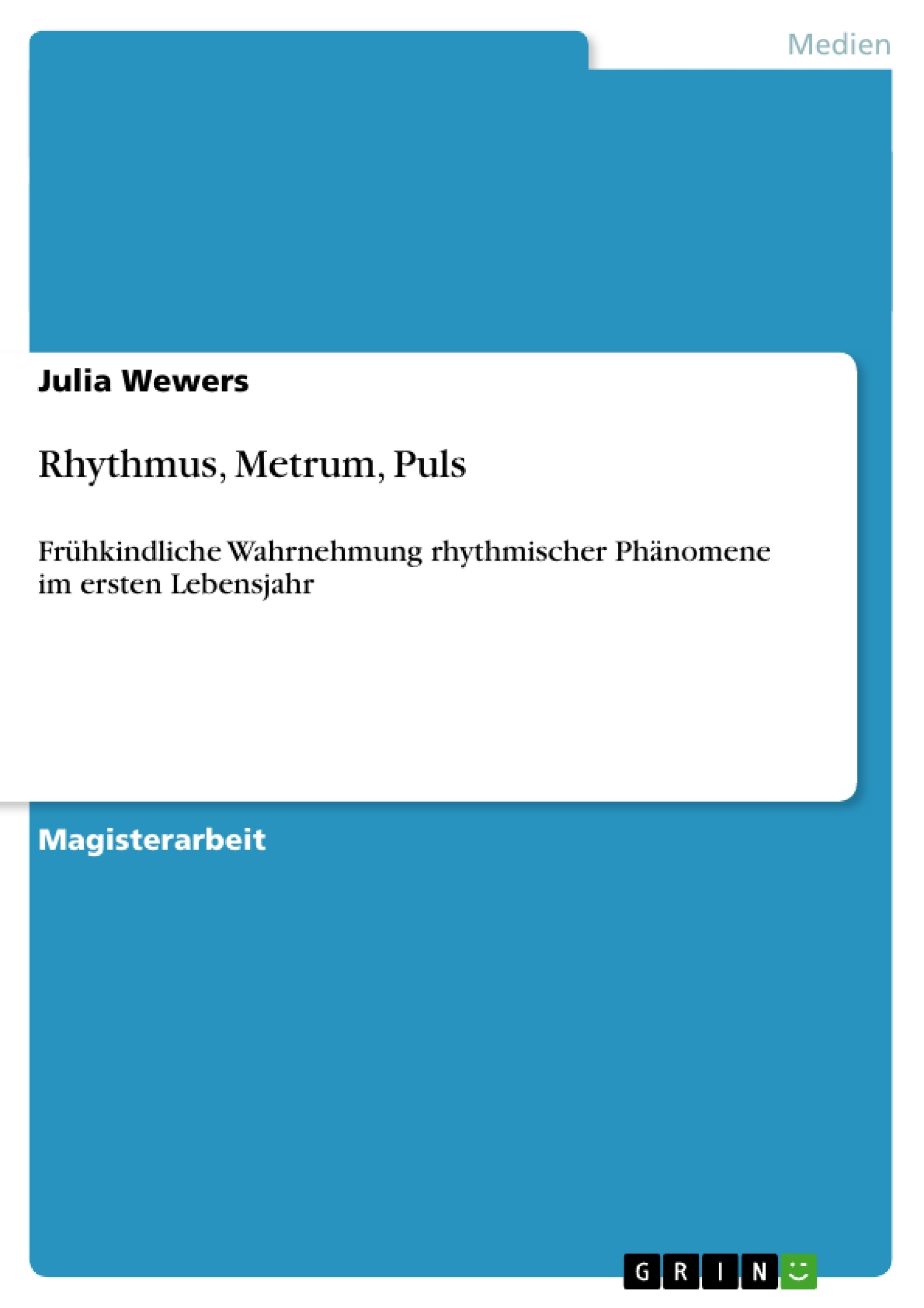Der Großteil musikwissenschaftlicher Forschung geht davon aus, dass Rhythmus, neben Tonhöhe und Lautstärke (bzw. deren Dynamik), ein zentrales Element von Musik ist. Musikhören und Musizieren wirkt ohne jegliche Art von Rhythmus nahezu unmöglich. Dabei scheint Rhythmus nicht nur für die Mehrheit von musikalischem Material grundlegend zu sein, seine Wahrnehmung wird auch als eine allgemeine Fähigkeit der meisten Menschen angenommen. Fast jeder erkennt zum Beispiel implizit, ob ein Musikstück rhythmisch ist oder nicht.
Bis heute gibt es eine Vielzahl von Modellen, Definitionen und Methoden, um der Wahrnehmung, den Umständen und der Art des Auftretens von Rhythmus auf den Grund zu gehen. Die zugrundeliegenden Fragestellungen sind anthropologischer, evolutionärer oder entwicklungspsychologischer Natur und untersuchen, ob Rhythmusempfinden und -produzieren eine Fähigkeit ausschließlich der menschlichen Spezies ist, inwieweit diese Fähigkeit in den Individuen einer Spezies genetisch veranlagt ist oder wie ein Kind rhythmische Fähigkeiten erlernen kann.
Die vorliegende Arbeit soll Antwortmöglichkeiten zu diesen drei Bereichen geben, indem sie Gewicht auf den Aspekt der Angeborenheit legt. Es ist notwendig, dass der Begriff Angeborenheit im Folgenden - da er aus dem englischen innateness übernommen wurde - nicht die Geburt als Beginn der Entwicklung markiert, sondern im Genotyp vorhanden bedeutet und damit das pränatale Stadium eines Individuums mit einschließt. Gegenstand der Analyse ist also ein in diesem Sinne angeborenes Rhythmusvermögen, dessen Ontogenese genauer betrachtet werden soll. Die Untersuchung legt ihren Fokus auf Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, die somit in diesem bestimmten Kontext auf die anderen Gebiete ausgeweitet bzw. durch diesen weiter interpretiert werden können.
Eine Möglichkeit, die in dieser Arbeit diskutiert werden soll, ist, dass das Wahrnehmen von Metrum dem Rhythmusempfinden vorausgeht. Diese Annahme beinhaltet, dass das Erfahren von Metrum eine Basis zum Erlernen weiterer rhythmischer Strukturen darstellt. Der hier zu untersuchende Aspekt ist derjenige einer Prädisposition eines Mechanismus’, der das Wahrnehmen von Metrum ermöglicht. Um sich dieser umfassenden theoretischen Fragestellung nähern zu können, soll der aktuelle Forschungsstand im Bereich Rhythmus- und Metrumwahrnehmung und deren Entwicklung bis zum ersten Lebensjahr eines Kindes dargestellt und im Hinblick auf dessen Ursprünge analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Einleitung und Problemstellung
- 1.2 Grundgedanke und Vorgehen
- 2. Grundbegriffe
- 2.1 Modelle der Abgrenzung
- 2.2 Begriffsdefinitionen
- 2.2.1 Beat, Puls und tactus
- 2.2.2 Rhythmus
- 2.2.3 Metrum
- 2.3 Zwischenbetrachtung
- 3. Metrumwahrnehmung in frühester Kindheit
- 3.1 Theoretische Grundlagen
- 3.1.1 Kognitive Entwicklungspsychologie
- 3.1.2 Der Entwicklungsbegriff
- 3.2 Methoden und Fragestellungen der aktuellen Forschung
- 3.3 Die Entwicklung vom pränatalen Stadium bis zum Ende des 1. Lebensjahres
- 3.3.1 Pränatal
- 3.3.2 Postnatal
- 3.4 Multisensorische Erfahrungen
- 3.5 Angeborenheit und Enkulturation
- 3.6 Die Rolle der Metrumwahrnehmung in der Entwicklung
- 4. Diskussion und Ausblick
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Wahrnehmung von Metrum in der frühen Kindheit, insbesondere im ersten Lebensjahr. Das Hauptziel ist es, die Frage nach der Angeborenheit der Metrumwahrnehmung zu beleuchten und deren Rolle in der Entwicklung rhythmischer Fähigkeiten zu erforschen. Dabei wird der Fokus auf entwicklungspsychologische Erkenntnisse gelegt, um die anthropologischen und evolutionären Aspekte des Themas zu beleuchten.
- Angeborenheit der Metrumwahrnehmung
- Rolle des Metrums im Erlernen rhythmischer Fähigkeiten
- Entwicklung der Metrumwahrnehmung im pränatalen und postnatalen Stadium
- Einfluss multisensorischer Erfahrungen
- Bedeutung von Enkulturation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Angeborenheit der Metrumwahrnehmung und deren Bedeutung für die Entwicklung rhythmischer Fähigkeiten. Es wird die Relevanz des Rhythmus in der Musik und darüber hinaus thematisiert und verschiedene Forschungsansätze aufgezeigt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle des Metrums als Grundlage für das Erlernen rhythmischer Strukturen und untersucht die These, dass die Metrumwahrnehmung eine genetische Prädisposition darstellt, die bereits im pränatalen Stadium vorhanden ist.
2. Grundbegriffe: Dieses Kapitel erläutert grundlegende Begriffe wie Beat, Puls, Tactus, Rhythmus und Metrum. Es werden verschiedene Modelle zur Abgrenzung dieser Begriffe vorgestellt und diskutiert. Der Fokus liegt auf der Klärung der terminologischen Grundlagen, um eine präzise und eindeutige Verwendung der Begriffe im weiteren Verlauf der Arbeit zu gewährleisten. Die verschiedenen Definitionen bilden die Basis für die nachfolgende Analyse der Metrumwahrnehmung.
3. Metrumwahrnehmung in frühester Kindheit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Metrumwahrnehmung in der frühen Kindheit, von der pränatalen Phase bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Es werden theoretische Grundlagen aus der kognitiven Entwicklungspsychologie und aktuelle Forschungsmethoden vorgestellt und diskutiert. Die Entwicklung der Metrumwahrnehmung wird in den verschiedenen Stadien detailliert analysiert, wobei der Einfluss multisensorischer Erfahrungen und der Enkulturation hervorgehoben wird. Es wird die Frage beleuchtet, inwieweit angeborene Mechanismen und kulturelle Einflüsse die Entwicklung der Metrumwahrnehmung prägen.
Schlüsselwörter
Metrumwahrnehmung, Rhythmus, frühe Kindheit, Angeborenheit, Enkulturation, Entwicklungspsychologie, Musik, Kognition, pränatale Entwicklung, postnatal Entwicklung, multisensorische Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Metrumwahrnehmung in der frühen Kindheit
Was ist das Thema dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Wahrnehmung von Metrum in der frühen Kindheit, insbesondere im ersten Lebensjahr. Das Hauptziel ist die Klärung der Frage nach der Angeborenheit der Metrumwahrnehmung und deren Rolle in der Entwicklung rhythmischer Fähigkeiten. Dabei werden entwicklungspsychologische Erkenntnisse genutzt, um anthropologische und evolutionäre Aspekte zu beleuchten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte: die Angeborenheit der Metrumwahrnehmung, die Rolle des Metrums beim Erlernen rhythmischer Fähigkeiten, die Entwicklung der Metrumwahrnehmung im pränatalen und postnatalen Stadium, den Einfluss multisensorischer Erfahrungen und die Bedeutung von Enkulturation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung (mit Einleitung und Problemstellung sowie Grundgedanke und Vorgehen), 2. Grundbegriffe (inkl. Definitionen von Beat, Puls, Tactus, Rhythmus und Metrum), 3. Metrumwahrnehmung in frühester Kindheit (mit theoretischen Grundlagen, aktuellen Forschungsmethoden und Analyse der Entwicklung vom pränatalen Stadium bis zum Ende des 1. Lebensjahres), 4. Diskussion und Ausblick und 5. Zusammenfassung.
Wie werden die Begriffe Beat, Puls, Tactus, Rhythmus und Metrum definiert?
Kapitel 2 erläutert diese Begriffe detailliert und diskutiert verschiedene Modelle zur Abgrenzung. Der Fokus liegt auf der Klärung terminologischer Grundlagen für eine präzise Verwendung der Begriffe in der Arbeit. Die Definitionen bilden die Basis für die Analyse der Metrumwahrnehmung.
Welche Rolle spielt die kognitive Entwicklungspsychologie?
Die kognitive Entwicklungspsychologie liefert die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung der Metrumwahrnehmung in der frühen Kindheit (Kapitel 3). Sie hilft, die Entwicklung der Wahrnehmung im pränatalen und postnatalen Stadium zu verstehen.
Wie wird die Entwicklung der Metrumwahrnehmung im ersten Lebensjahr untersucht?
Kapitel 3 analysiert die Entwicklung der Metrumwahrnehmung detailliert, von der pränatalen Phase bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Dabei werden aktuelle Forschungsmethoden und der Einfluss multisensorischer Erfahrungen und der Enkulturation berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht die These, dass die Metrumwahrnehmung eine genetische Prädisposition ist, die bereits pränatal vorhanden ist. Die Kapitel 4 und 5 bieten eine Diskussion der Ergebnisse und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen sowie eine zusammenfassende Darstellung der zentralen Erkenntnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Metrumwahrnehmung, Rhythmus, frühe Kindheit, Angeborenheit, Enkulturation, Entwicklungspsychologie, Musik, Kognition, pränatale Entwicklung, postnatale Entwicklung, multisensorische Integration.
- Quote paper
- Julia Wewers (Author), 2011, Rhythmus, Metrum, Puls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186995