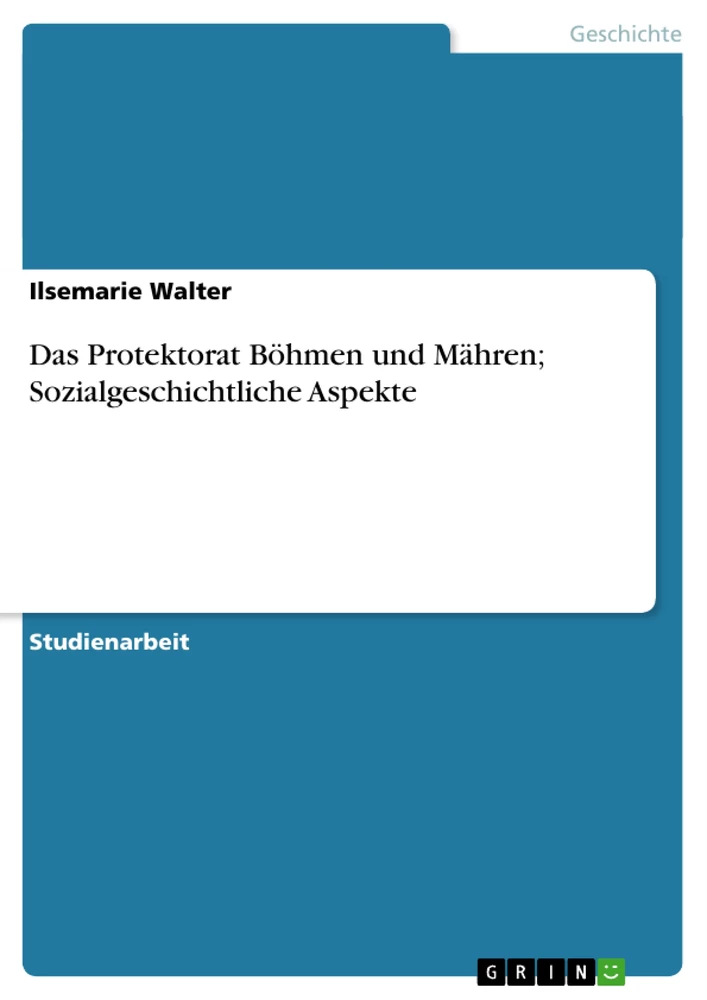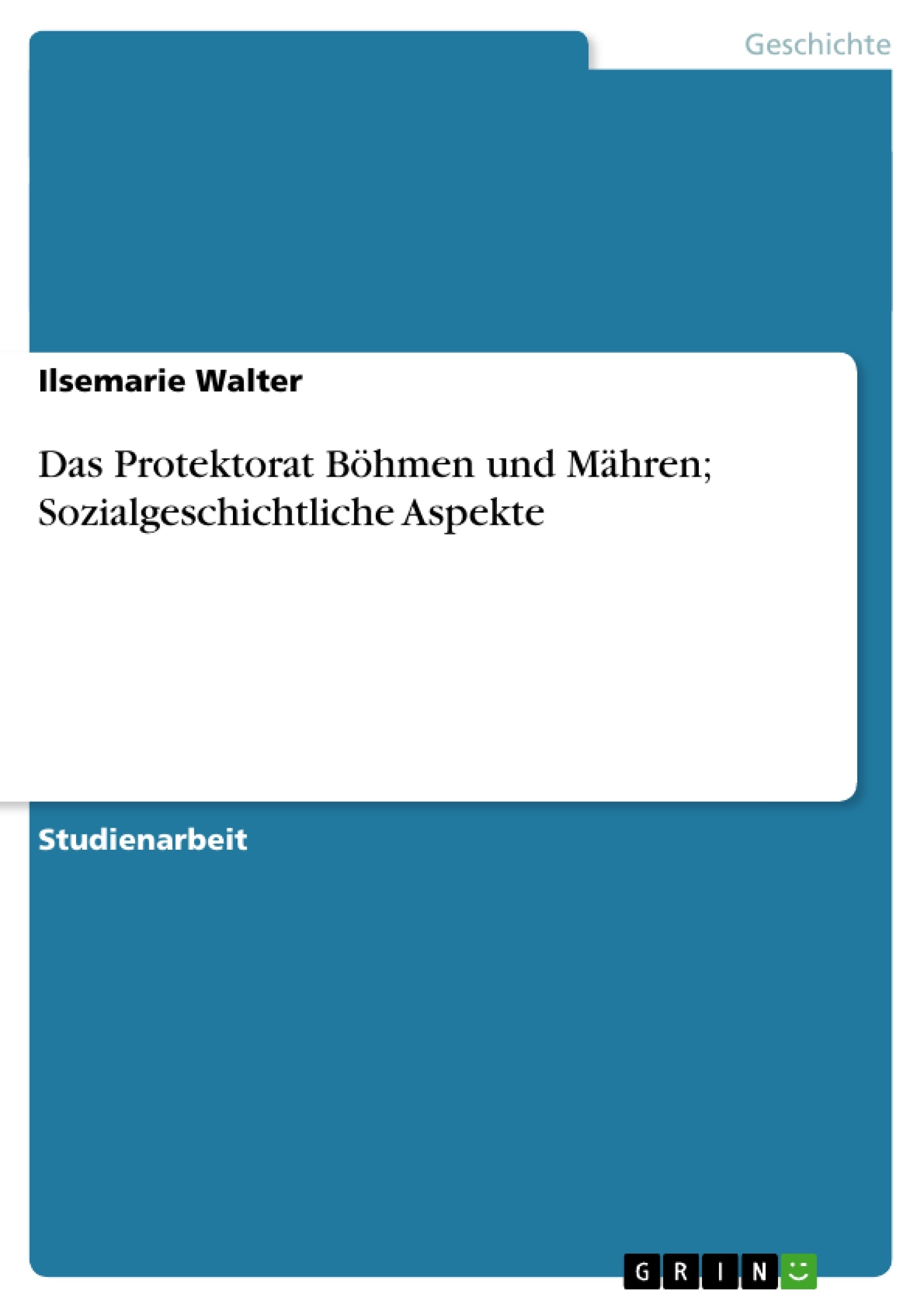Nachdem im „Münchener Abkommen“ vom 29. September 1938 die mehrheitlich von Deutschen bewohnten Grenzgebiete der Tschechoslowakischen Republik Deutschland zugesprochen worden waren, wurden am 15. März 1939 die böhmischen Länder von Deutschland militärisch besetzt und am 16. März das sogenannte „Protektorat Böhmen und Mähren“ errichtet, das dem Deutschen Reich eingegliedert wurde. Die Slowakei hatte sich zwei Tage zuvor als „selbständiger“ Vasallenstaat Deutschlands konstituiert. Nach R. Gebel war die Situation im Protektorat Böhmen und Mähren durch eine „Spannung zwischen Terror und Unterdrückung einerseits und einer fast erstaunlichen Normalität andererseits“ gekennzeichnet. Diese Arbeit geht der Frage nach, wie die große Mehrheit der tschechischen Bevölkerung, die weder im Widerstand war noch kollaborierte, die Zeit des Protektorats erlebt hat.
Da die tschechische Bevölkerung dringend für die Produktion benötigt wurde, waren nicht alle Schichten gleich stark betroffen. Am härtesten trafen die deutschen Maßnahmen die Intellektuellen, während andere Gruppen der Bevölkerung, zum Beispiel Rüstungsarbeiter, eine eher bevorzugte Stellung einnahmen. Nach Unruhen im November 1939 wurden mehr als 1800 tschechische Studenten und Dozenten verhaftet, neun von ihnen ohne Gerichtsurteil erschossen. Alle tschechischen Universitäten und Hochschulen wurden geschlossen. Die tschechischen Zeitungen und Zeitschriften wurden „gleichgeschaltet“ und einer Zensur unterworfen, die mit der Zeit immer unerträglicher wurde. Hunderttausende Einwohner des Protektorats waren zwischen 1939 und 1945 im Arbeitseinsatz im deutschen Reich, zunächst freiwillig, dann immer mehr unter Zwang. Zwangsarbeit gab es aber auch im Protektorat selbst. Viele der Maßnahmen bedeuteten nicht nur eine Einschränkung der Freiheit, sondern verletzten auch das National- und Selbstgefühl der Betroffenen.
Die schwerste Krise durchlebte die Bevölkerung nach dem Attentat auf Heydrich im Juni 1942. Die Angaben über die Zahl der Opfer an Menschenleben unter der nichtjüdischen Bevölkerung des Protektorats bewegen sich zwischen 36.700 und 55.000. Für die jüdische Bevölkerung des Protektorats gab die tschechisch-deutsche Historikerkommission im Jahr 1996 eine Zahl von ca. 78.000 Personen an. Auch die meisten Roma – ca. 6.000 Personen – fielen der NS-Rassenpolitik zum Opfer.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politischer Hintergrund
- Grundsätze der deutschen Besatzungspolitik im Protektorat
- Schulwesen
- Hochschulwesen
- Andere Schulen
- Sprachregelungen
- Literatur, Kunst, Kultur
- Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Bibliotheken
- Theater und Film
- Weitere kulturelle Bereiche
- Schaffung zentraler Stellen zur Überwachung kultureller Angelegenheiten
- Resümee
- Bevölkerungsentwicklung
- Arbeit
- Sinken der Arbeitslosigkeit
- Arbeitseinsatz im Deutschen Reich
- Arbeitserziehungslager
- Versorgungslage während des Krieges
- Situation in der Landwirtschaft
- Furcht vor Germanisierungsmaßnahmen
- Das Schicksal der jüdischen Bevölkerung im Protektorat
- Tschechen und Juden
- Arisierungsmaßnahmen
- Verlust bürgerlicher Rechte
- Vernichtungsmaßnahmen
- Das Schicksal der Roma
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die tschechische Bevölkerung, die weder im Widerstand war noch kollaborierte, die Zeit des Protektorats Böhmen und Mähren erlebte. Im Fokus stehen die sozialen Auswirkungen der deutschen Besatzungspolitik auf den Alltag der Tschechen.
- Analyse des Alltagslebens der tschechischen Bevölkerung unter deutscher Herrschaft
- Untersuchung der Auswirkungen der deutschen Besatzungspolitik auf das Schulwesen, die Kultur und die Bevölkerungsentwicklung
- Beleuchtung der Situation von Juden und Roma im Protektorat
- Einblicke in die verschiedenen Reaktionen der tschechischen Bevölkerung auf die deutsche Besatzung
- Erarbeitung eines tieferen Verständnisses der tschechischen Geschichte während der NS-Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den politischen Hintergrund des Protektorats, indem es die Ereignisse von 1938 bis 1939 zusammenfasst und die wichtigsten Personen der deutschen Besatzungspolitik benennt. Die grundlegenden Prinzipien der deutschen Politik im Protektorat, die Nutzung der tschechischen Bevölkerung für die Rüstungsindustrie und die gleichzeitige „Germanisierung“ des Landes, werden im zweiten Kapitel erläutert. Das dritte Kapitel behandelt das Schulwesen und die Veränderungen, die durch die deutsche Besatzungspolitik eingeleitet wurden. Die Kapitel vier und fünf befassen sich mit der Kultur, den Sprachregelungen, der Bevölkerungsentwicklung und der Arbeitsmarktlage im Protektorat. Die Kapitel sechs und sieben analysieren die Versorgungslage während des Krieges und die Situation in der Landwirtschaft. Das Kapitel acht befasst sich mit der Furcht der tschechischen Bevölkerung vor Germanisierungsmaßnahmen. Die letzten Kapitel beschäftigen sich mit dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung und der Roma im Protektorat, wobei die Verfolgung, die Entrechtung und die Vernichtungsmaßnahmen detailliert dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Protektorat Böhmen und Mähren, deutsche Besatzungspolitik, Sozialgeschichte, tschechische Bevölkerung, Alltag, Schulwesen, Kultur, Bevölkerungsentwicklung, Arbeit, Versorgungslage, Landwirtschaft, Germanisierung, Juden, Roma, Verfolgung, Vernichtung.
- Quote paper
- Ilsemarie Walter (Author), 2000, Das Protektorat Böhmen und Mähren; Sozialgeschichtliche Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18697