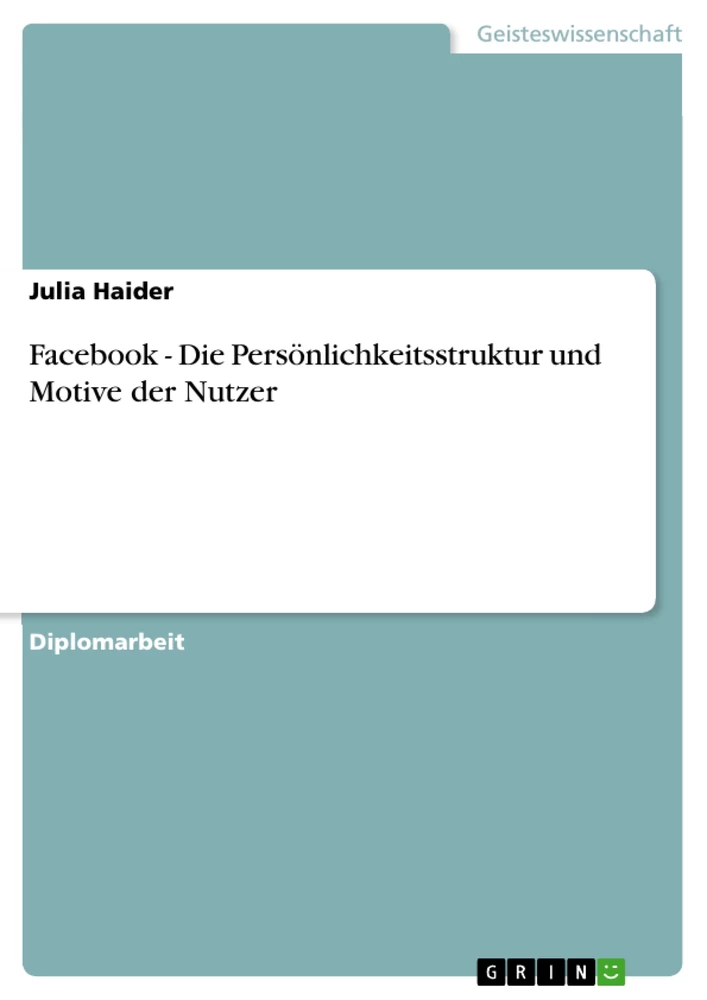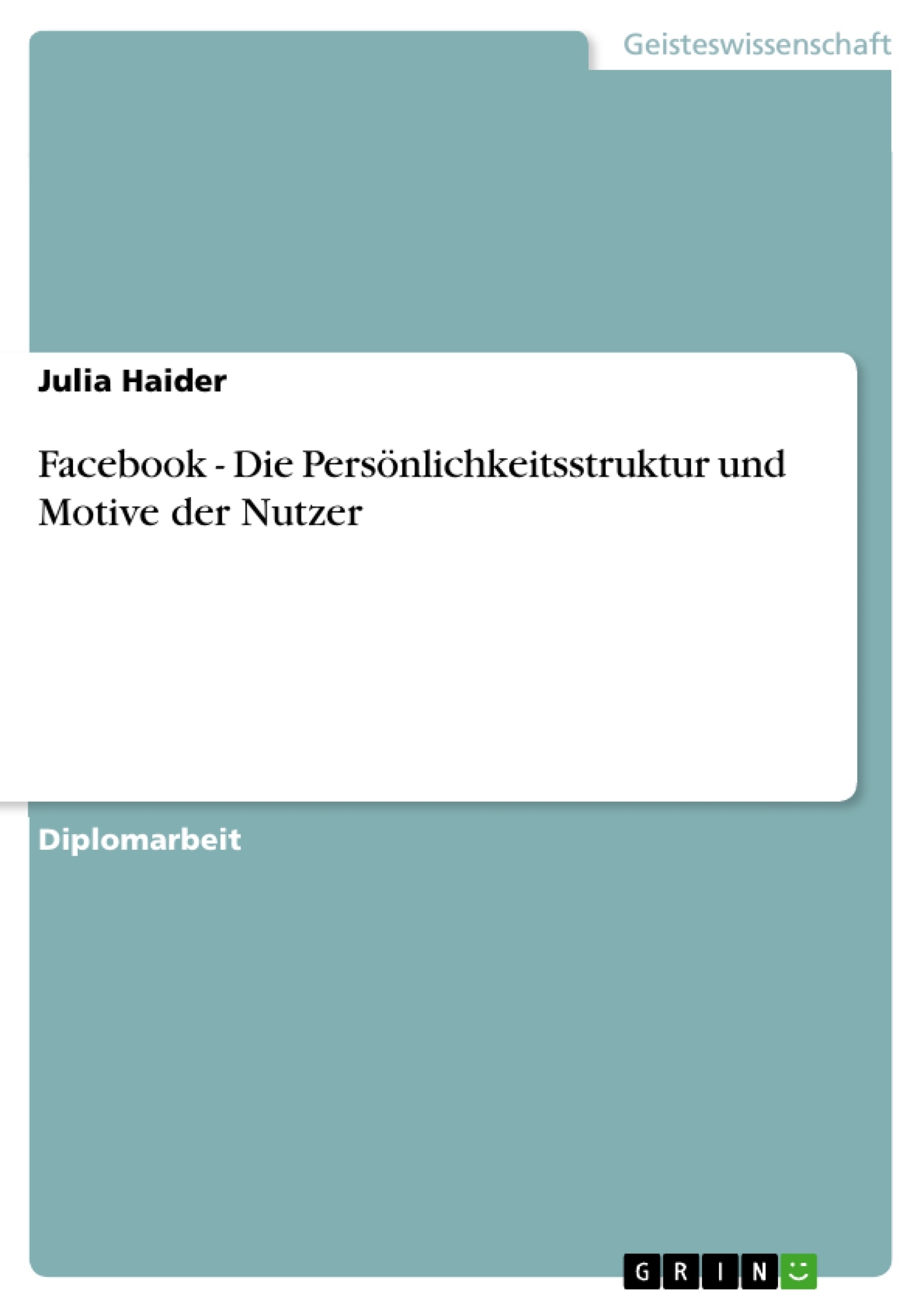:::auszug aus dem ergebnisteil:::
Zwei gegensätzliche Hypothesen, die "Soziale Verstärkungs-" und die "Soziale Kompensationshypothese", beschreiben in der Literatur den Internetnutzer. Diese Studie versuchte die Persönlichkeitsstruktur und die Motive der Facebook Nutzer zu analysieren, bei der 777 Probanden zwischen 16 und 61 Jahren teilnahmen. Beide Hypothesen scheinen ihre Berechtigung zu haben, denn sowohl extravertierte, selbstbewusste als auch introvertierte, weniger selbstbewusste Menschen nutzen Facebook. Nutzer mit einem hohen Selbstwert haben weniger Freunde in ihrer Freundesliste, die sie noch nicht persönlich getroffen haben. Jene mit einem niedrigen Selbstwert scheinen sich ihr soziales Netzwerk eher durch den Gebrauch von sozialen Netzwerkseiten aufzubauen, da diese viele noch nicht persönlich getroffen haben (-> Kompensationshypothese). Als oberstes Motiv zur Partizipation an Facebook steht die Erhaltung des Kontakts mit alten Freunden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziale Netzwerke
- 2.1. Bedeutung sozialer Netzwerke
- 2.2. Sozialkapital
- 2.2.1. Definitionen
- 2.2.2. Starke vs. Schwache Bindungen
- 2.3. Soziale Netzwerke und das Internet
- 3. Soziale Netzwerkseiten
- 3.1. Bedeutung sozialer Netzwerkseiten
- 3.2. Web 2.0
- 3.3. Facebook
- 3.3.1. Daten und Fakten
- 3.3.2. Funktionen
- 3.3.3. Freundschaftsbegriff
- 3.4. Motivationstheorien
- 3.4.1. Bedeutung von Motiven
- 3.4.2. Maslow's Bedürfnispyramide
- 3.4.3. Theorie von Kollock
- 3.4.4. Soziale Verstärkungshypothese
- 3.4.5. Soziale Kompensationshypothese
- 4. Forschungsprojekt
- 4.1. Forschungsfragen und Hypothesen
- 4.2. Methodik
- 4.2.1. Messinstrument
- 4.2.2. Erhobene Konstrukte
- 4.2.2.1. Persönlichkeitsmerkmale
- 4.2.2.2. Selbstkonzept
- 4.2.2.3. Nutzungsintensität Facebooks
- 4.2.2.4. Motive der Nutzung
- 4.2.2.5. Facebook am Mobiltelefon
- 5. Ergebnisse
- 5.1. Beschreibung der Stichprobe
- 5.1.1. Soziodemographische Daten
- 5.1.2. Mitgliedsdauer
- 5.1.3. Anzahl der Facebook Freunde
- 5.1.4. Nutzungsintensität
- 5.1.5. Persönlichkeitsstruktur
- 5.1.6. Kommunikationstools
- 5.1.7. Mobiltelefon Applikation
- 5.2. Prüfung der Hypothesen
- 5.2.1. Extraversion
- 5.2.2. Kontakt- und Umgangsfähigkeit
- 5.2.3. Offenheit für Erfahrungen
- 5.2.4. Selbstwert
- 5.2.5. Neurotizismus
- 5.2.6. Verwendung von Mobiltelefon
- 5.2.7. Motive der Nutzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Persönlichkeitsstruktur und die Motive von Facebook-Nutzern. Ziel ist es, Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkmalen, der Nutzungsintensität und den Gründen für die Facebook-Nutzung aufzudecken.
- Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Facebook-Nutzung
- Motive der Facebook-Nutzung
- Einfluss von soziodemografischen Faktoren
- Analyse der Nutzungsintensität
- Rollen von Sozialkapital und Online-Interaktionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik sozialer Netzwerke und deren Bedeutung ein. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff des Sozialkapitals und die Rolle des Internets in sozialen Netzwerken. Kapitel 3 konzentriert sich auf soziale Netzwerkseiten im Allgemeinen und Facebook im Speziellen, inklusive der Analyse von Motivationstheorien. Kapitel 4 beschreibt das Forschungsprojekt, inklusive Methodik und der Erhebung von Daten zu Persönlichkeitsmerkmalen, Selbstkonzept und Nutzungsintensität von Facebook. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Stichprobenanalyse bezüglich soziodemografischer Daten, Mitgliedsdauer, Anzahl der Freunde, Nutzungsintensität und Persönlichkeitsstruktur.
Schlüsselwörter
Facebook, Soziale Netzwerke, Persönlichkeitsstruktur, Motive, Nutzungsintensität, Sozialkapital, Motivationstheorien, Online-Kommunikation, Empirische Forschung.
- Quote paper
- Mag. Julia Haider (Author), 2011, Facebook - Die Persönlichkeitsstruktur und Motive der Nutzer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186811