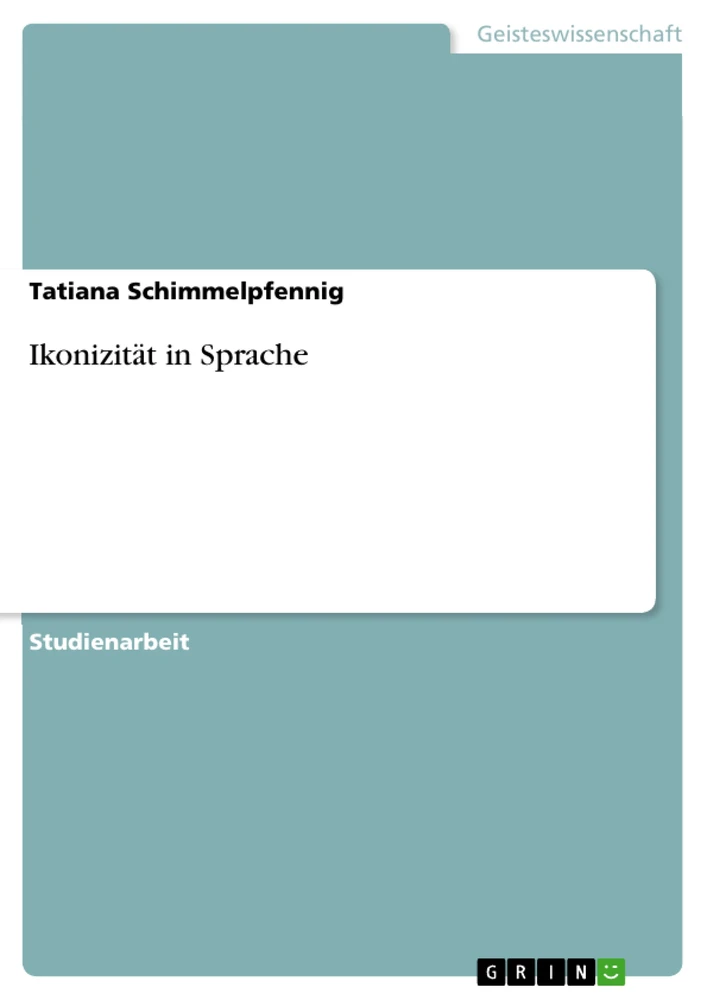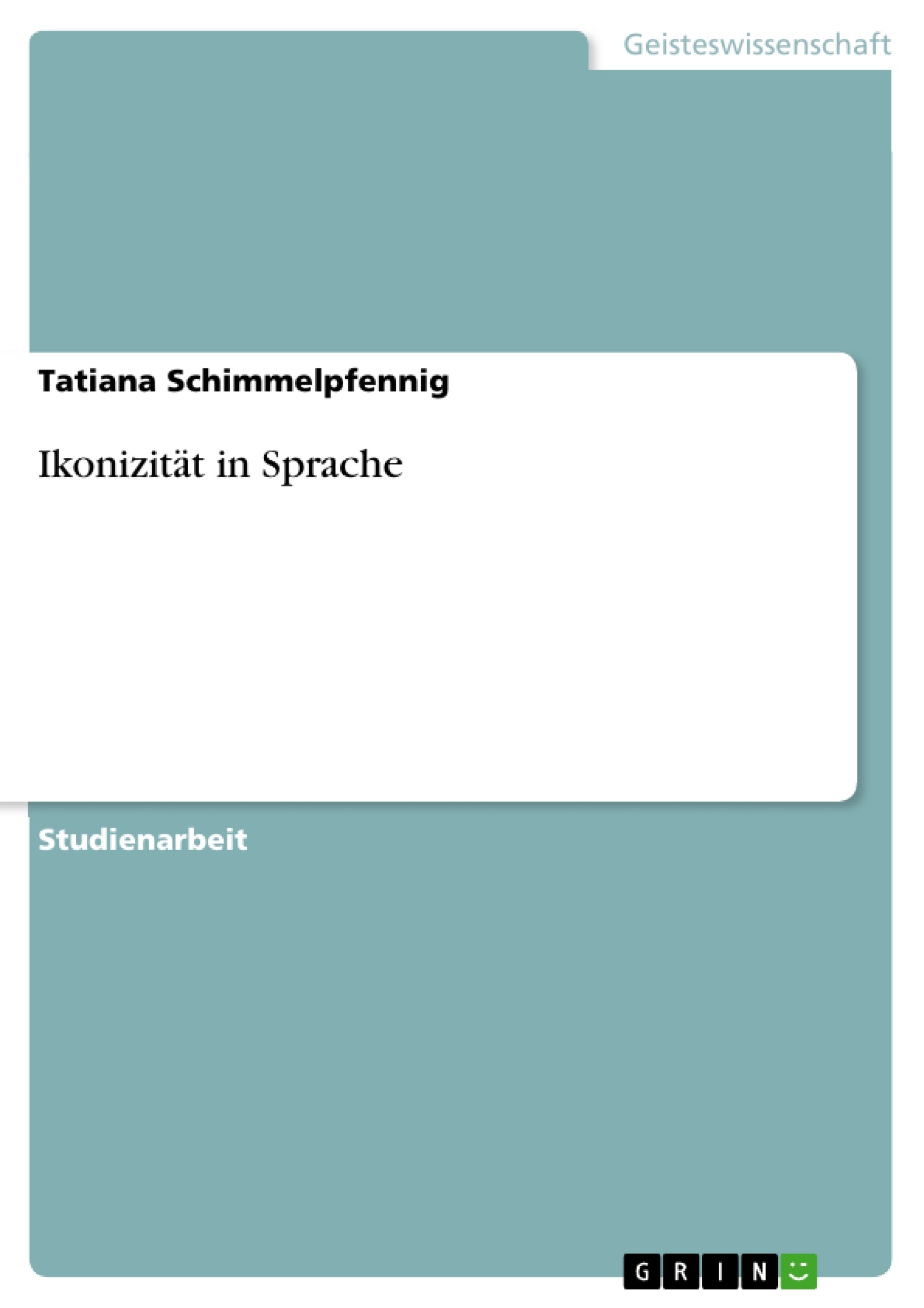Schon in der Antike haben sich Philosophen wie Platon oder Aristoteles über das „Wie“ unseres Denkens Gedanken gemacht.
Wie denken wir die Welt? Im allgemeinen kann erst einmal festgehalten werden, dass wir die Welt in bestimmten Formen denken, welche Zeichen genannt werden. Daraus resultiert ein seit der Antike ungebrochenes Interesse an eben diesen. Die Untersuchung des Zeichens, vornehmlich des sprachlichen Zeichens, könnte uns Aufschlüsse darüber liefern, wie menschliches Denken funktioniert (neben anderen wesentlich neuzeitlicheren Disziplinen wie beispielsweise Soziolinguistik oder Neurolinguistik).
Mit der kognitiven Linguistik betreten wir nun einen der jüngeren Zweige zur Untersuchung des sprachlichen Zeichens, welche die Verbindung zwischen Kognition und Sprachwissenschaft untersuchen möchte.
Diese wiederum erfindet nun keine komplett neuen Theorien über den Zusammenhang von sprachlichen Zeichen und seinen Verwendern. Vielmehr baut sie diese aus, verfeinert, differenziert und selektiert.
Im Bereich der Semiotik hat sich in den letzten 3 Jahrzehnten ein größer werdendes Interesse hinsichtlich der Natürlichkeit des sprachlichen Zeichens entwickelt, welches die Bildhaftigkeit oder vielmehr die Ikonizität von Sprache zum Mittelpunkt hat und das „Dogma der Arbitrarität“ Saussures, wie es Roman Jakobson (Fischer 2001, S.1) formuliert hat, aufzuweichen erachtet. Damit entbrennt aufs Neue der uralte Streit um die Willkürlichkeit oder Nicht-Willkürlichkeit sprachlicher Zeichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Charles S. Peirces Kategorienlehre
- Charles S. Peirces Zeichentheorie
- Ikone
- Zusammenfassung
- Ikonizität
- Symmetrie – ein Beitrag von John Haiman
- On natural motivation in metaphors – ein Beitrag von Ralf Norrman
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ikonizität in Sprache, ausgehend von Charles Sanders Peirces semiotischem Ansatz. Ziel ist es, Peirces Zeichentheorie und Kategorienlehre zu erläutern und verschiedene Modelle zur Untersuchung von Ikonizität vorzustellen. Die Arbeit beleuchtet den Diskurs um die Arbitrarität sprachlicher Zeichen und analysiert Beiträge zur ikonischen Symmetrie von Sätzen und zur natürlichen Motiviertheit von Metaphern.
- Peirces Kategorienlehre und Zeichentheorie
- Der Begriff der Ikonizität und dessen Klassifizierung
- Ikonische Symmetrie in Sätzen
- Natürliche Motiviertheit in Metaphern
- Der Gegensatz zwischen Arbitrarität und Natürlichkeit sprachlicher Zeichen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Ikonizität in Sprache ein und beleuchtet den historischen Kontext der Auseinandersetzung mit dem sprachlichen Zeichen. Sie skizziert den Ansatz der kognitiven Linguistik und das wachsende Interesse an der Natürlichkeit sprachlicher Zeichen im Gegensatz zum Saussureschen Dogma der Arbitrarität. Die Arbeit kündigt die Erläuterung von Peirces Zeichentheorie und die Vorstellung verschiedener Modelle zur Untersuchung der Ikonizität an.
Charles S. Peirces Kategorienlehre: Dieses Kapitel umreißt Peirces Kategorienlehre, wobei die Schwierigkeiten der Rezeption seiner Schriften aufgrund von späten Veröffentlichungen und inkonsistenten Definitionen hervorgehoben werden. Es beschreibt Peirces drei Schlussweisen (Induktion, Deduktion, Retroduktion) und die drei Kategorien: Erstheit (Qualität), Zweitheit (Relation) und Drittheit (Repräsentation). Die Kapitel erläutert detailliert die Eigenschaften jeder Kategorie und deren Zusammenspiel in triadischen Relationen. Das Beispiel der Farbe Blau verdeutlicht die Unterscheidung zwischen Erstheit (reine Empfindung) und Zweitheit (Relation zwischen Empfindung und Bezeichnung).
Charles S. Peirces Zeichentheorie: Aufbauend auf der Kategorienlehre wird hier Peirces Zeichentheorie vorgestellt. Das sprachliche Zeichen wird als triadische Relation von Repräsentamen, Objekt und Interpretant beschrieben. Der Interpretant wird als Auswahl semantischer Eigenheiten des Objekts verstanden, die durch das Repräsentamen repräsentiert werden. Das Kapitel veranschaulicht die triadische Beziehung und unterstreicht ihre Bedeutung für das Verständnis sprachlicher Zeichen.
Schlüsselwörter
Ikonizität, Sprache, Charles Sanders Peirce, Semiotik, Zeichentheorie, Kategorienlehre, Arbitrarität, Natürlichkeit, kognitive Linguistik, Symmetrie, Metapher.
Häufig gestellte Fragen zu: Ikonizität in Sprache - Ein semiotischer Ansatz nach Charles Sanders Peirce
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ikonizität in Sprache, basierend auf Charles Sanders Peirces semiotischem Ansatz. Sie beleuchtet den Diskurs um die Arbitrarität sprachlicher Zeichen und analysiert verschiedene Modelle zur Untersuchung von Ikonizität, darunter ikonische Symmetrie von Sätzen und die natürliche Motiviertheit von Metaphern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Peirces Kategorienlehre und Zeichentheorie, den Begriff der Ikonizität und dessen Klassifizierung, ikonische Symmetrie in Sätzen, natürliche Motiviertheit in Metaphern und den Gegensatz zwischen Arbitrarität und Natürlichkeit sprachlicher Zeichen. Sie beinhaltet auch eine Einordnung in den Kontext der kognitiven Linguistik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Peirces Kategorienlehre, Peirces Zeichentheorie, einer detaillierten Erläuterung des Begriffs "Ikone" sowie Beiträgen zu ikonischer Symmetrie (John Haiman) und natürlicher Motiviertheit von Metaphern (Ralf Norrman). Zusätzlich beinhaltet sie eine Einleitung, eine Zusammenfassung und eine Schlussbemerkung.
Was sind Peirces drei Kategorien?
Peirce unterscheidet drei Kategorien: Erstheit (Qualität), Zweitheit (Relation) und Drittheit (Repräsentation). Diese Kategorien bilden die Grundlage seiner Zeichentheorie und werden in der Arbeit detailliert erläutert, anhand von Beispielen wie der Farbe Blau, die die Unterscheidung zwischen Erstheit (reine Empfindung) und Zweitheit (Relation zwischen Empfindung und Bezeichnung) verdeutlicht.
Wie beschreibt Peirce das sprachliche Zeichen?
Peirce beschreibt das sprachliche Zeichen als triadische Relation von Repräsentamen, Objekt und Interpretant. Der Interpretant wird als Auswahl semantischer Eigenheiten des Objekts verstanden, die durch das Repräsentamen repräsentiert werden. Diese triadische Beziehung ist zentral für das Verständnis sprachlicher Zeichen nach Peirce.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Ikonizität, Sprache, Charles Sanders Peirce, Semiotik, Zeichentheorie, Kategorienlehre, Arbitrarität, Natürlichkeit, kognitive Linguistik, Symmetrie und Metapher.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, Peirces Zeichentheorie und Kategorienlehre zu erläutern und verschiedene Modelle zur Untersuchung von Ikonizität vorzustellen, um so ein tieferes Verständnis der Beziehung zwischen Form und Bedeutung in Sprache zu erreichen und den Gegensatz zwischen Arbitrarität und Natürlichkeit sprachlicher Zeichen zu analysieren.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich explizit auf Charles Sanders Peirce, John Haiman und Ralf Norrman, deren Beiträge zur Ikonizität und der Semiotik diskutiert werden.
- Arbeit zitieren
- Tatiana Schimmelpfennig (Autor:in), 2004, Ikonizität in Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186777