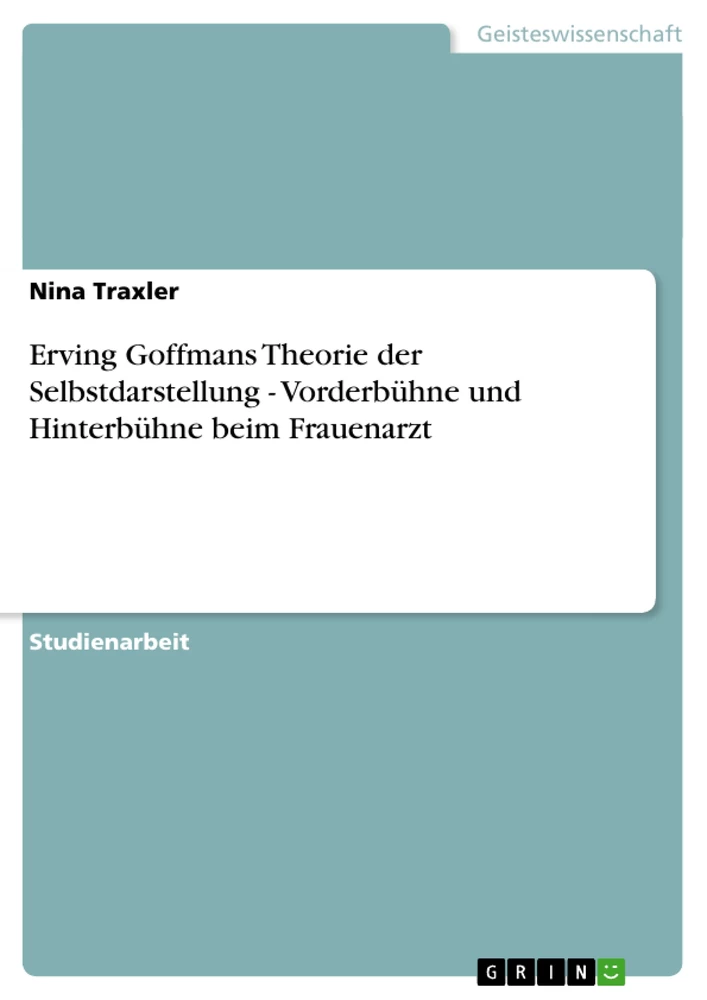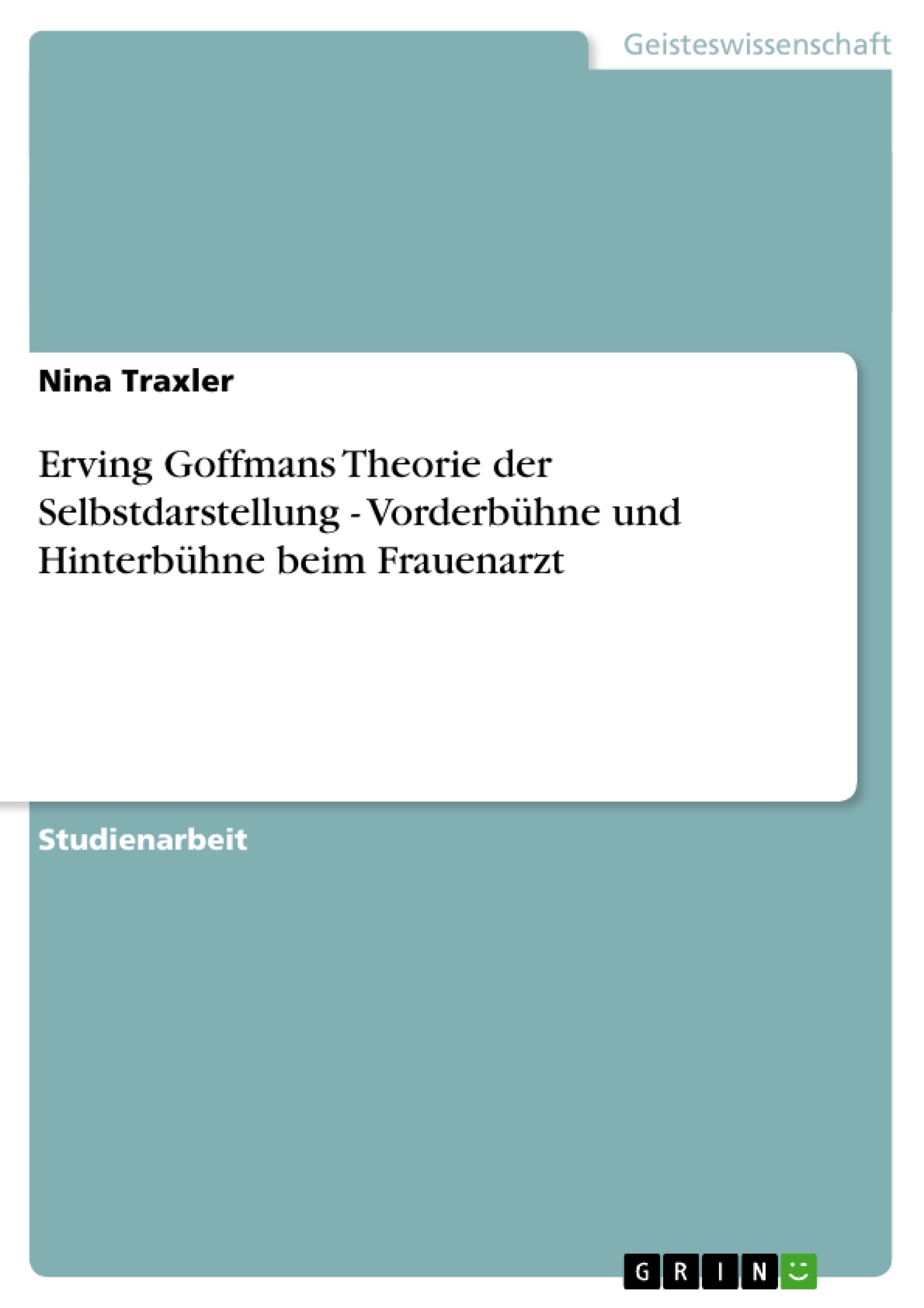Das Hauptziel dieser Arbeit soll eine knappe Darstellung des dramaturgischen
Ansatzes von Erving Goffman sein. Darauf aufbauend wird anhand eines Beispiels
gezeigt werden, wie sein Modell zur Analyse von sozialen Situationen eingesetzt
werden kann. Dabei wird auch (zwar relativ unsystematisch) versucht werden, den
systemtheoretischen Ansatz Niklas Luhmanns als Ergänzung und Kontrastfolie
heranzuziehen.
Erving Goffman präsentierte seinen dramaturgischen Ansatz mit Theorie der Vorderund
Hinterbühnen erstmals 1959 in dem Buch „The Presentation of Self in Everyday
Life“ und Goffman steht theoretisch verankert zwischen dem symbolischen
Interaktionismus und der Ethnomethodologie 1.Er bezeichnet seine Ansatz selbst als
Soziologie der Gelegenheiten 2 Grundthese seines dramaturgischen Ansatzes ist die,
dass wir alle Rollen auf Bühnen spielen. Deshalb beantwortet er die Frage nach dem
Funktionieren der Gesellschaft so:
„Die soziale Welt ist eine Bühne, eine komplizierte Bühne sogar, mit Publikum,
Darstellern und Außenseitern, mit Zuschauerraum und Kulissen, und mit manchen
Eigentümlichkeiten, die dann das Schauspiel dann doch nicht kennt.“3
1 Vgl.: Richter Rudolf:Verstehende Soziologie, 2002, S. 83
2 vgl.: Erving Goffman: Interaktionsrituale, S. 8,
3 Dahrendorf Ralf: Vorwort in Wir alle spielen Theater, 2003
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Situationsdefinition
- Vorderbühne/Hinterbühne
- Elemente der Selbstdarstellung
- Das Ensemble
- Takt als Technik der Eindrucksmanipulation
- Beispiel: Besuch beim Frauenarzt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, den dramaturgischen Ansatz von Erving Goffman kurz darzustellen und anhand eines Beispiels seine Anwendbarkeit auf soziale Situationen zu demonstrieren. Dabei wird auch die systemtheoretische Perspektive von Niklas Luhmann als Ergänzung und Kontrastfolie betrachtet.
- Die dramaturgische Perspektive Goffmans
- Die Rolle von Vorder- und Hinterbühne in sozialen Interaktionen
- Die Bedeutung von Eindrucksmanagement und Selbstdarstellung
- Die Anwendung des Goffmanschen Modells auf das Beispiel eines Frauenarztbesuchs
- Der Vergleich und die Ergänzung des Goffmanschen Ansatzes durch die Systemtheorie Luhmanns
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung skizziert das Hauptziel der Arbeit, nämlich Goffmans dramaturgischen Ansatz zu erläutern und anhand eines Beispiels seine Anwendung zu demonstrieren. Sie stellt auch den Bezug zur systemtheoretischen Perspektive von Niklas Luhmann her.
- Situationsdefinition: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Situationen in Goffmans soziologischer Analyse. Es erklärt den Begriff des "primary frameworks" und die Unterscheidung zwischen "natural frameworks" und "social frameworks".
- Vorderbühne/Hinterbühne: Hier wird Goffmans Kernkonzept der Vorder- und Hinterbühne vorgestellt. Es wird erläutert, wie wir in verschiedenen Situationen unterschiedliche Rollen einnehmen und unser Selbst bewusst inszenieren.
- Elemente der Selbstdarstellung: Dieses Kapitel analysiert die Elemente, die bei der Selbstdarstellung eine Rolle spielen, wie z.B. Kleidung, Mimik und Körperhaltung. Es wird die Unterscheidung zwischen "Ausdruck, den man sich selbst gibt" und "Ausdruck, den man ausstrahlt" erläutert.
- Das Ensemble: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von "Ensembles" in Goffmans Theorie, also Gruppen von Personen, die gemeinsam an einer Inszenierung arbeiten.
- Takt als Technik der Eindrucksmanipulation: Hier wird der Begriff des "Takts" im Sinne Goffmans erläutert. Takt beschreibt die Fähigkeit, Eindrücke gezielt zu manipulieren und soziale Situationen zu steuern.
- Beispiel: Besuch beim Frauenarzt: Dieses Kapitel zeigt die Anwendung des Goffmanschen Modells auf das Beispiel eines Frauenarztbesuchs. Es analysiert die Vorder- und Hinterbühne-Situation und die Rolle des Eindrucksmanagements in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Selbstdarstellung, Vorderbühne, Hinterbühne, Eindrucksmanagement, soziale Situation, Interaktion, Rolle, Ensemble, Takt, Goffman, Luhmann, Systemtheorie, symbolischer Interaktionismus, Ethnomethodologie.
- Quote paper
- Mag. Nina Traxler (Author), 2003, Erving Goffmans Theorie der Selbstdarstellung - Vorderbühne und Hinterbühne beim Frauenarzt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18676