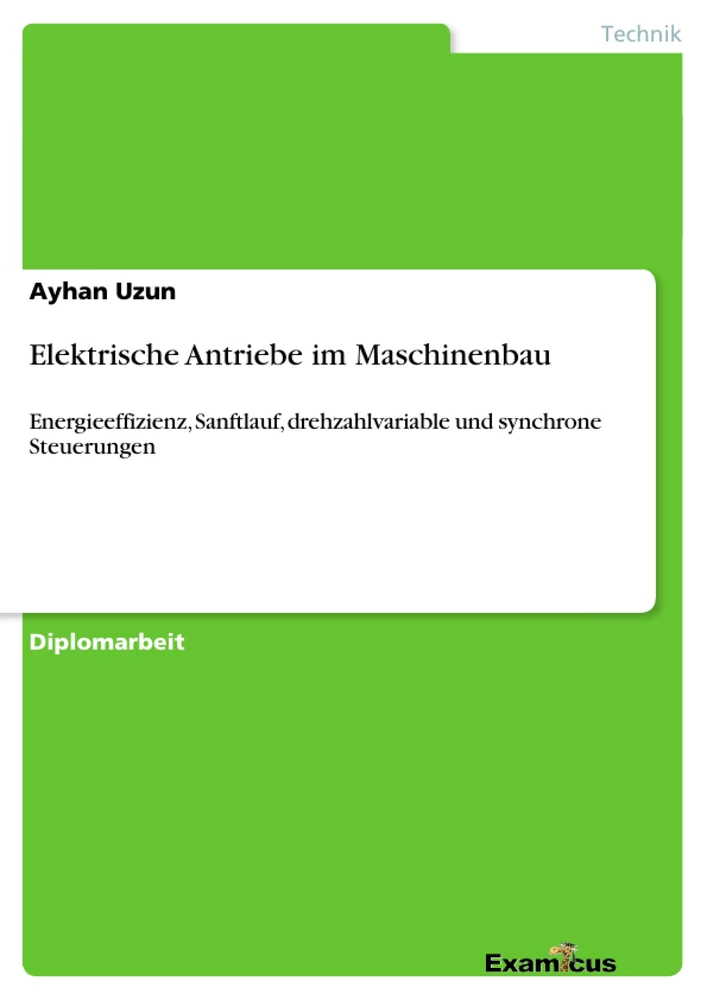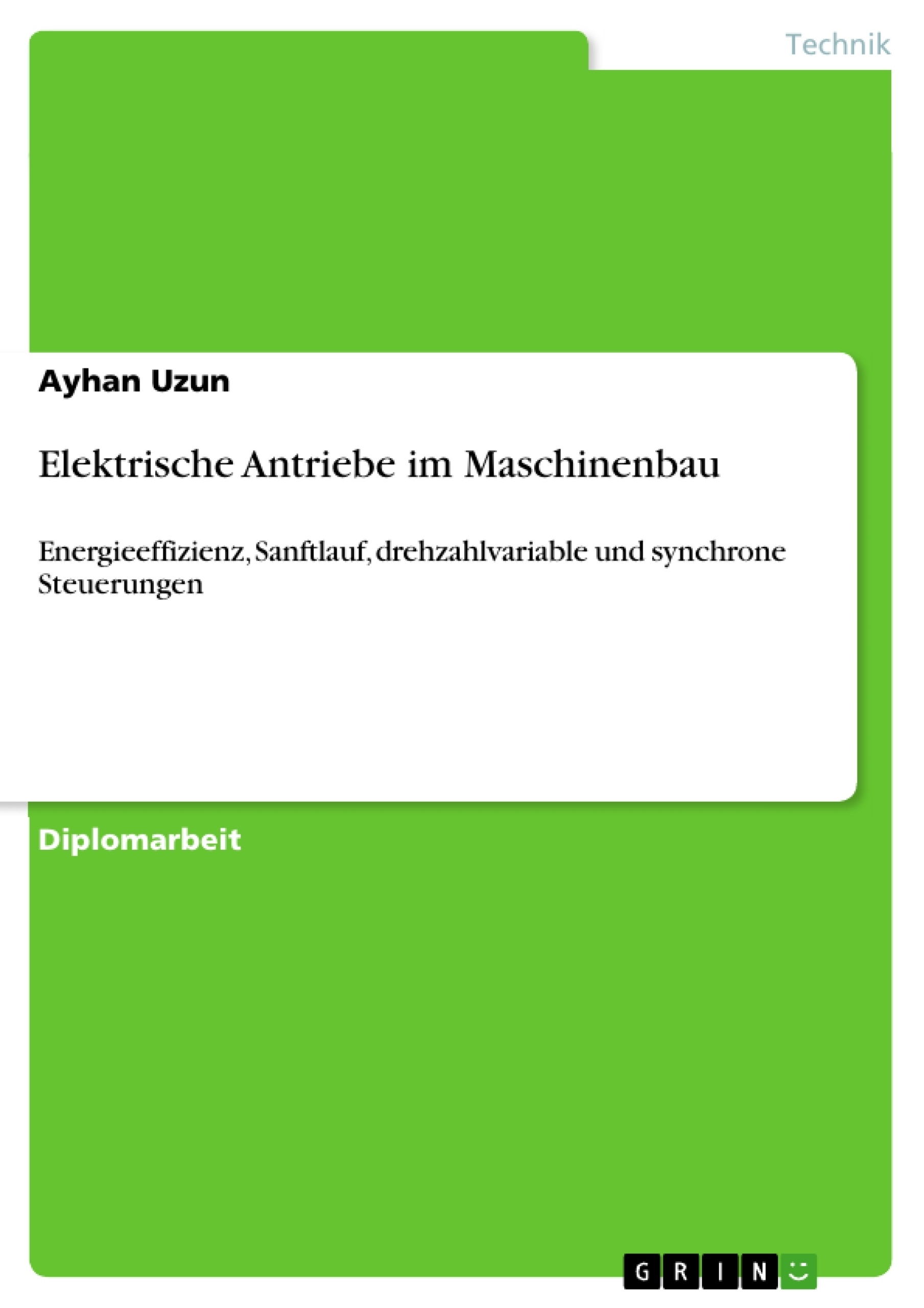Elektrische Antriebe sind heute wichtige und bestimmende Komponenten vieler Maschinen und Anlagen. Dabei teilen sich die Antriebe in verschiedene Varianten auf. Zu einem hohen Prozentsatz (80%) sind es einfache Antriebe mit festen Betriebsdrehzahlen. Immer häufiger nehmen jedoch die anspruchsvolleren Antriebe zu, die in weiten Bereichen drehzahlvariabel arbeiten. Der Markt fordert kostengünstige, robuste und wartungsarme Lösungen. Dadurch wurde der bewährte Gleichstromantrieb bei Neukonstruktionen im betrachteten Leistungsbereich zu Gunsten des Drehstromantriebs weitgehend verdrängt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen der Asynchronmaschinen
- 1.1 Stand der Technik und Marktsituation
- 1.2 Wirkungsweise und Aufbau
- 1.2.1 Bauarten
- 1.2.2 Bauformen
- 1.2.3 Motorkonfigurationen
- 1.2.4 Baugrößen (Achshöhe und Baulänge)
- 1.3 Motorkühlung und Motorschutz
- 1.4 Betriebsverhalten und Kenngrößen
- 1.5 Herstellerneutrale Motortabelle
- 1.6 Wachstumsgesetze
- 2 An- und Auslaufsteuerungen von Asynchronmaschinen
- 2.1 Zeitkonstanten bei Antrieben
- 2.2 Anlaufverfahren - Konventioneller Betrieb (ohne Elektronik)
- 2.3 Konventionelle elektrische Anlaufverfahren (Hochlauf)
- 2.4 Sanftanlasser
- 2.5 Schweranlauf mit Anlaufkupplung
- 2.6 Bremsschaltungen
- 2.7 Dimensionierung von Antriebsmaschinen
- 3 Drehzahlvariable Asynchronmaschinen
- 3.1 Änderung der Polpaarzahl
- 3.2 Vergrößerung des Schlupfes (Schlupfsteuerung)
- 3.3 Spannungsabsenkung bei Wechselstrombetrieb
- 3.4 Drehzahlvariabler Betrieb mit Leistungselektronik
- 3.5 Bewegungssteuerungen und Synchronlauf (Motion Control)
- 3.6 Dimensionierung drehzahlvariabler Asynchronmaschinen
- 3.7 Demag Antriebsauslegungsprogramm Caldrive
- 4 Energieeffiziente Asynchronmaschinen
- 4.1 Motoren für die EU-Motorwirkungsgradklassen
- 4.2 Möglichkeiten der Energieeinsparung
- 4.3 Amortisationszeit
- 4.4 Kriterien für den Einsatz von Energiesparmotoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht elektrische Antriebe im Maschinenbau mit Fokus auf Energieeffizienz, Sanftlauf, drehzahlvariable und synchrone Steuerungen. Ziel ist die umfassende Darstellung des aktuellen Standes der Technik in diesen Bereichen.
- Stand der Technik verschiedener Elektromotoren und deren Konfigurationen
- Anlaufsteuerungen und Sanftanlaufverfahren
- Drehzahlvariable Antriebe und deren Steuerung
- Energieeffiziente Motoren und deren Amortisation
- Herstellerneutrale Motortabelle
Zusammenfassung der Kapitel
1 Grundlagen der Asynchronmaschinen: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die gesamte Arbeit, indem es den Stand der Technik und die Marktsituation von Asynchronmaschinen beschreibt. Es erläutert detailliert Wirkungsweise, Aufbau und verschiedene Bauarten, Bauformen und Motorkonfigurationen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Erstellung einer herstellerneutralen Motortabelle, die auf der Auswertung von Fachliteratur und Herstellerangaben basiert. Die Kapitel beschäftigt sich auch mit Motorkühlung, Motorschutz, Betriebsverhalten und wichtigen Kenngrößen wie Drehzahl, Drehmoment, Leistung, Verluste und Wirkungsgrad. Die Einarbeitung von Normen und Toleranzen unterstreicht die wissenschaftliche Genauigkeit.
2 An- und Auslaufsteuerungen von Asynchronmaschinen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen An- und Auslaufsteuerungen für Asynchronmaschinen. Es beginnt mit der Erläuterung der relevanten Zeitkonstanten und Übergangsvorgänge. Anschließend werden konventionelle Anlaufverfahren (ohne und mit Elektronik), wie z.B. Stern-Dreieck-Anlauf, Anlaufwiderstände und Anlasstransformatoren, detailliert beschrieben. Ein Schwerpunkt liegt auf Sanftanlassern und deren Aufbau und Funktionsweise sowie auf Schweranlaufverfahren mit Anlaufkupplungen. Schließlich werden verschiedene Bremsschaltungen (Generatorbetrieb, Gegenstrom- und Gleichstrombremsen) erläutert. Das Kapitel schließt mit der Dimensionierung von Antriebsmaschinen, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lastmomente und der Stabilität des Arbeitspunktes.
3 Drehzahlvariable Asynchronmaschinen: Das Kapitel behandelt verschiedene Verfahren zur Drehzahlregelung von Asynchronmaschinen. Es werden Methoden wie die Änderung der Polpaarzahl (getrennte Wicklungen, Dahlanderschaltung, PAM), die Vergrößerung des Schlupfes und die Spannungsabsenkung diskutiert. Ein umfangreicher Abschnitt widmet sich dem drehzahlvariablen Betrieb mit Leistungselektronik (Stromrichter, Drehstromsteller, Frequenzumrichter). Es werden unterschiedliche Steuer- und Regelverfahren, insbesondere die U/f-Kennliniensteuerung und die feldorientierte Regelung (FOR), erläutert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Bewegungssteuerungen und Synchronlauf (Motion Control) mit Beispielen aus der Praxis (Abfüllanlagen, Zugregelung, Verpackungsmaschinen etc.). Die Dimensionierung drehzahlvariabler Asynchronmaschinen und die Vorstellung des Demag Antriebsauslegungsprogramms Caldrive runden das Kapitel ab.
4 Energieeffiziente Asynchronmaschinen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf energieeffiziente Asynchronmaschinen und deren Bedeutung im Maschinenbau. Es beschreibt die EU-Motorwirkungsgradklassen und diskutiert verschiedene Möglichkeiten der Energieeinsparung, wie die Reduzierung einzelner Verluste und die optimale Ausnutzung der Drehzahlregelung. Ein wichtiger Aspekt ist die Berechnung der Amortisationszeit für den Einsatz von Energiesparmotoren, einschließlich der Vorstellung geeigneter Software. Abschließend werden Kriterien für den Einsatz von Energiesparmotoren in verschiedenen Anwendungsfällen zusammenfassend erläutert.
Schlüsselwörter
Asynchronmaschine, Elektromotor, Energieeffizienz, Sanftanlauf, Drehzahlregelung, Frequenzumrichter, Leistungselektronik, Motion Control, Energiesparmotor, Anlaufsteuerung, Dimensionierung, Herstellerneutrale Motortabelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Diplomarbeit über Elektrische Antriebe im Maschinenbau
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich umfassend mit elektrischen Antrieben im Maschinenbau, insbesondere Asynchronmaschinen. Sie untersucht Themen wie Energieeffizienz, Sanftlauf, drehzahlvariable und synchrone Steuerungen und liefert einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Grundlagen der Asynchronmaschinen, 2. An- und Auslaufsteuerungen von Asynchronmaschinen, 3. Drehzahlvariable Asynchronmaschinen und 4. Energieeffiziente Asynchronmaschinen. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte von Asynchronmaschinen und deren Steuerung.
Was wird im Kapitel "Grundlagen der Asynchronmaschinen" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Stand der Technik und die Marktsituation von Asynchronmaschinen. Es erklärt detailliert Wirkungsweise, Aufbau und verschiedene Bauarten, Bauformen und Motorkonfigurationen. Es beinhaltet eine herstellerneutrale Motortabelle und behandelt Motorkühlung, Motorschutz, Betriebsverhalten und wichtige Kenngrößen.
Was sind die Schwerpunkte des Kapitels "An- und Auslaufsteuerungen von Asynchronmaschinen"?
Dieses Kapitel behandelt verschiedene An- und Auslaufsteuerungen, einschließlich konventioneller Verfahren (mit und ohne Elektronik), Sanftanlasser, Schweranlaufverfahren mit Anlaufkupplungen und Bremsschaltungen. Die Dimensionierung von Antriebsmaschinen wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Methoden der Drehzahlregelung werden im Kapitel "Drehzahlvariable Asynchronmaschinen" diskutiert?
Das Kapitel beschreibt Methoden wie die Änderung der Polpaarzahl, die Vergrößerung des Schlupfes, die Spannungsabsenkung und den drehzahlvariablen Betrieb mit Leistungselektronik (Frequenzumrichter). Es behandelt Steuer- und Regelverfahren (U/f-Kennliniensteuerung, feldorientierte Regelung) und Bewegungssteuerungen (Motion Control).
Was wird im Kapitel "Energieeffiziente Asynchronmaschinen" behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf energieeffiziente Asynchronmaschinen, die EU-Motorwirkungsgradklassen, Möglichkeiten der Energieeinsparung, die Amortisationszeit von Energiesparmotoren und Kriterien für deren Einsatz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Asynchronmaschine, Elektromotor, Energieeffizienz, Sanftanlauf, Drehzahlregelung, Frequenzumrichter, Leistungselektronik, Motion Control, Energiesparmotor, Anlaufsteuerung, Dimensionierung, herstellerneutrale Motortabelle.
Gibt es eine herstellerneutrale Motortabelle?
Ja, die Arbeit enthält eine herstellerneutrale Motortabelle, die auf der Auswertung von Fachliteratur und Herstellerangaben basiert.
Welche Software wird im Zusammenhang mit der Amortisationszeit von Energiesparmotoren erwähnt?
Die Arbeit erwähnt die Verwendung geeigneter Software zur Berechnung der Amortisationszeit, nennt aber keinen konkreten Namen.
Welche Beispiele aus der Praxis werden im Kapitel über drehzahlvariable Asynchronmaschinen genannt?
Beispiele aus der Praxis im Kapitel über drehzahlvariable Antriebe umfassen Abfüllanlagen, Zugregelung und Verpackungsmaschinen.
- Citation du texte
- Dipl.-Ing.(FH) Ayhan Uzun (Auteur), 2008, Elektrische Antriebe im Maschinenbau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186564