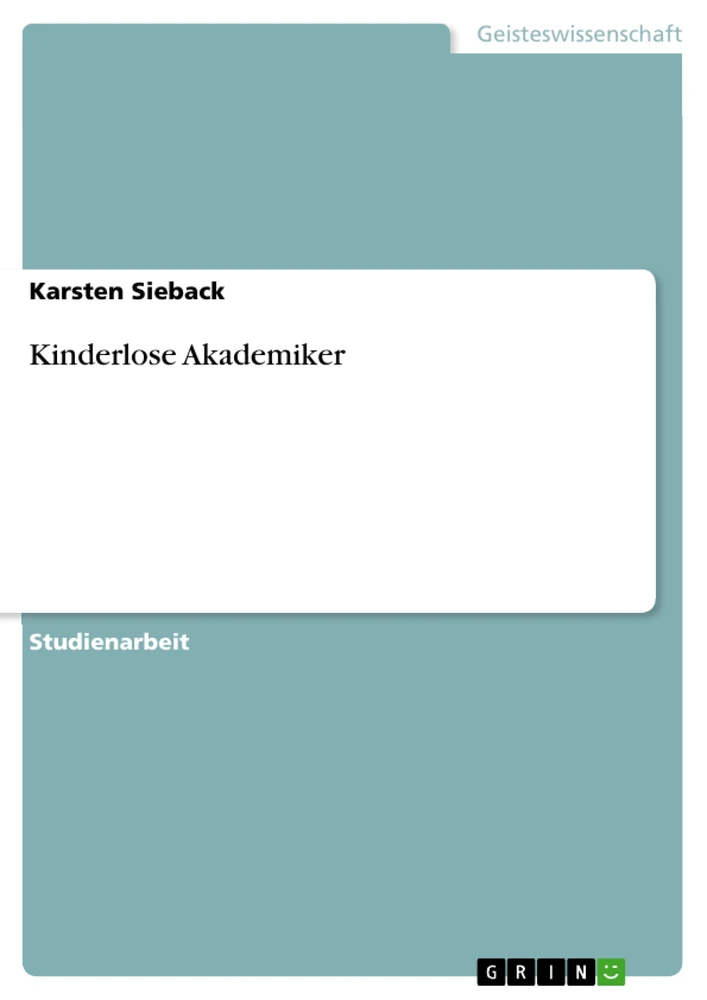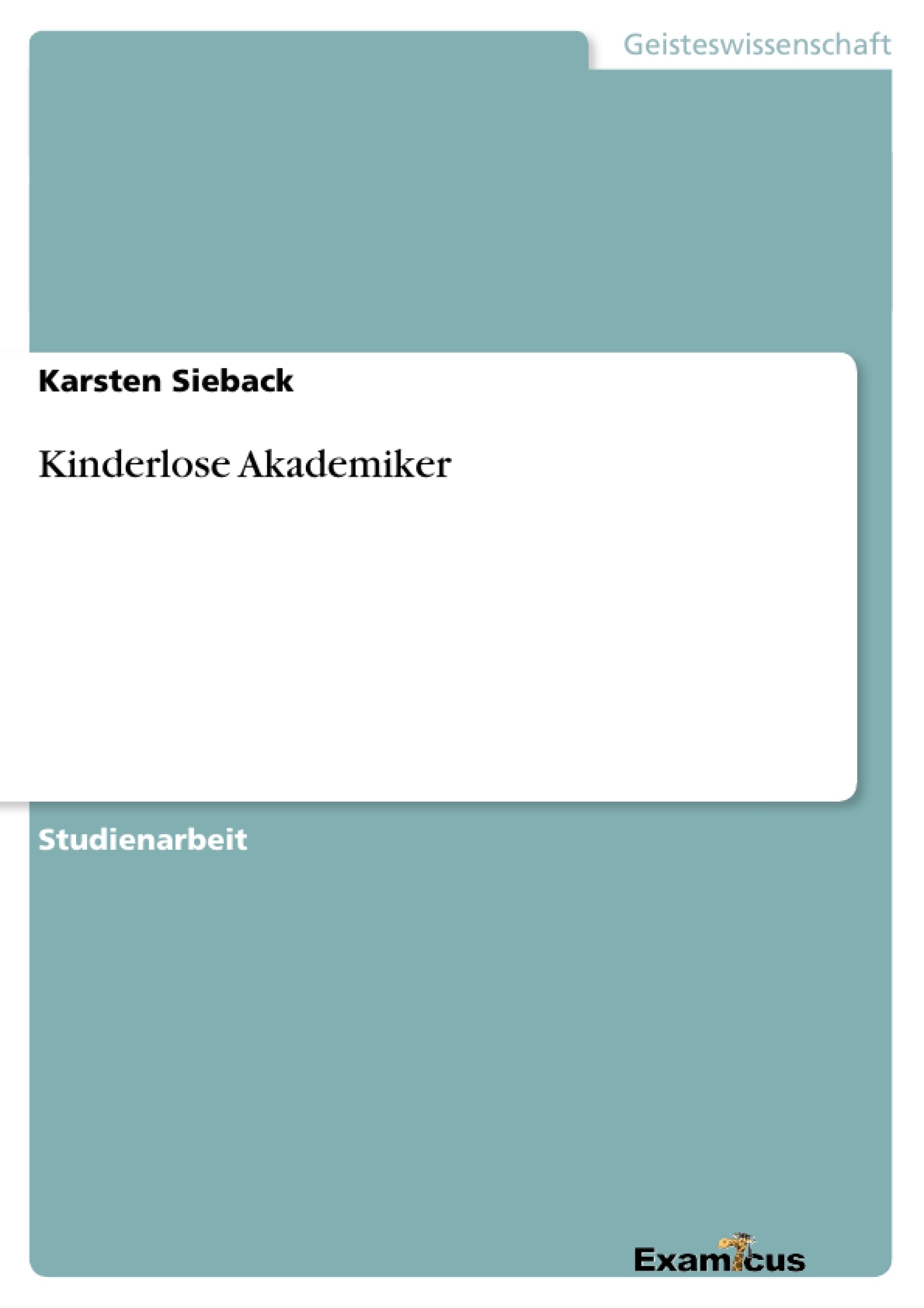Das Buch "Kinderlose Akademiker" diskutiert verschiedene Gedanken zu diesem Thema aus der Sicht von Betroffenen. Dabei wird vor allem geschaut, welche Gründe zu diesem Phänomen führen, dass sich gesellschaftlich als Kindermangel bei den Akademikerinnen und Akademikern äußert. Der Text soll jenseits der öffentlichen Diskussion Stoff liefern, mit dem jeder für sich an dem einen oder anderen Punkt mehr Klarheit gewinnen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil: Beispielbiografien Teil I
- Karin und Ernst
- Dieter
- Tanja und Steffen
- Armin und Christine
- Susanne und Martin
- Walter
- Maja und Thomas
- Franka und Joachim
- Zweiter Teil: Einblick
- Kinderlosigkeit - ein Frauenthema?
- Kinderlosigkeit – ein Finanzproblem?
- Kinder bekommen - Kinder haben
- Lebensentwürfe
- Kinder haben - Eltern sein
- Rollenbilder
- Die Jammerkultur
- Angst vor der Verantwortung?
- Angst vor dem Alleinsein
- Lebensplanung und Gesellschaft
- Familie versus Zweck-orientierte Handlungszusammenhänge
- Elternschaft und Partnerschaft
- Das Ruder rumreißen
- Die Junggebliebenen
- Wer will wen?
- Widerfahrnis versus Behandlung
- Der Traumpartner
- Theorie vom gemeinsamen Dritten
- Kuckuckskinder
- Anspruchsdenken
- Früher war alles einfacher
- 2. Der Kinderwunsch
- Geschlechterrollenverhältnis
- Das Entelechie-Prinzip
- Zeugen und erzeugen
- Der Subjektstatus
- Dritter Teil: Beispielbiografien Teil II – Zwei Jahre später
- Karin und Ernst
- Dieter und Ines
- Tanja, Steffen und Josephine
- Armin und Christine
- Susanne und Martin
- Walter und Ingeborg
- Maja und Werner
- Franka und Joachim
- Vierter Teil: Ausblick
- Fazit
- Versuch der Gelassenheit
- Blick auf die Sicht des Kindes
- Individuum versus Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch untersucht die akademische Kinderlosigkeit in Deutschland. Es beleuchtet die Gründe für den Mangel an Nachwuchs bei Akademikern und Akademikerinnen, wobei es sowohl individuelle Lebensentwürfe als auch gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt. Das Ziel ist es, verschiedene Perspektiven und Denkansätze zu präsentieren, um ein umfassenderes Verständnis des Themas zu ermöglichen.
- Individuelle Lebensentwürfe und Entscheidungen von Akademikern bezüglich Elternschaft
- Gesellschaftliche Faktoren und Einflüsse auf die Entscheidung für oder gegen Kinder
- Rollenbilder und Geschlechterverhältnisse im Kontext von Kinderwunsch und Elternschaft
- Reflexion der eigenen Position im Spannungsfeld zwischen individuellem Wunsch und gesellschaftlichen Erwartungen
- Die akademische Kinderlosigkeit als Symptom gesellschaftlicher Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Ausgangslage: Eine hohe Rate an Kinderlosigkeit bei Akademikern (ca. 45%, steigend). Sie betont den gesellschaftlichen Diskurs um dieses Thema und den oft bestehenden Graben zwischen öffentlicher Diskussion und den persönlichen Lebensrealitäten Betroffener. Das Buch zielt darauf ab, die tieferliegenden Ursachen dieser Kinderlosigkeit zu erforschen, ohne konkrete Handlungsanweisungen zu geben, sondern verschiedene Denkansätze aufzuzeigen und die eindimensionale Berichterstattung der Medien zu hinterfragen. Die Einleitung kündigt die Struktur des Buches an: Beispielbiografien, Diskussion der Ursachen, ein erneuter Blick auf die Biografien nach zwei Jahren und abschließend ein Fazit.
Erster Teil: Beispielbiografien Teil I: Dieser Teil präsentiert verschiedene Lebensgeschichten kinderloser Akademiker. Die Biografien dienen als exemplarische Beispiele für die Vielfalt der individuellen Situationen und Entscheidungsfindungen. Sie verdeutlichen, dass die oft genannten Gründe wie Karriere und Flexibilität nur Symptome, nicht aber die primären Ursachen der Kinderlosigkeit sind. Die Auswahl der Biografien ist bewusst gemacht, um das Spektrum an Erfahrungen darzustellen.
Zweiter Teil: Einblick: Dieser Teil analysiert die Ursachen der akademischen Kinderlosigkeit eingehend. Er befasst sich mit verschiedenen Aspekten wie dem Einfluss von Geschlechterrollen, finanziellen Überlegungen, der Angst vor Verantwortung und Alleinsein, sowie der Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Der Teil integriert philosophische Überlegungen und hinterfragt gängige Annahmen. Er will den Lesern eine Hilfestellung bieten, um die eigene Position zu reflektieren und über den Tellerrand der oft vereinfachenden Medienberichterstattung zu schauen.
2. Der Kinderwunsch: Dieser Teil vertieft den Fokus auf den Kinderwunsch selbst. Er beleuchtet das Geschlechterrollenverhältnis im Kontext des Kinderwunsches, das Entelechie-Prinzip, die Aspekte des Zeugens und Erzeugens sowie den Subjektstatus des Kindes. Hier werden konzeptionelle und philosophische Perspektiven in den Vordergrund gestellt, die die Entscheidung für oder gegen Kinder auf einer tieferen Ebene beleuchten.
Dritter Teil: Beispielbiografien Teil II – Zwei Jahre später: Dieser Teil folgt den Protagonisten des ersten Teils und untersucht, ob sich in den vergangenen zwei Jahren Veränderungen in Bezug auf ihren Kinderwunsch oder ihre Familiensituation ergeben haben. Durch diesen Vergleich sollen die Entwicklungen der individuellen Lebensentwürfe und -entscheidungen veranschaulicht werden und deren Dynamik aufgezeigt werden.
Schlüsselwörter
Akademische Kinderlosigkeit, Lebensentwürfe, Geschlechterrollen, Familiengründung, Gesellschaftliche Erwartungen, Individuelle Entscheidungen, Karriere, Flexibilität, Philosophische Reflexion, Biografien, Kinderwunsch.
Häufig gestellte Fragen zum Buch: Akademische Kinderlosigkeit in Deutschland
Was ist das Thema des Buches?
Das Buch untersucht die akademische Kinderlosigkeit in Deutschland. Es beleuchtet die Gründe für den Mangel an Nachwuchs bei Akademikern und Akademikerinnen, wobei sowohl individuelle Lebensentwürfe als auch gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt werden. Es geht nicht darum, Handlungsanweisungen zu geben, sondern verschiedene Perspektiven und Denkansätze zu präsentieren, um ein umfassenderes Verständnis des Themas zu ermöglichen.
Welche Aspekte werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt verschiedene Aspekte der akademischen Kinderlosigkeit, darunter individuelle Lebensentwürfe und Entscheidungen von Akademikern bezüglich Elternschaft, gesellschaftliche Faktoren und Einflüsse auf die Entscheidung für oder gegen Kinder, Rollenbilder und Geschlechterverhältnisse im Kontext von Kinderwunsch und Elternschaft, die Reflexion der eigenen Position im Spannungsfeld zwischen individuellem Wunsch und gesellschaftlichen Erwartungen und die akademische Kinderlosigkeit als Symptom gesellschaftlicher Entwicklungen.
Welche Struktur hat das Buch?
Das Buch ist in vier Teile gegliedert: Einleitung, Beispielbiografien Teil I, Einblick (Analyse der Ursachen), Beispielbiografien Teil II – Zwei Jahre später und Ausblick. Die Beispielbiografien zeigen die Vielfalt individueller Situationen und Entscheidungsfindungen. Der Einblick-Teil analysiert die Ursachen eingehend, der dritte Teil zeigt die Entwicklung der Protagonisten nach zwei Jahren und der Ausblick fasst die Ergebnisse zusammen und bietet eine weiterführende Reflexion.
Welche Methoden werden verwendet?
Das Buch verwendet eine qualitative Forschungsmethode. Es präsentiert Beispielbiografien von kinderlosen Akademikern, die als exemplarische Beispiele für die Vielfalt der individuellen Situationen und Entscheidungsfindungen dienen. Zusätzlich werden verschiedene philosophische und gesellschaftliche Perspektiven diskutiert und analysiert, um die Komplexität des Themas zu beleuchten. Der Vergleich der Biografien nach zwei Jahren ermöglicht die Analyse der Entwicklungen und Dynamiken.
Wer ist die Zielgruppe des Buches?
Die Zielgruppe des Buches sind Akademiker, Studenten, Wissenschaftler und alle Interessierten, die sich mit dem Thema Kinderlosigkeit, insbesondere im akademischen Kontext, auseinandersetzen möchten. Das Buch richtet sich an Personen, die ein tiefergehendes Verständnis der komplexen Ursachen und Hintergründe der akademischen Kinderlosigkeit suchen und die gängige, oft vereinfachte Medienberichterstattung kritisch hinterfragen.
Welche zentralen Thesen vertritt das Buch?
Das Buch argumentiert, dass die oft genannten Gründe für akademische Kinderlosigkeit wie Karriere und Flexibilität eher Symptome als die primären Ursachen sind. Es betont die Vielfältigkeit individueller Lebensentwürfe und die Bedeutung gesellschaftlicher Faktoren. Es hinterfragt gängige Annahmen und versucht, ein differenzierteres Bild der akademischen Kinderlosigkeit zu zeichnen, das über die eindimensionale Berichterstattung der Medien hinausgeht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter sind: Akademische Kinderlosigkeit, Lebensentwürfe, Geschlechterrollen, Familiengründung, Gesellschaftliche Erwartungen, Individuelle Entscheidungen, Karriere, Flexibilität, Philosophische Reflexion, Biografien, Kinderwunsch.
- Quote paper
- Karsten Sieback (Author), 2008, Kinderlose Akademiker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186486