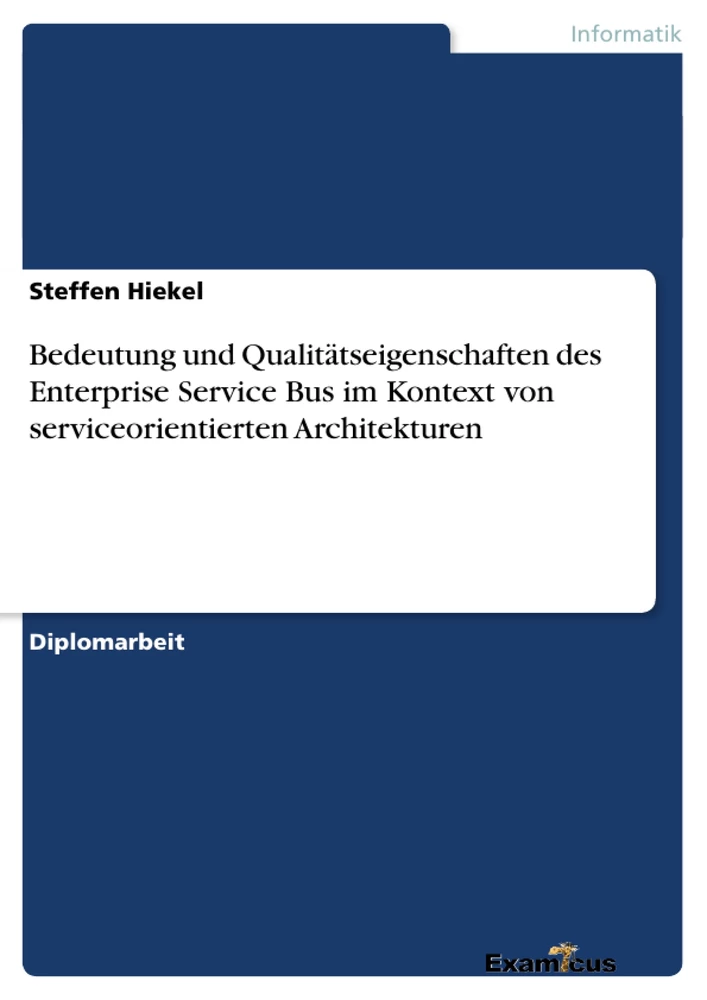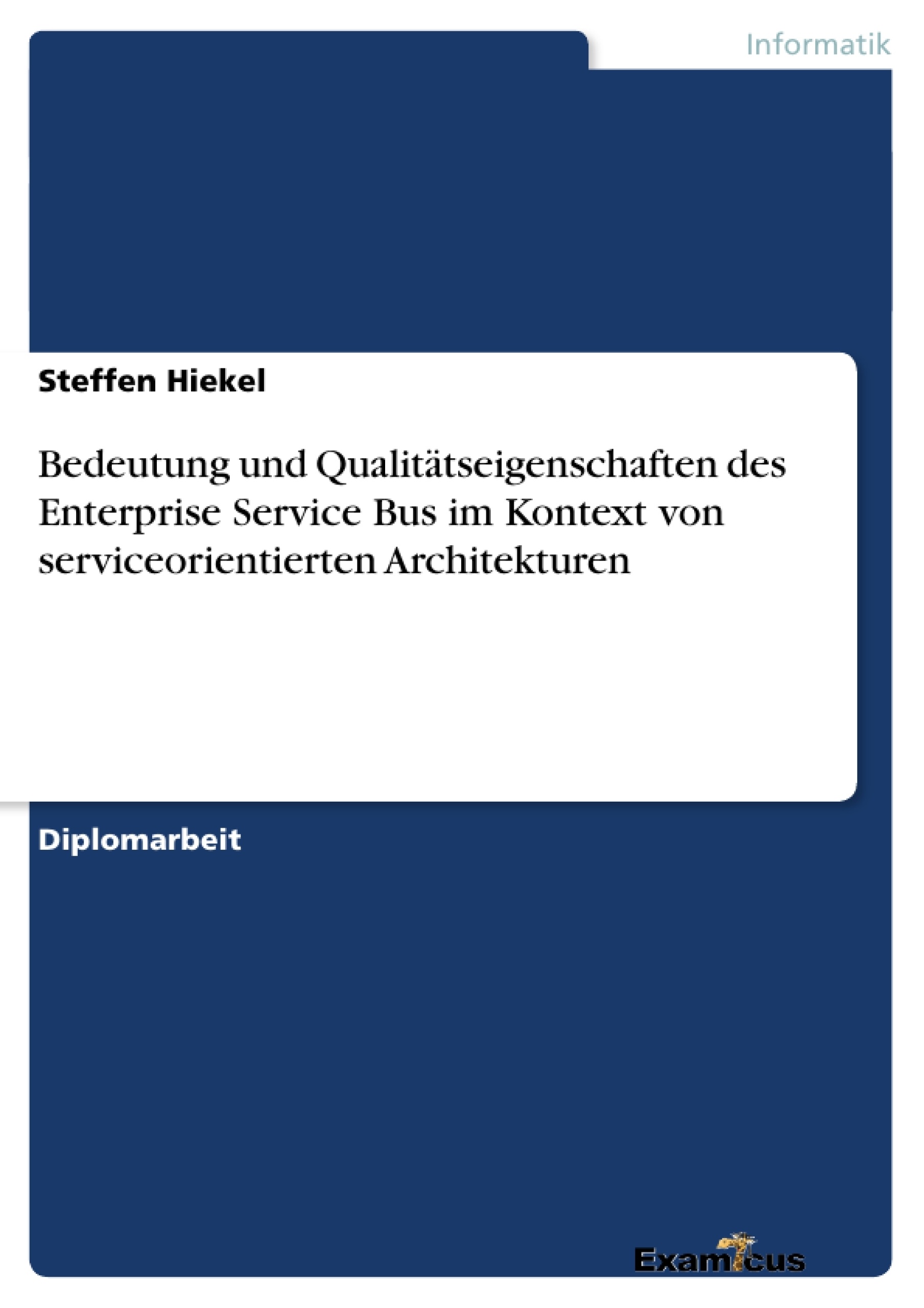Thema der Diplomarbeit ist der Enterprise Service Bus (ESB) und wie mittels diesem eine service-orientierte Architektur (SOA) realisiert werden kann. Hierzu wird zunächst mit einer historischen Einordnung begonnen, die verschiedenste Konzepte und Technologien der jüngeren Vergangenheit kurz thematisiert (objektorientierte Programmierung, komponentenbasierte Programmierung, nachrichtenbasierte Middleware/MOM, EAI) und zum aktuellen Stand der Technik hingeführt (Web Services, SOA, ESB). Daran an schließt sich eine intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff Enterprise Service Bus. Es werden verschiedene Sichtweisen aus Kreisen der Forschung vorgestellt, systematisiert und abschließend bewertet. Aufbauend auf der daraus resultierenden Begriffs¬definition, wird im weiteren Verlauf der Fokus auf die industrielle Sichtweise gelegt. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Forschungs- und industrieller Sicht werden herausgearbeitet und einer Bewertung unterzogen. Ebenfalls sehr detailliert beschrieben werden dabei die ESB-Implementierungen namenhafter und zahlreicher Softwarehersteller sowie damit verbundene Technologien und Standards (MOM, Web Services, SOAP, UDDI, WSDL, XML, JMS, JCA, JMX, JBI, SLA, etc.). Der Leser erhält einen tiefen Einblick in den aktuellen Stand der Technik im Umfeld serviceorientierter Architekturen. Stärken und Schwächen einzelner Implementierungen (Produkte) werden klar und systematisch vermittelt und gleichsam mit dem gesamten Konzept Enterprise Service Bus auf den Prüfstand gestellt. Gestützt auf diese Betrachtungen wird nachfolgende ein Qualitätsmodell erarbeitet, das die Bewertung von ESB-Implementierungen hinsichtlich Qualität erlauben soll. Dieses Modell umfasst 12 verschiedene Qualitätskriterien (Standaradunterstützung, Routingfähigkeiten, Transfor¬mations¬fähigkeiten, Performanz, Plattformunabhängigkeit, etc.) und 25 verschiedene Qualitätsmetriken. Es ermöglicht die Durchführung von Qualitätsbewertungen für ESB-Implementierungen ohne einen größeren Aufwand und ist speziell für Evaluations- oder Erprobungsphasen geeignet. Die Anwendung dieses Qualitätsmodells wird am Beispiel von drei verschiedenen ESB-Implementierungen gezeigt und das Abschneiden dieser bezüglich der einzelnen Qualitätskriterien erläutert. Abschließend wird in einem kurzen Fazit der Inhalt und das Ergebnis der Arbeit zusammengefasst und im Rahmen eines Ausblicks auf zukünftige und noch zu erwartende Entwicklungen hingewiesen.
<br><br>
Die Arbeit erhielt den DASMA Diplomarbeitenpreis 2007. Die Arbeit erhielt den DASMA Diplomarbeitenpreis 2007.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Aufbau
- 1.3 Einordnung
- 1.4 Fazit
- 2 Der ESB aus Sicht der Forschung
- 2.1 Herangehensweise
- 2.2 Definition des ESB in der Forschung
- 2.2.1 Definition nach Schulte (Gartner)
- 2.2.2 Definition nach Kischel (OBJEKTspektrum)
- 2.2.3 Definition nach Chappell
- 2.2.4 Definition nach Dostal/Jeckle/Melzer/Zengler
- 2.2.5 Definition nach Lorenzelli-Scholz (OBJEKTspektrum)
- 2.2.6 Definition nach Rieks (IM)
- 2.2.7 Definition nach Tieke (InformationWeek)
- 2.2.8 Definition nach Vollmer/Gilpin (Forrester)
- 2.3 Vergleich der Definitionen
- 2.4 Fazit
- 3 Der ESB aus Sicht der Softwareindustrie
- 3.1 Herangehensweise
- 3.2 JBI Spezifikation
- 3.3 ESB nach Progress Software (ehemals Sonic Software)
- 3.4 ESB nach Fiorano
- 3.5 ESB nach Cape Clear
- 3.6 ESB nach BEA
- 3.7 ESB nach Oracle
- 3.8 ESB nach MuleSource
- 3.9 ESB nach Microsoft
- 3.10 ESB nach Sun Microsystems
- 3.11 ESB nach Red Hat (JBoss)
- 3.12 Vergleich der ESB-Implementierungen
- 3.13 Fazit
- 4 Qualitätseigenschaften des ESB
- 4.1 Herangehensweise
- 4.2 Allgemeine Qualitätseigenschaften
- 4.3 Spezielle Qualitätseigenschaften
- 4.4 ESB-Qualitätsmodell
- 4.4.1 Performanz
- 4.4.2 Sicherheit
- 4.4.3 Funktionsumfang/Funktionalität
- 4.4.4 Benutzbarkeit
- 4.4.5 Testbarkeit, Integrierbarkeit
- 4.4.6 Wartbarkeit
- 4.4.7 Plattformunabhängigkeit/Portierbarkeit
- 4.4.8 Skalierbarkeit
- 4.4.9 Wiederverwendbarkeit
- 4.4.10 Standardunterstützung
- 4.4.11 Routingfähigkeiten
- 4.4.12 Transformationsfähigkeiten
- 4.5 Zusammenfassung
- 5 Bewertung von verfügbaren ESB-Implementierungen
- 5.1 Herangehensweise
- 5.2 Anwendung des Qualitätsmodells
- 5.2.1 Performanz
- 5.2.2 Sicherheit
- 5.2.3 Funktionsumfang
- 5.2.4 Benutzbarkeit
- 5.2.5 Testbarkeit, Integrierbarkeit
- 5.2.6 Wartbarkeit
- 5.2.7 Plattformunabhängigkeit/Portierbarkeit
- 5.2.8 Skalierbarkeit
- 5.2.9 Wiederverwendbarkeit
- 5.2.10 Standardunterstützung
- 5.2.11 Routingfähigkeiten
- 5.2.12 Transformationsfähigkeiten
- 5.3 Vergleich
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- 6.1 Zusammenfassung
- 6.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Enterprise Service Bus (ESB) im Kontext serviceorientierter Architekturen (SOA). Die Arbeit klärt den Begriff ESB, vergleicht die Sichtweisen von Forschung und Industrie, analysiert verschiedene ESB-Implementierungen und entwickelt ein Qualitätsmodell zur Bewertung dieser Implementierungen.
- Definition und Einordnung des ESB
- Vergleich der ESB-Definitionen in Forschung und Industrie
- Analyse der Qualitätseigenschaften von ESB-Implementierungen
- Entwicklung eines ESB-Qualitätsmodells
- Anwendung des Qualitätsmodells auf ausgewählte ESB-Implementierungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, motiviert die Arbeit durch die Herausforderungen der SOA-Implementierung und den noch unreifen ESB-Markt, und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Es gibt einen kurzen historischen Überblick über die Entwicklung von der objektorientierten Programmierung über die komponentenbasierte Softwareentwicklung und EAI bis hin zu SOA.
2 Der ESB aus Sicht der Forschung: Dieses Kapitel analysiert verschiedene wissenschaftliche Definitionen des ESB, untersucht deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede und identifiziert zentrale Eigenschaften und Funktionen. Es vergleicht verschiedene Ansätze und definiert den ESB als Softwarearchitektur, im Gegensatz zu einer konkreten Implementierung.
3 Der ESB aus Sicht der Softwareindustrie: Dieses Kapitel analysiert verschiedene kommerzielle und Open-Source ESB-Implementierungen, wobei der Fokus auf den Komponenten, Aufbau, Funktionsumfang und der Konformität zu den in Kapitel 2 dargestellten Definitionen liegt. Es werden die Produkte von Progress Software, Fiorano, Cape Clear, IONA Technologies, BEA Systems, Oracle, MuleSource, Microsoft, Sun Microsystems, und Red Hat (JBoss) untersucht.
4 Qualitätseigenschaften des ESB: Dieses Kapitel präsentiert ein Qualitätsmodell für ESB-Implementierungen, welches allgemeine und spezielle Qualitätseigenschaften berücksichtigt. Es definiert Metriken zur Bewertung von Performanz, Sicherheit, Funktionsumfang, Benutzbarkeit, Testbarkeit, Wartbarkeit, Plattformunabhängigkeit, Skalierbarkeit, Wiederverwendbarkeit, und Standardunterstützung.
5 Bewertung von verfügbaren ESB-Implementierungen: Dieses Kapitel wendet das in Kapitel 4 entwickelte Qualitätsmodell auf die ESB-Implementierungen Artix (IONA), Mule (MuleSource), und ServiceMix an. Es vergleicht die Ergebnisse und bewertet die jeweiligen Stärken und Schwächen.
Schlüsselwörter
Enterprise Service Bus (ESB), Serviceorientierte Architektur (SOA), Nachrichtenorientierte Middleware (MOM), Web Services, Integration, Qualitätseigenschaften, Qualitätsmodell, JBI, SOA-Implementierung, Flexibilität, Skalierbarkeit, Sicherheit
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Enterprise Service Bus (ESB)
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit befasst sich umfassend mit dem Enterprise Service Bus (ESB) im Kontext serviceorientierter Architekturen (SOA). Sie untersucht die Definition, die unterschiedlichen Sichtweisen von Forschung und Industrie, analysiert verschiedene ESB-Implementierungen und entwickelt ein Qualitätsmodell zur Bewertung dieser Implementierungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Definition und Einordnung des ESB, Vergleich der ESB-Definitionen in Forschung und Industrie, Analyse der Qualitätseigenschaften von ESB-Implementierungen, Entwicklung eines ESB-Qualitätsmodells und die Anwendung des Qualitätsmodells auf ausgewählte ESB-Implementierungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Der ESB aus Sicht der Forschung, Der ESB aus Sicht der Softwareindustrie, Qualitätseigenschaften des ESB, Bewertung von verfügbaren ESB-Implementierungen und Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel ist in Unterkapitel gegliedert, die die jeweiligen Themen detailliert behandeln.
Welche ESB-Implementierungen werden analysiert?
Aus der Sicht der Softwareindustrie werden verschiedene kommerzielle und Open-Source ESB-Implementierungen analysiert, darunter Produkte von Progress Software, Fiorano, Cape Clear, IONA Technologies, BEA Systems, Oracle, MuleSource, Microsoft, Sun Microsystems und Red Hat (JBoss). In der Bewertung werden die Implementierungen Artix (IONA), Mule (MuleSource) und ServiceMix genauer untersucht.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis des ESB zu schaffen, die verschiedenen Definitionen und Implementierungen zu vergleichen und ein praktikables Qualitätsmodell zur Bewertung von ESB-Implementierungen zu entwickeln. Dies soll die Auswahl und den Einsatz von ESBs in SOA-Projekten erleichtern.
Was ist das Ergebnis der Arbeit?
Die Arbeit liefert ein detailliertes Verständnis des ESB, einen Vergleich verschiedener Definitionen und Implementierungen und ein aussagekräftiges Qualitätsmodell, das zur Bewertung von ESB-Systemen eingesetzt werden kann. Die Ergebnisse helfen bei der Auswahl und dem Vergleich verschiedener ESB-Produkte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Enterprise Service Bus (ESB), Serviceorientierte Architektur (SOA), Nachrichtenorientierte Middleware (MOM), Web Services, Integration, Qualitätseigenschaften, Qualitätsmodell, JBI, SOA-Implementierung, Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit.
Wie werden die Qualitätseigenschaften des ESB bewertet?
Das entwickelte Qualitätsmodell bewertet verschiedene Eigenschaften, darunter Performanz, Sicherheit, Funktionsumfang, Benutzbarkeit, Testbarkeit, Wartbarkeit, Plattformunabhängigkeit, Skalierbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Standardunterstützung, Routingfähigkeiten und Transformationsfähigkeiten. Für jede Eigenschaft werden Metriken zur Bewertung definiert.
- Quote paper
- Steffen Hiekel (Author), 2007, Bedeutung und Qualitätseigenschaften des Enterprise Service Bus im Kontext von serviceorientierten Architekturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186437