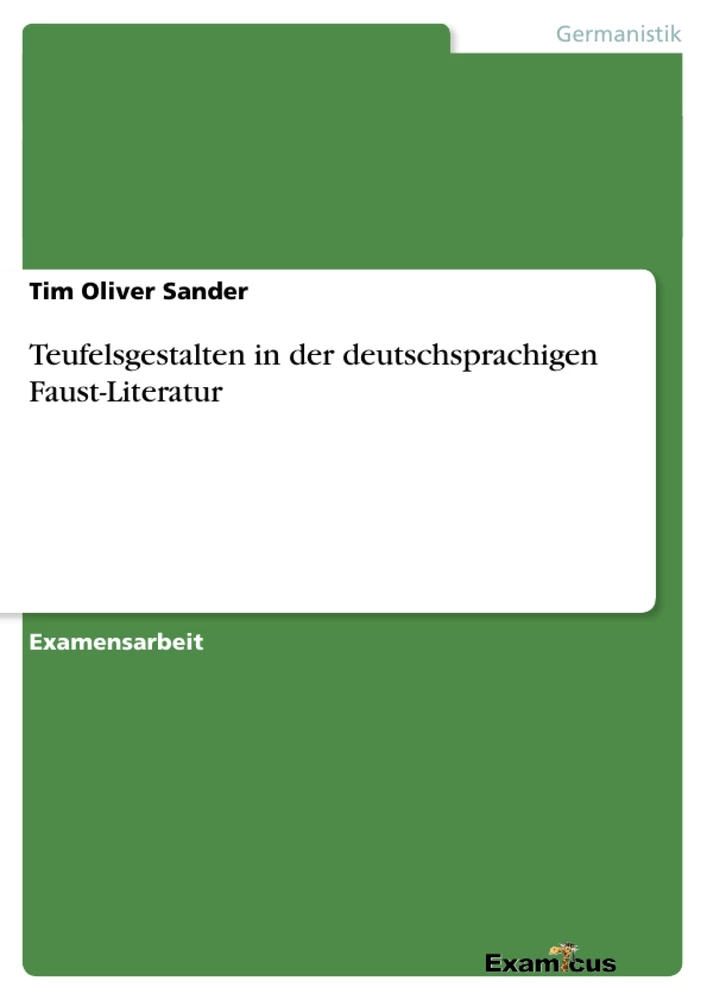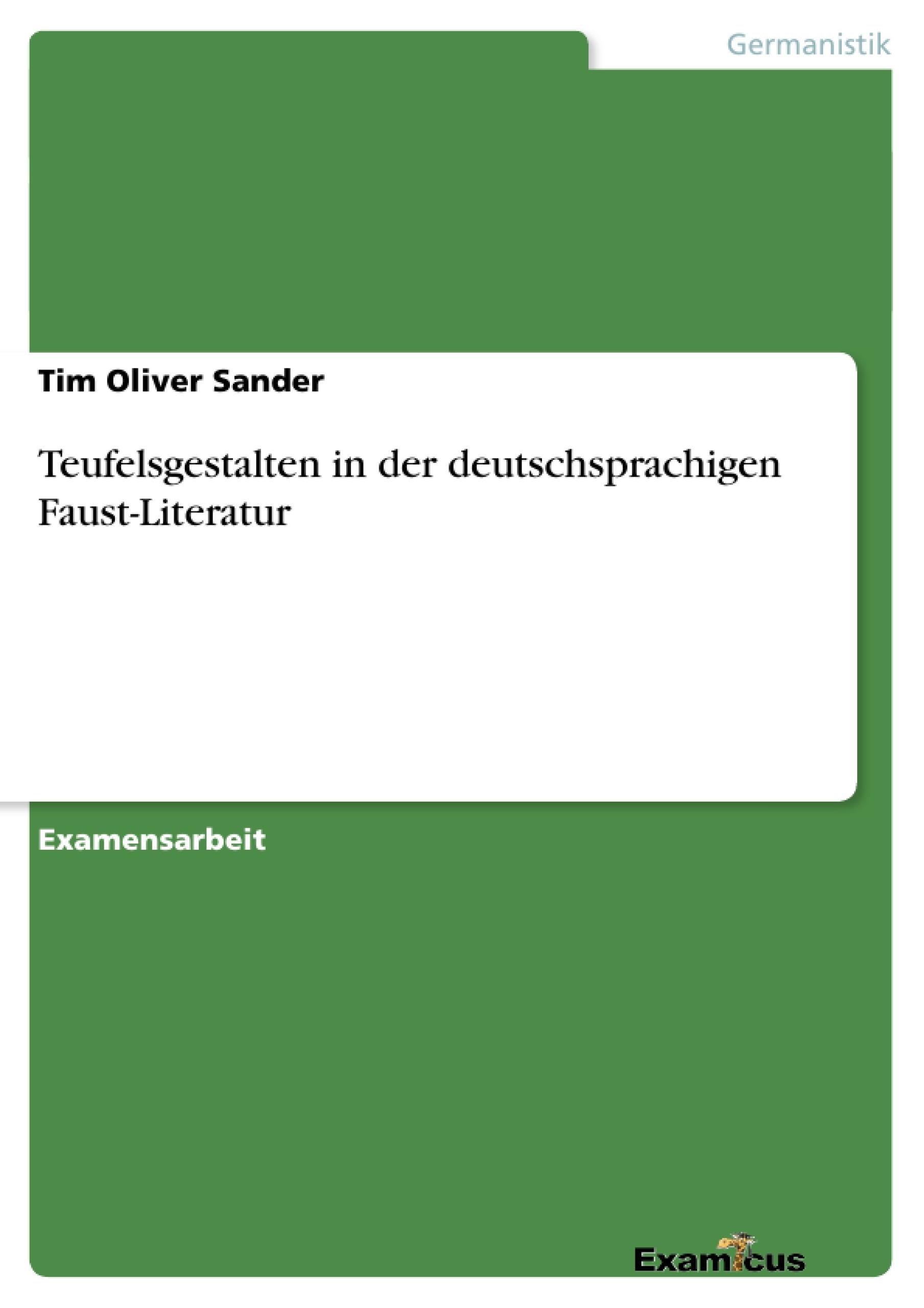Die Staatsarbeit befasst sich mit der Teufelsgestaltung in fünf exemplarisch ausgewählten Faust-Dichtungen (Historia von 1587, Lessings Fragmente, Goethes "Faust I", Heines Tanzpoem, Thomas Manns "Doktor Faustus"). Die Genese des literarischen Dämons wird unter zeitgeschichtlichen, psychologischen, theologischen sowie philosophischen Fragestellungen betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER TEUFEL IN DER BIBEL
- Das Alte Testament - Das „,,Buch Hiob"
- Das Neue Testament - Jesu Versuchung
- TEUFELSGESTALTEN IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN FAUST-LITERATUR
- Das Faust-Buch von 1587
- Die theologische Konzeption
- Mephostophiles als protestantischer Prediger
- LESSINGS Faust-Fragmente
- Entstehung und Kontext
- Konzeptionsstufe 1
- Konzeptionsstufe 2
- Konzeptionsstufe 3
- Entstehung und Kontext
- GOETHES Faust
- Vorbemerkungen
- Säkularisierung und Entmystifizierung - Der Prolog im Himmel"
- ,,Studierzimmer I" (V. 1177 – 1529)
- Exkurs: Mephisto und das „,MANDEVILLSCHE Paradox"
- ,,Studierzimmer II" (V. 1530 – 1850)
- Die,,Walpurgisnacht als Teil einer dualistischen Grundspannung
- Conclusio
- HEINES Tanzpoem Der Doktor Faust
- Entstehung und Konzeption
- Verführung durch Mephistophela
- Der namenlose Teufel in Thomas ManNS Doktor Faustus
- Vorbemerkungen
- Die Darstellung des Nicht-Darstellbaren
- Die Wahl der Perspektive
- Die Prädisposition zur Teufelei
- Das Theologiestudium - Ein „gottseliges Fürnemmen?”
- Der Abschluss des Teufelspaktes
- Teuflisches Leipzig - Das Bordellerlebnis
- Kapitel XIX - Das eigentliche Bündnis
- Das Teufelsgespräch von Palestrina
- Der nationale Paktschluss mit dem Teufel
- Das Faust-Buch von 1587
- SCHLUSSBETRACHTUNGEN
- BIBLIOGRAFIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung der Teufelsgestalten in der deutschsprachigen Faust-Literatur. Ziel ist es, die literarische Tradition des Teufelsbündners von seinen biblischen Ursprüngen bis hin zu Thomas Manns Doktor Faustus zu beleuchten und die Veränderungen in der Darstellung des Teufels im Laufe der Zeit aufzuzeigen. Dabei werden die unterschiedlichen Konzeptionen des Teufels in den verschiedenen Werken analysiert und in ihren historischen Kontext eingeordnet.
- Die Entwicklung des Teufelsbildes in der Literatur
- Die Rolle des Teufels als Vermittler von Wissen und Macht
- Die moralische Ambivalenz des Teufels
- Die Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles
- Die Bedeutung des Teufels für die deutsche Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Teufelsgestalten in der deutschsprachigen Faust-Literatur“ dar und beleuchtet die literarhistorische Tradition des Stoffes. Sie führt in die Thematik ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
Das zweite Kapitel widmet sich der Darstellung des Teufels in der Bibel. Es werden die biblischen Ursprünge des Teufelsbildes im Alten und Neuen Testament beleuchtet. Dabei wird insbesondere auf die Rolle des Teufels im „Buch Hiob“ und auf Jesu Versuchung durch den Teufel eingegangen.
Das dritte Kapitel analysiert die Teufelsgestalten in der deutschsprachigen Faust-Literatur. Es beginnt mit einer Untersuchung des „Faust-Buchs“ von 1587, der ersten literarisierten Fassung der Faust-Sage. Anschließend werden LESSINGS Faust-Fragmente und GOETHES Faust im Detail betrachtet. Die Analyse konzentriert sich auf die Entwicklung des Teufelsbildes in den verschiedenen Werken und die Veränderungen in der Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles.
Das vierte Kapitel befasst sich mit HEINES Tanzpoem „Der Doktor Faust“. Es werden die Entstehung und Konzeption des Werkes sowie die Darstellung der Verführung durch Mephistopheles analysiert.
Das fünfte Kapitel widmet sich dem namenlosen Teufel in Thomas Manns „Doktor Faustus“. Es werden die Darstellung des Nicht-Darstellbaren, die Prädisposition zur Teufelei und das Theologiestudium des Protagonisten untersucht. Darüber hinaus wird der Abschluss des Teufelspaktes und das Teufelsgespräch von Palestrina analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Teufel, die Faust-Literatur, die deutschsprachige Literatur, die Bibel, die Geschichte des Teufelsbildes, die Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles, die Verführung, die Moral, die Macht, das Wissen, die Literaturgeschichte, die historische Entwicklung, die Konzeption des Teufels, die literarische Tradition, die Analyse, die Interpretation, die biblischen Ursprünge, die literarische Analyse, die literarische Tradition, die literarische Entwicklung, die literarische Rezeption.
- Quote paper
- Tim Oliver Sander (Author), 2004, Teufelsgestalten in der deutschsprachigen Faust-Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186029