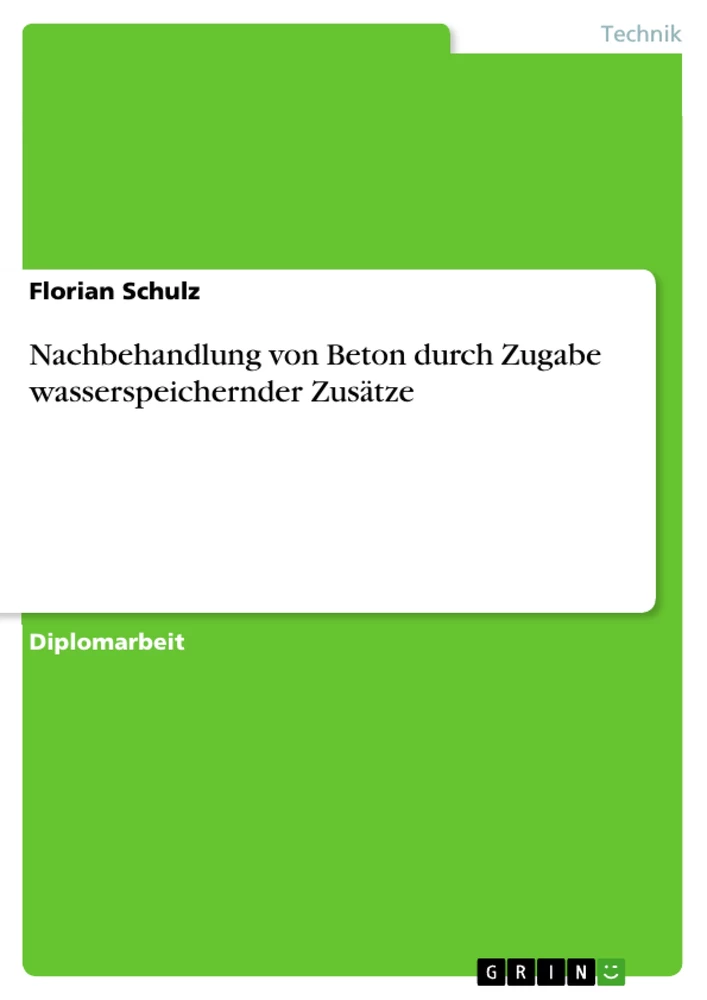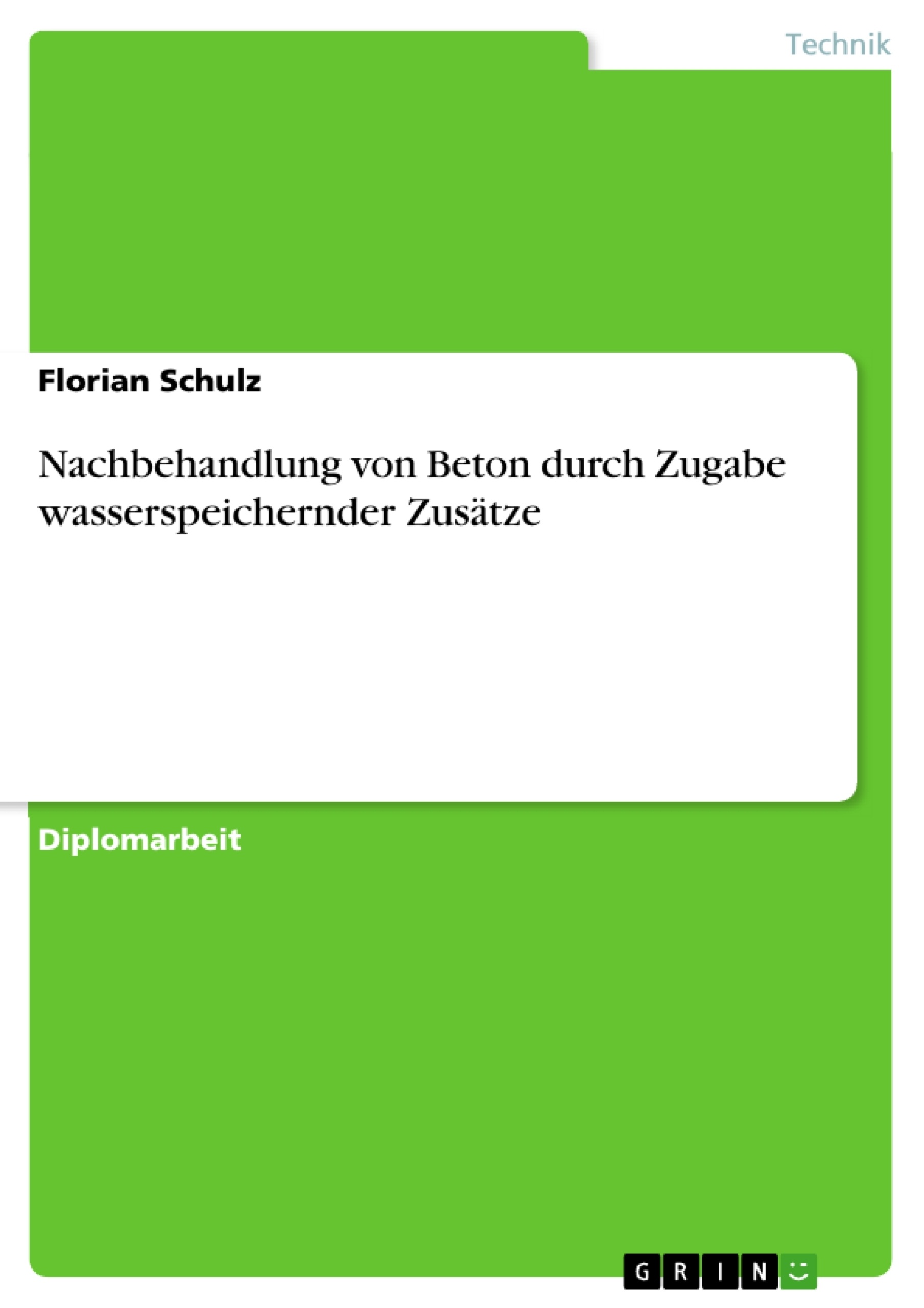Dauerhafte Stahlbetonteile bedürfen einer intensiven Nachbehandlung. Eine wesentliche Aufgabe der Nachbehandlung ist die Sicherstellung einer ausreichenden Feuchthaltung des oberflächennahen Betons, um eine ausreichende Hydratation des Zements zu erzielen. Für die Nachbehandlung gibt es verschiedene anerkannte Verfahren. Diese erfordern einen zusätzlichen Arbeitsaufwand, der sich im Extremfall über einen Zeitraum vom drei bis vier Wochen erstrecken kann. Zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen wurde in dieser Diplomarbeit ein bisher nicht übliches Nachbehandlungsverfahren erprobt: Die Zugabe eines wasserspeichernden Zusatzes bei der Betonherstellung. Derartige Stoffe werden z. B. als Stabilisatoren bei der Fließestrichherstellung eingesetzt. Nach einer allgemeinen Einleitung wurde in dieser Diplomarbeit der Stand der Kenntnisse zur Nachbehandlung von Beton auf Grundlage einer Literaturrecherche dargestellt. Berücksichtigt und gegenübergestellt wurden die Aussagen der ehemals gültigen „Richtlinie zur Nachbehandlung von Beton“ vom Deutschen Ausschuss für Stahlbeton und der seit Juli 2001 gültigen DIN 1045-3 „Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, Teil 3: Bauausführung“. Im weiteren Verlauf erfolgten Erläuterungen zu den Verfahren der Betonherstellung und –prüfung und zur Versuchsdurchführung. Erläutert wurden ebenso die eingesetzten Betonkomponenten und –zusätze. Schwerpunkt der Diplomarbeit bildete die Durchführung der schon angesprochenen Laborversuche samt deren Auswertung. Ausgangspunkt bildeten acht verschiedene Betonrezepturen, die hinsichtlich Festigkeit und Verarbeitbarkeit das baupraktische Spektrum abdeckten. Diese acht Betone unterschieden sich in Wasserzementwert, Fließmittelgehalt und Stabilisatorgehalt. Es sollte, wenn möglich, nachgewiesen werden, dass die Betonzusammensetzungen mit Stabilisator im Wesentlichen den Eigenschaften eines „normalen“ Betons entsprechen, jedoch eine höhere Feuchte aufweisen. Um eine ergebnismäßige Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Betonrezepturen herzustellen, wurden ein Versuchsprogramm sowie die Labor- bzw. Versuchsprotokolle ausgearbeitet, mit dem verschiedene Eigenschaften wie z. B. Ausbreitmaß, Druckfestigkeit oder Feuchtegehalt festgestellt und miteinander verglichen werden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabenstellung
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung/Problemstellung
- 1.1 Überblick über die Nachbehandlung von Beton
- 1.2 Geschichte des Baustoffs Beton
- 1.3 Beton heute
- 1.4 Versuchsziele
- 1.5 Übersicht über den Aufbau der Diplomarbeit
- 2 Stand der Kenntnisse zur Nachbehandlung von Beton
- 2.1 Einführung und Hintergrund
- 2.2 Aussagen zur Nachbehandlung von Beton in der Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb)
- 2.3 Aussagen zur Nachbehandlung von Beton in der DIN
- 2.4 Vergleich der Regelungen aus DIN und DAfStb-Richtlinie
- 2.5 Zusammenfassung der Nachbehandlungskriterien
- 2.5.1 Zusammenfassung im Allgemeinen
- 2.5.2 Zusammenfassung im Speziellen
- 3 Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung
- 3.1 Erläuterung der durchgeführten Versuche
- 3.1.1 Einführung
- 3.1.2 Kornzusammensetzung/Siebversuch
- 3.1.3 Ausbreitversuch
- 3.1.4 Verdichtungsversuch
- 3.1.5 Luftporengehalt von Frischbeton
- 3.1.6 Frischbetonrohdichte
- 3.1.7 Festbetonrohdichte
- 3.1.8 Druckfestigkeit
- a) Druckfestigkeit nach Rückprallhammer
- b) Druckfestigkeit nach Abdrücken
- 3.1.9 Feuchte-/Temperaturmessungen an Platten
- a) Messungen der relativen Feuchte ϕ
- b) Temperaturmessungen
- 3.1.10 Schwindmessungen
- 3.1.11 Bestimmung des Feuchtegehalts
- 3.1.12 Fehlerbetrachtung
- 3.2 Erläuterung der einzelnen Betonkomponenten
- 3.2.1 Beton
- a) Wasser
- b) Zement
- c) Gesteinskörnung
- d) Zusammensetzung des Betons ohne Einflüsse aus Fließmittel und/oder Stabilisator
- 3.2.2 Fließmittel
- 3.2.3 Stabilisator
- a) Stabilisatoren allgemein
- b) Stabilisatoren am Bau
- c) Parallelen aus a) und b) zum Stabilisatoren-Einsatz bei den Laborversuchen im Rahmen der Diplomarbeit
- d) Rhoximat RH 23 der Firma Colltec GmbH, Bielefeld
- e) Vergleichbare Produkte
- 3.2.4 Feststellung des Stabilisator- und Fließmittelgehalts
- a) Bestimmung des Stabilisatormenge
- b) Bestimmung des Fließmittelgehalts
- 3.2.1 Beton
- 3.3 Auswertung der Versuche
- 3.3.1 Allgemeine Gegenüberstellung der Versuchsergebnisse der verschiedenen Betonrezepturen
- a) Konsistenz und Verarbeitbarkeit
- b) Luftporengehalt
- c) Oberflächenbeschaffenheit der Platten
- d) Schwinden am Plattenrand
- e) Farbe des Betons
- f) Rohdichte
- 3.3.2 Auswertung der Druckfestigkeiten
- 3.3.3 Auswertung der Schwindmessungen
- a) Bezug des Schwindens auf die Zeit
- b) Bezug des Schwindens auf den Feuchtegehalt
- 3.3.4 Messungen der relativen Feuchte
- a) Relative Feuchte in t=2cm (Abstand ab Oberfläche)
- b) Relative Feuchte in t=4cm (Abstand ab Oberfläche)
- c) Verhalten der relativen Feuchte bei 105°C-Trocknung
- d) Vergleich der relativen Feuchten in 2 bzw. 4 cm Tiefe
- 3.3.5 Bestimmung des Feuchtegehalts
- 3.3.6 Vergleich der Aussagen aus 3.3.4 und 3.3.5
- 3.3.1 Allgemeine Gegenüberstellung der Versuchsergebnisse der verschiedenen Betonrezepturen
- 4 Auswirkungen des Stabilisatoreinsatzes auf die Nachbehandlung
- 4.1 Auswirkung des Stabilisators auf die Nachbehandlungsmaßnahmen
- 4.2 Konsistenz und Verarbeitbarkeit
- 4.3 Materialkosten
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Untersuchung der Auswirkungen eines wasserspeichernden Zusatzes (Stabilisator) auf die Nachbehandlung von Beton. Ziel ist es, die Betoneigenschaften zu optimieren und die Effizienz der Nachbehandlungsmaßnahmen zu verbessern.
- Einfluss des Stabilisators auf die Festigkeitsentwicklung des Betons
- Bedeutung der Nachbehandlung für die Betonqualität und Dauerhaftigkeit
- Vergleich verschiedener Betonzusammensetzungen mit und ohne Stabilisator
- Analyse der Feuchte- und Schwindverhältnisse im Beton
- Optimierung der Verarbeitbarkeit von Beton mit Stabilisatorzusätzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 bietet eine Einleitung zur Problemstellung und einen Überblick über die Nachbehandlung von Beton. Es werden die Geschichte und der heutige Einsatzbereich des Baustoffs Beton beleuchtet. Abschließend werden die Versuchsziele der Diplomarbeit dargelegt.
- Kapitel 2 analysiert den Stand der Kenntnisse zur Nachbehandlung von Beton. Es werden die relevanten Regelungen des DAfStb und der DIN 1045-3 erläutert und in einem Vergleich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dargestellt.
- Kapitel 3 beschreibt die praktische Versuchsdurchführung und die Auswertung der Ergebnisse. Es werden acht verschiedene Betonmischungen hergestellt und mit verschiedenen Messmethoden untersucht. Die einzelnen Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer Einflussfaktoren (Wasserzementwert, Fließmittel, Stabilisator) analysiert und interpretiert.
- Kapitel 4 befasst sich mit den Auswirkungen des Stabilisatoreinsatzes auf die Nachbehandlung von Beton in der Praxis. Es werden die Veränderungen der Verarbeitbarkeit und der Materialkosten in Bezug auf die optimierte Betonqualität diskutiert.
- Kapitel 5 fasst die wichtigsten Ergebnisse der Diplomarbeit zusammen und zieht ein Fazit. Es werden konkrete Empfehlungen für weitere Forschungsschritte gegeben, um die Erkenntnisse zu vertiefen und den Einsatz von Stabilisatoren in der Betonherstellung zu optimieren.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die Nachbehandlung von Beton durch Zugabe wasserspeichernder Zusätze. Schwerpunkte sind die Analyse von Druckfestigkeit, Feuchtegehalt und Schwinden im Beton. Es werden verschiedene Betonzusammensetzungen, insbesondere die Auswirkungen von Fließmitteln und Stabilisatoren, untersucht. Die Ergebnisse dienen der Optimierung der Betonqualität und der Effizienz der Nachbehandlungsmaßnahmen.
- 3.1 Erläuterung der durchgeführten Versuche
- Quote paper
- Florian Schulz (Author), 2002, Nachbehandlung von Beton durch Zugabe wasserspeichernder Zusätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185829