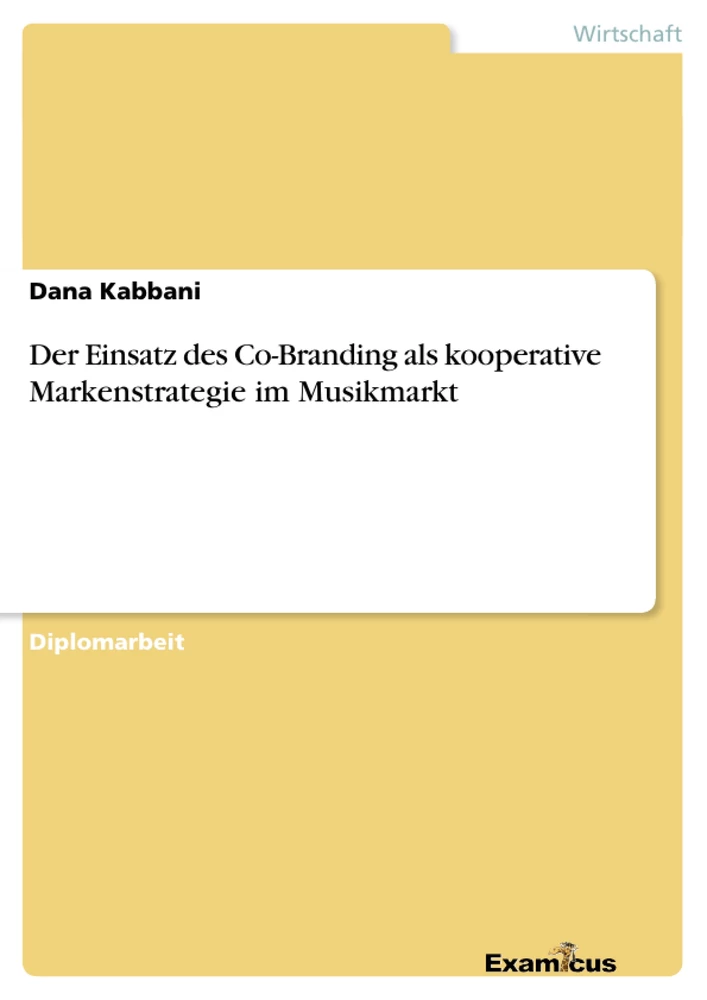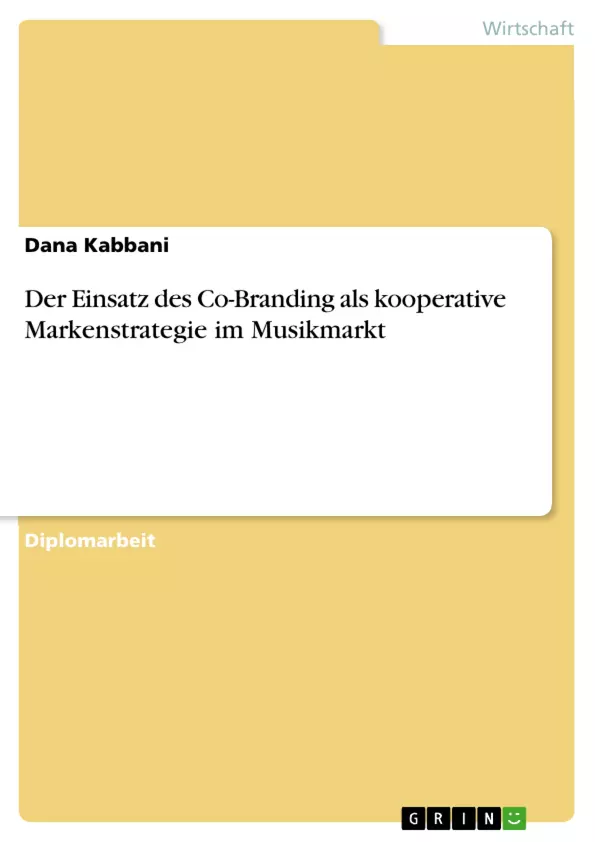Ziel dieser Arbeit ist einerseits die Darstellung der bisherigen Erkenntnisse über das Co-Branding in der Wissenschaft und Praxis und andererseits der Versuch, erstmals einen integrativen
Ansatz des Co-Branding in Hinblick auf den Musikmarkt zu präsentieren. Dabei werden Ergebnisse der Testimonial-, der Sponsoring- und der Co-Branding-Forschung
ausgewertet und zusammengeführt. Folgende Fragestellungen werden dabei berücksichtigt: Was ist Co-Branding?
Inwieweit unterscheidet sich Co-Branding von anderen Markenstrategien? Wie beeinflußt
das Co-Branding die Einstellung der Konsumenten gegenüber den beteiligten Marken?
Kann in diesem Zusammenhang das Co-Branding mit Künstlern bzw. Tonträgerfirmen
einen ausschlaggebenden Faktor für den Konsumenten bilden, sich für die Co-Branding-Leistung zu entscheiden? Welche Formen des Co-Branding im Musikmarkt gibt es? Kann
ein zusätzlicher Wert durch das Co-Branding geschaffen werden? Unter welchen Umständen
stellt Co-Branding eine angemessene Strategie dar? Welche Eigenschaften sollte ein
guter Co-Branding-Partner erfüllen? An diesen Fragestellungen orientiert sich der Aufbau der Arbeit. Der erste Teil
widmet sich den begrifflich-konzeptionellen Grundlagen des Co-Branding. Neben der Klärung
der Begriffe „Marke“ und „Markenwert“ steht die anschließende Definition des Begriffes „Co -Branding“ im Mittelpunkt, wobei eine Abgrenzung zu verwandten Termini
vorgenommen wird. Zusätzlich wird die Wirkungsweise des Co-Branding aus verhaltenswissenschaftlicher
und informationsökonomischer Sicht erklärt. Den Abschluß des ersten
Kapitels bildet eine aktuelle Darstellung der empirischen Forschung zum Co-Branding. Der zweite Teil der Arbeit befaßt sich mit den Formen des Co-Branding im Musikmarkt.
Hierbei bildet ein kurzer Abriß über den Musikmarkt den Zugang zu diesem
Themenfeld. Das Konzept der Marke bezogen auf den Musikmarkt, die Rolle der Musik
und des Künstlers bilden den Kern dieses Kapitels. Anhand von Beispielen sollen die verschiedenen
Formen des Co-Branding im Musikmarkt anschließend veranschaulicht
werden. Der dritte und letzte Teil diskutiert die Chancen und Risken der Co-Branding-Strategie und schließt mit Implikationen für ein erfolgreiches Co-Branding.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Co-Branding: Begriff, terminologische Abgrenzung und theoretische Fundierung
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.1.1 Begriff der Marke
- 2.1.2 Begriff des Markenwertes
- 2.1.3 Definition des Co-Branding
- 2.2 Abgrenzung des Co-Branding zu verwandten Termini
- 2.3 Erklärungsansätze für die Wirkung des Co-Branding
- 2.3.1 Verhaltenswissenschaftlicher Erklärungsansatz
- 2.3.2 Informationsökonomischer Erklärungsansatz
- 2.4 Empirische Untersuchungen zum Co-Branding
- 3. Formen des Co-Branding im Musikmarkt
- 3.1 Struktur des Musikmarktes
- 3.2 Das Konzept der Marke im Musikmarkt
- 3.2.1 Der Künstler als Marke
- 3.2.2 Die Tonträgerfirma als Marke
- 3.3 Der Einsatz von Musik als Medium
- 3.3.1 Die Rolle der Musik im Co-Branding
- 3.3.2 Die Rolle des Künstlers im Co-Branding
- 3.4 Ausprägungen und Beispiele des Co-Branding im Musikmarkt
- 3.4.1 Co-Branding zwischen Künstlern
- 3.4.2 Co-Branding zwischen Künstlern und Tonträgerfirmen
- 3.4.3 Co-Branding zwischen Tonträgerfirmen
- 3.4.4 Co-Branding zwischen Künstlern und Markenartikelherstellern
- 3.4.5 Co-Branding zwischen Tonträgerfirmen und Markenartikelherstellern
- 4. Beurteilung des Co-Branding
- 4.1 Chancen des Co-Branding
- 4.2 Risiken des Co-Branding
- 4.3 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Co-Branding
- 4.3.1 Fit und Match-Up-Hypothese
- 4.3.2 Partnerselektion
- 5. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Einsatz von Co-Branding als kooperative Markenstrategie im Musikmarkt. Die Arbeit hat zum Ziel, den Begriff Co-Branding zu definieren, von ähnlichen Konzepten abzugrenzen und dessen Wirkung theoretisch zu fundieren. Weiterhin werden verschiedene Formen des Co-Branding im Musikmarkt analysiert und Chancen sowie Risiken dieser Strategie bewertet.
- Definition und Abgrenzung des Co-Branding
- Theoretische Erklärungsansätze für die Wirkung von Co-Branding
- Formen des Co-Branding im Musikmarkt
- Chancen und Risiken des Co-Branding
- Voraussetzungen für erfolgreiches Co-Branding
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Co-Branding im Musikmarkt ein und beschreibt die Problemstellung der Arbeit. Es skizziert die Zielsetzung und den Aufbau der folgenden Kapitel.
2. Co-Branding: Begriff, terminologische Abgrenzung und theoretische Fundierung: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition von Co-Branding und grenzt es von verwandten Marketingstrategien ab. Es werden verschiedene theoretische Erklärungsansätze, insbesondere verhaltenswissenschaftliche und informationsökonomische Perspektiven, vorgestellt, um die Wirkung von Co-Branding zu beleuchten. Der Kapitel beinhaltet außerdem eine Übersicht über empirische Untersuchungen zu diesem Thema.
3. Formen des Co-Branding im Musikmarkt: Dieses Kapitel analysiert die Struktur des Musikmarktes und das Konzept der Marke im Kontext von Künstlern und Tonträgerfirmen. Es untersucht die Rolle von Musik als Medium im Co-Branding und präsentiert verschiedene Ausprägungen und Beispiele für Co-Branding-Strategien im Musikmarkt, einschließlich Kooperationen zwischen Künstlern, Tonträgerfirmen und Markenartikelherstellern.
4. Beurteilung des Co-Branding: In diesem Kapitel werden die Chancen und Risiken von Co-Branding-Strategien im Musikmarkt bewertet. Es werden Voraussetzungen für ein erfolgreiches Co-Branding, wie die "Fit und Match-Up-Hypothese" und die Partnerselektion, detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Co-Branding, Markenstrategie, Musikmarkt, Künstler, Tonträgerfirma, Markenartikelhersteller, Markenwert, Verhaltenswissenschaft, Informationsökonomie, Chancen, Risiken, Partnerselektion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Co-Branding im Musikmarkt
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht den Einsatz von Co-Branding als kooperative Markenstrategie im Musikmarkt. Es werden der Begriff Co-Branding definiert, von ähnlichen Konzepten abgegrenzt und dessen Wirkung theoretisch fundiert. Verschiedene Formen des Co-Branding im Musikmarkt werden analysiert und Chancen sowie Risiken dieser Strategie bewertet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung des Co-Branding, theoretische Erklärungsansätze für die Wirkung von Co-Branding (verhaltenswissenschaftliche und informationsökonomische Perspektiven), Formen des Co-Branding im Musikmarkt (zwischen Künstlern, Tonträgerfirmen und Markenartikelherstellern), Chancen und Risiken des Co-Branding und Voraussetzungen für erfolgreiches Co-Branding (Fit und Match-Up-Hypothese, Partnerselektion).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Aufbau), Begriffsbestimmung und theoretische Fundierung von Co-Branding, Formen des Co-Branding im Musikmarkt (inkl. Strukturanalyse des Musikmarktes und der Rolle von Musik als Medium), Beurteilung des Co-Branding (Chancen, Risiken, Voraussetzungen für Erfolg) und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet.
Welche Arten von Co-Branding im Musikmarkt werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Ausprägungen von Co-Branding im Musikmarkt: Co-Branding zwischen Künstlern, zwischen Künstlern und Tonträgerfirmen, zwischen Tonträgerfirmen, zwischen Künstlern und Markenartikelherstellern und zwischen Tonträgerfirmen und Markenartikelherstellern. Beispiele für diese Formen werden vorgestellt.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Erklärung der Wirkung von Co-Branding verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verhaltenswissenschaftliche und informationsökonomische Erklärungsansätze, um die Wirkung von Co-Branding zu beleuchten. Empirische Untersuchungen zu diesem Thema werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Chancen und Risiken des Co-Branding werden diskutiert?
Die Arbeit bewertet die Chancen und Risiken von Co-Branding-Strategien im Musikmarkt. Es werden Voraussetzungen für ein erfolgreiches Co-Branding, wie die "Fit und Match-Up-Hypothese" und die Partnerselektion, detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Co-Branding, Markenstrategie, Musikmarkt, Künstler, Tonträgerfirma, Markenartikelhersteller, Markenwert, Verhaltenswissenschaft, Informationsökonomie, Chancen, Risiken, Partnerselektion.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse jedes Abschnitts zusammenfasst. Diese Zusammenfassung bietet einen Überblick über die gesamte Arbeit.
- Quote paper
- Dana Kabbani (Author), 2001, Der Einsatz des Co-Branding als kooperative Markenstrategie im Musikmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185796