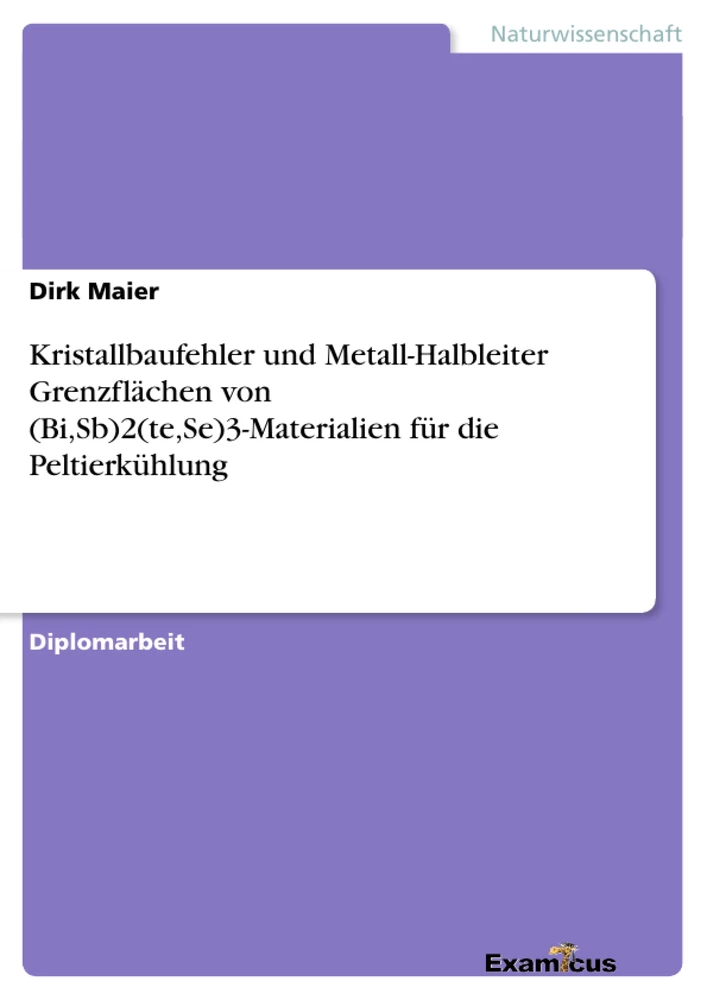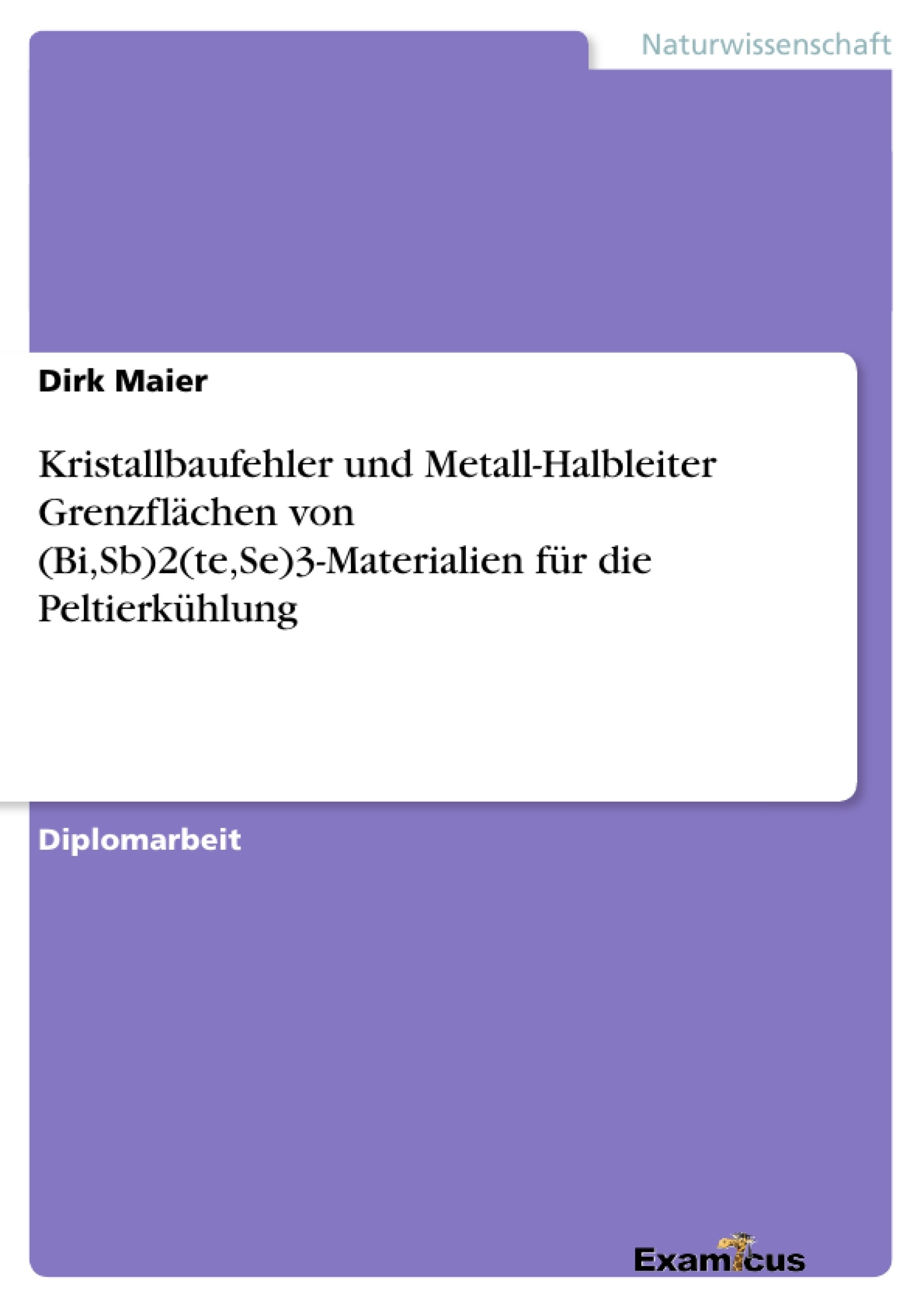Beim Seebeck- und Peltiereffekt handelt es sich um Nichtgleichgewichtszustände, für deren
Beschreibung die linearisierte Boltzmann'sche Transporttheorie herangezogen wird. Diese
beschreibt die Änderung der Verteilungsfunktion der Elektronenzustände im Zeitverlauf von
t nach t+dt durch 3 Prozesse:
Ladungsträger wandern mit der Geschwindigkeit v(k).
Unter der Wirkung äusserer Felder besetzen die Ladungsträger, die zur Zeit t Zustände
(k-dk/dt)dt innehatten die Zustände k
Durch Streuprozesse werden Ladungsträger aus anderen Zuständen k' in einen betrachteten
Zustand k gebracht oder aus diesem Zustand in andere Zustände k' überführt
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Seebeck- und Peltiereffekt
- 1.2 Grundlagen des Seebeck- und Peltierkoeffizient
- 1.2.1 Elektronischer Anteil zum Seebeck- und Peltierkoeffizient im nicht entarteten Halbleiter
- 1.2.2 Phononischer Anteil am Seebeck- und Peltierkoeffizient
- 1.2.2.1 Zusammenfassung
- 1.2.3 Vergleich der Theorie für nichtentarteten Halbleitern mit Bi2Te3
- 1.3 Aufbau eines Peltierelements
- 1.3.1 Wirkungsgrad von Peltierelementen
- 2 Bi2Te3
- 2.1 Einheitszelle von Bi2Te3
- 2.1.1 Dotierung von Bi2Te3
- 2.1.2 Daten von Bi2Te3
- 3 Grundlagen der verwendeten Geräte
- 3.1 REM und EDX
- 3.2 ESMA (Elektronenstrahl Mikrosondenanalyse)
- 3.3 TEM
- 3.3.1 Wellenvektor
- 3.3.2 Anregungsfehler
- 3.4 Der Zweistrahlfall
- 3.4.1 Kikuchilinien
- 3.5 TEM-Hellfeld und Dunkelfeldabbildung
- 3.6 Spannungs- und Biegekontrast
- 3.6.1 Biegekontrast
- 3.6.2 Spannungskontrast
- 3.7 Hochauflösende TEM (HRTEM)
- 4 Materialanalyse
- 4.1 Verwendete Proben
- 4.1.1 TEM-Probenpräperation
- 4.1.2 REM-Proben Präparation
- 4.2 REM-Analyse der Metall-Halbleiter Grenzfläche
- 4.3 Chemische Zusammensetzung von n- und p-dotiertem Bi2Te3
- 4.3.1 Elektronenstrahl Mikrosonden -Analyse
- 4.3.2 ESMA - Messungen an n-dotiertem Bi2(Se, Te)3 und p-dotiertem (Sb,Bi)2Te3
- 4.3.3 Ergebnisse der Messungen
- 4.3.4 Diskussion der Messergebnisse
- 4.3.5 Zusammenfassung
- 4.4 TEM-Analyse von Bi2Te3
- 4.4.1 Domänenstruktur
- 4.4.1.1 Mögliche Konsequenzen der Spannungsdomänen auf die thermoelektri- scher Eigenschaften
- 4.4.1.2 Zusammenfassung
- 4.5 Kleinwinkelkorngrenzen
- 4.5.1 n-dotiertes (Bi, Sb)2(Te,Se)3
- 4.5.2 p-dotiertes (Bi, Sb)2(Te,Se)3
- 4.5.2.1 Zusammenfassung
- 5 Dünnfilmherstellung
- 5.1 Vorbehandlung
- 5.1.1 Mechanische Politur
- 5.2 Chemische Behandlung
- 5.3 Aufdampf- und Sputterverfahren
- 5.4 Analyse der Metall-Halbleiter Grenzfläche
- 5.4.1 REM Analyse
- 5.4.1.1 p-dotiertes Bi2Te3
- 5.4.1.2 n-dotiertes Bi2Te3
- 5.4.2 SIMS Analyse
- 5.4.3 Zusammenfassung
- 6 Zusammenfassung
- 7 Anhang
- 7.1 Messprotokoll Elektronenstrahl Mikrosonde
- 7.1.1 n-dotiertes Bi2Te3
- 7.1.2 p-dotiertes Bi2Te3
- 7.2 Corel Photopaint 8 Scripts
- 7.3 JCPDS Auszug
- 7.4 Verwendete Mikroskope und deren Daten
- 8 Danksagung
- Charakterisierung von Kristallbaufehlern in (Bi,Sb)2(Te,Se)3-Materialien
- Analyse der Metall-Halbleiter-Grenzfläche
- Zusammenhang zwischen Kristallbaufehlern und thermoelektrischen Eigenschaften
- Optimierung der Materialeigenschaften für die Peltierkühlung
- Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von effizienten Peltierelementen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Untersuchung von Kristallbaufehlern und Metall-Halbleiter-Grenzflächen in (Bi,Sb)2(Te,Se)3-Materialien, die für die Peltierkühlung relevant sind. Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen dieser Baufehler auf die thermoelektrischen Eigenschaften der Materialien zu analysieren und somit einen Beitrag zum Verständnis der Funktionsweise von Peltierelementen zu leisten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Peltierkühlung ein und erläutert die grundlegenden physikalischen Prinzipien des Seebeck- und Peltiereffekts. Es werden die relevanten Materialeigenschaften und die Funktionsweise von Peltierelementen beschrieben.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Halbleitermaterial Bi2Te3, das eine wichtige Rolle in der Peltierkühlung spielt. Die Einheitszelle von Bi2Te3 wird vorgestellt und die Dotierungsmöglichkeiten des Materials werden erläutert. Es werden wichtige Daten zu den thermoelektrischen Eigenschaften von Bi2Te3 zusammengefasst.
Kapitel 3 beschreibt die Grundlagen der verwendeten Geräte, die für die Materialanalyse eingesetzt werden. Es werden die Funktionsweise und die Anwendungsmöglichkeiten von Rasterelektronenmikroskopie (REM), Elektronenstrahl Mikrosondenanalyse (ESMA) und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) erläutert.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Materialanalyse. Es werden die Ergebnisse der REM- und ESMA-Analysen der Metall-Halbleiter-Grenzfläche sowie die TEM-Analyse der Kristallbaufehler in Bi2Te3 vorgestellt. Die Auswirkungen der Baufehler auf die thermoelektrischen Eigenschaften werden diskutiert.
Kapitel 5 beschreibt die Herstellung von Dünnfilmen aus (Bi,Sb)2(Te,Se)3-Materialien. Es werden die verschiedenen Verfahren zur Vorbehandlung, zur chemischen Behandlung und zur Abscheidung der Dünnfilme erläutert. Die Analyse der Metall-Halbleiter-Grenzfläche in den Dünnfilmen wird vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Peltierkühlung, thermoelektrische Materialien, (Bi,Sb)2(Te,Se)3, Kristallbaufehler, Metall-Halbleiter-Grenzfläche, REM, ESMA, TEM, Dünnfilmherstellung, Materialanalyse, thermoelektrische Eigenschaften.
- Quote paper
- Dirk Maier (Author), 2001, Kristallbaufehler und Metall-Halbleiter Grenzflächen von (Bi,Sb)2(te,Se)3-Materialien für die Peltierkühlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185720