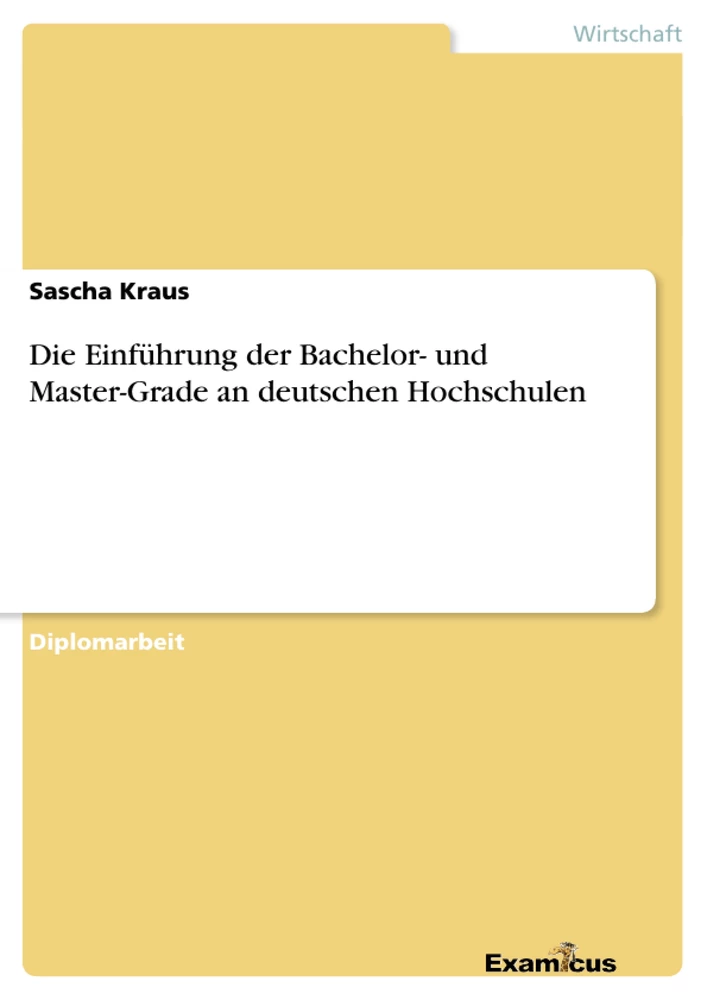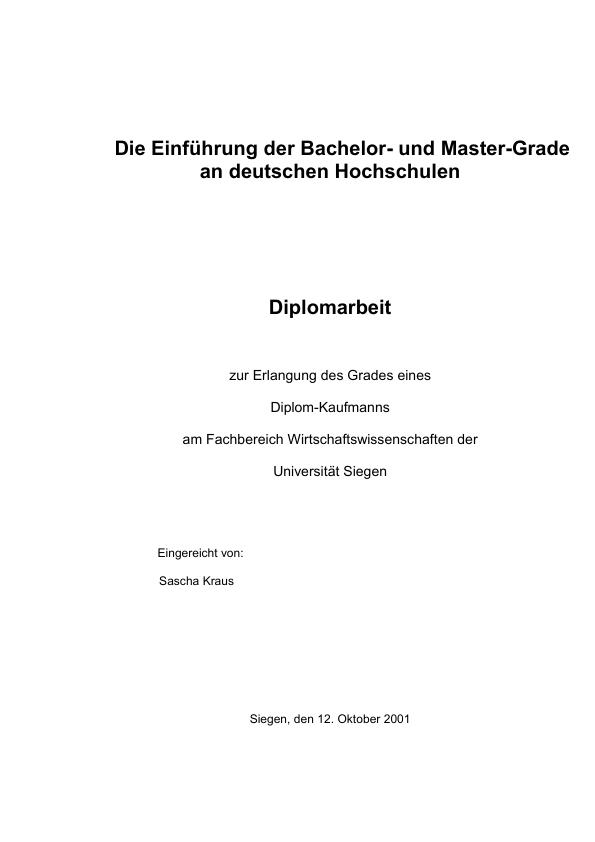Die Einführung der Bachelor- und Master-Grade an deutschen Hochschulen ist inzwischen nicht mehr nur eine blosse Übersetzung bzw. Angleichung der Grade an den Bildungsweltmarkt, sondern möglicherweise Beginn der grössten Studienreform nach Einführung des humboldtschen Universitätsmodells Ende des 19. Jahrhunderts. Korrekt angewendet kann die Grundidee des preussischen Direktors für Unterricht und Erziehung Wilhelm von Humboldt (Einheit von Forschung und Lehre sowie Persönlichkeitsbildung durch Wissenschaft) auch in der heutigen Zeit und innerhalb der neuen Studiengänge seine Berechtigung finden, was diese Arbeit darzustellen versucht.8 Zudem wird ein Versuch unternommen, die neuen Abschlüsse anhand ihrer Vorbilder im anglo-amerikanischen Hochschulsystem zu erklären, mit den deutschen zu vergleichen und unter Einbeziehung von Erfahrungen anderer europäischer Staaten einen Ausblick auf mögliche zukünftige Studienmodelle zu geben. Hierbei soll ein besonderer Augenmerk auf den Wirtschaftswissenschaften liegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Einführung
- 1.2. Geschichte
- 2. Hochschulsysteme
- 2.1. Die Hochschulsysteme Europas
- 2.1.1. Einteilung
- 2.1.2. Kompatibilität
- 2.1.3. Erfahrungen
- 2.2. Das anglo-amerikanische System
- 2.2.1. Studienberechtigung und Studentenprofil
- 2.2.2. Ablauf, Dauer und Kosten des Studiums
- 2.2.3. Das britische System
- 2.2.4. Das amerikanische System
- 2.3. Das deutsche System
- 2.3.1. Studienberechtigung und Studentenprofil
- 2.3.2. Ablauf, Dauer und Kosten des Studiums
- 2.3.3. Studienabbruch und Studienunterbrechung
- 2.3.4. Integrierte / Gestufte Studiengänge
- 2.3.5. Fachhochschulen
- 3. Politische und rechtliche Rahmenbedingungen
- 3.1. Sorbonne-Erklärung
- 3.2. Bologna-Erklärung
- 3.3. Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
- 3.4. Wissenschaftsrat
- 3.5. Hochschulrahmengesetz
- 4. Akkreditierung und Qualitätssicherung
- 4.1. Akkreditierung in den USA
- 4.2. Akkreditierung in Grossbritannien
- 4.3. Akkreditierung in Deutschland
- 5. Umsetzung
- 5.1. Studierbarkeit
- 5.1.1. Diploma Supplement
- 5.1.2. Leistungspunkte
- 5.1.3. Teilzeitstudium
- 5.2. Studiengänge
- 5.2.1. Naturwissenschaften
- 5.2.2. Geisteswissenschaften
- 5.2.3. Wirtschaftswissenschaften
- 5.3. Wandel
- 5.4. Berufsbefähigung
- 5.5. Akzeptanz
- 5.5.1. Unternehmen / Wirtschaft
- 5.5.2. Studenten
- 5.5.3. Konkrete Umsetzung
- 5.6. Finanzierung
- 6. Resumé
- 6.1. Interne Reform
- 6.1.1. Akzeptanz und Berufsbefähigung
- 6.1.2. Studienzeitverkürzung und Abbrecherquoten
- 6.1.3. Fachhochschulen
- 6.1.4. Akkreditierung
- 6.1.5. Finanzierung
- 6.2. Externe Kompatibilität
- 6.2.1. Mobilität
- 6.2.2. Internationalisierung
- 6.3. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Einführung der Bachelor- und Master-Studiengänge an deutschen Hochschulen. Die Arbeit analysiert die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen im Hinblick auf die interne Reform des deutschen Hochschulsystems und die internationale Vergleichbarkeit.
- Reform des deutschen Hochschulsystems
- Internationale Vergleichbarkeit von Studiengängen
- Akkreditierung und Qualitätssicherung
- Akzeptanz der neuen Studiengänge bei Unternehmen und Studenten
- Finanzierung der neuen Studiengänge
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bachelor- und Master-Reform an deutschen Hochschulen ein und gibt einen kurzen historischen Überblick über die Entwicklung des deutschen Hochschulsystems.
2. Hochschulsysteme: Dieses Kapitel vergleicht das deutsche Hochschulsystem mit anglo-amerikanischen Systemen, analysiert Unterschiede in Studienstruktur, Dauer, Kosten und Zugangsvoraussetzungen. Es beleuchtet auch Aspekte wie Studienabbruchquoten und die Rolle von Fachhochschulen.
3. Politische und rechtliche Rahmenbedingungen: Hier werden die politischen und rechtlichen Grundlagen der Hochschulreform, insbesondere die Sorbonne- und Bologna-Erklärungen, sowie die Rolle der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und des Wissenschaftsrates, erörtert. Das Hochschulrahmengesetz wird ebenfalls eingehend betrachtet.
4. Akkreditierung und Qualitätssicherung: Dieses Kapitel widmet sich der Akkreditierung und Qualitätssicherung von Studiengängen im internationalen Vergleich (USA, Großbritannien, Deutschland), um die damit verbundenen Herausforderungen und Standards zu verdeutlichen.
5. Umsetzung: Das Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung der Bachelor-Master-Reform in Deutschland. Es behandelt Aspekte wie Studierbarkeit (z.B. Leistungspunkte, Teilzeitstudium), die Gestaltung verschiedener Studiengänge, den Wandel im Hochschulsystem, die Berufsbefähigung der Absolventen und die Akzeptanz der Reform bei Unternehmen und Studenten. Die Finanzierung der Reform wird ebenfalls beleuchtet.
6. Resumé (ohne 6.3 Ausblick): Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, indem sie die interne Reform des deutschen Hochschulsystems (Akzeptanz, Berufsbefähigung, Studienzeitverkürzung, Abbrecherquoten, Fachhochschulen, Akkreditierung, Finanzierung) und die externe Kompatibilität (Mobilität, Internationalisierung) kritisch beleuchtet. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus den vorangegangenen Kapiteln präsentiert, ohne jedoch die konkreten Ergebnisse des Ausblicks vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Bachelor, Master, Bologna-Prozess, Hochschulreform, Hochschulsystem, Studiengang, Akkreditierung, Qualitätssicherung, Internationalisierung, Kompatibilität, Berufsbefähigung, Studienabbruch, Fachhochschulen, Finanzierung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Bachelor- und Master-Reform an deutschen Hochschulen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen an deutschen Hochschulen. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen dieser Reform im Hinblick auf die interne Verbesserung des deutschen Hochschulsystems und die internationale Vergleichbarkeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Reform des deutschen Hochschulsystems, der internationale Vergleich von Studiengängen, Akkreditierung und Qualitätssicherung, die Akzeptanz der neuen Studiengänge bei Unternehmen und Studenten sowie die Finanzierung der Reform.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Hochschulsysteme (im Vergleich zu angloamerikanischen Systemen), Politische und rechtliche Rahmenbedingungen (Sorbonne- und Bologna-Erklärung, HRK, Wissenschaftsrat, Hochschulrahmengesetz), Akkreditierung und Qualitätssicherung (im internationalen Vergleich), Umsetzung (Studierbarkeit, Studiengänge, Wandel, Berufsbefähigung, Akzeptanz, Finanzierung) und Resumé (interne und externe Kompatibilität, Ausblick).
Welche Hochschulsysteme werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das deutsche Hochschulsystem mit angloamerikanischen Systemen (britisches und amerikanisches System), wobei Unterschiede in Studienstruktur, Dauer, Kosten und Zugangsvoraussetzungen analysiert werden. Auch Aspekte wie Studienabbruchquoten und die Rolle von Fachhochschulen werden beleuchtet.
Welche politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen werden betrachtet?
Die Arbeit erörtert die Sorbonne- und Bologna-Erklärungen, die Rolle der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und des Wissenschaftsrates sowie das Hochschulrahmengesetz als politische und rechtliche Grundlagen der Hochschulreform.
Wie wird die Akkreditierung und Qualitätssicherung behandelt?
Das Kapitel zur Akkreditierung und Qualitätssicherung analysiert diese Aspekte im internationalen Vergleich (USA, Großbritannien, Deutschland), um die Herausforderungen und Standards zu verdeutlichen.
Wie wird die praktische Umsetzung der Reform beschrieben?
Die Umsetzung der Bachelor-Master-Reform wird anhand von Aspekten wie Studierbarkeit (Leistungspunkte, Teilzeitstudium), Gestaltung verschiedener Studiengänge, Wandel im Hochschulsystem, Berufsbefähigung der Absolventen, Akzeptanz bei Unternehmen und Studenten sowie Finanzierung beleuchtet.
Was beinhaltet das Resümee der Arbeit?
Das Resümee fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen. Es beleuchtet kritisch die interne Reform des deutschen Hochschulsystems (Akzeptanz, Berufsbefähigung, Studienzeitverkürzung, Abbrecherquoten, Fachhochschulen, Akkreditierung, Finanzierung) und die externe Kompatibilität (Mobilität, Internationalisierung). Es präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bachelor, Master, Bologna-Prozess, Hochschulreform, Hochschulsystem, Studiengang, Akkreditierung, Qualitätssicherung, Internationalisierung, Kompatibilität, Berufsbefähigung, Studienabbruch, Fachhochschulen, Finanzierung.
- Quote paper
- Sascha Kraus (Author), 2001, Die Einführung der Bachelor- und Master-Grade an deutschen Hochschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185693