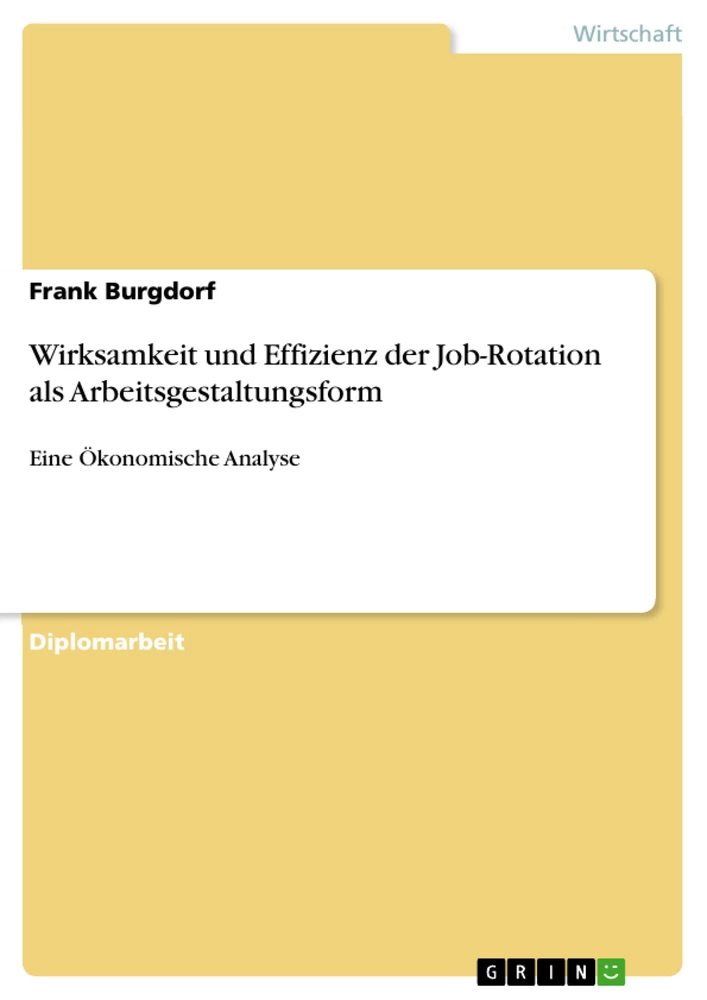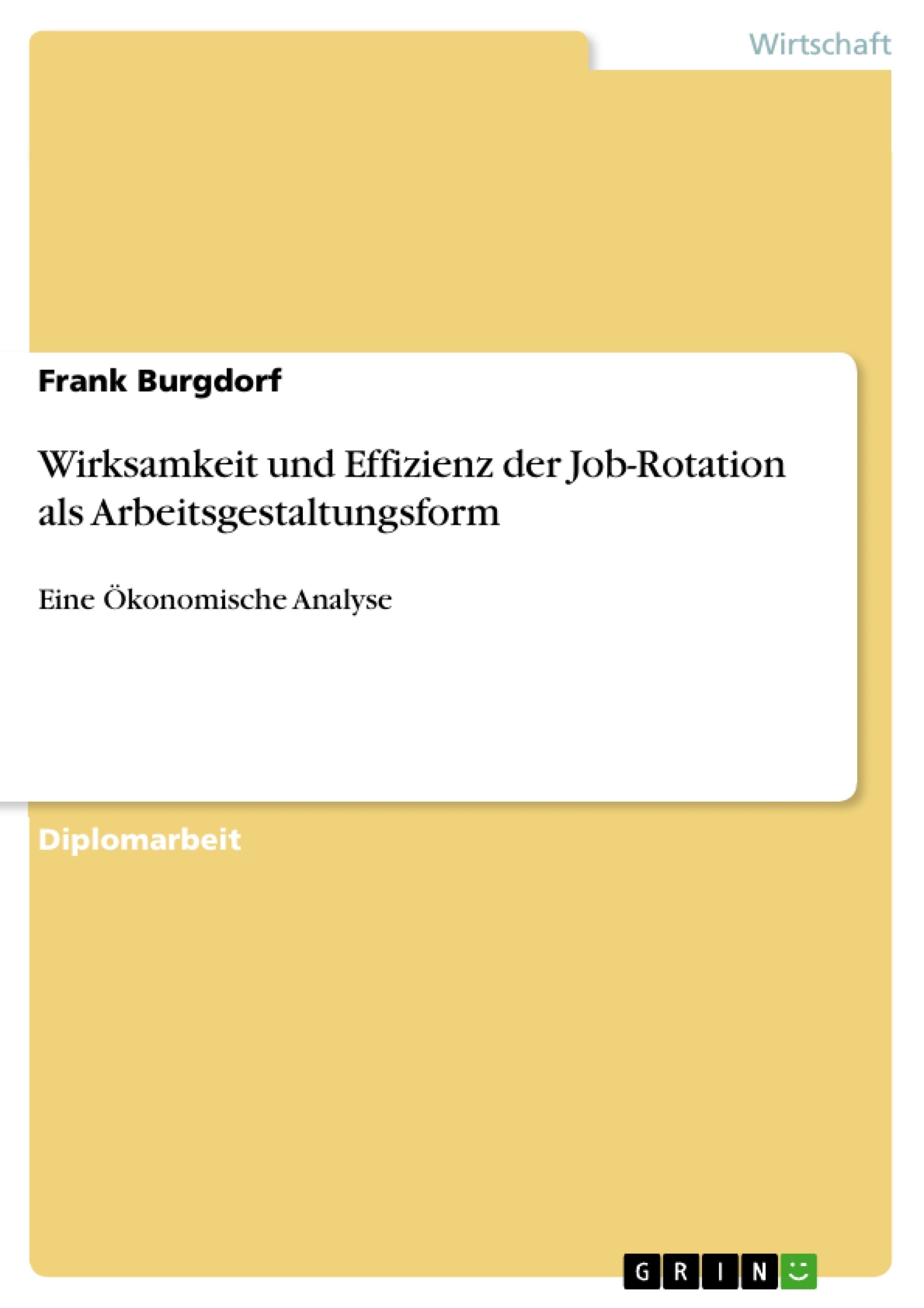Die Problemstellung dieser Arbeit ergibt sich aus der Frage nach der Wirksamkeit und Effizienz der Job-Rotation als Arbeitsgestaltungsform. Eine Antwort soll auf dem Weg von der Entstehungsgeschichte über die Standortbestimmung von heute bis hin zu einer ormalen Nachweisrechnung gefunden werden. Der Aufbau dieser Ausarbeitung wird somit wie folgend aussehen:
Anhand unterschiedlicher geschichtlicher Studien erfolgt anfangs eine Darstellung der historischen Entwicklung des Rotationsprinzips. Dabei soll deutlich werden, daß die ursprüngliche Idee nicht unbedingt einem bestimmten Kultur- bzw. Gesellschaftsbereich entstammen muß.
Hernach erfolgt eine realistische Standortbestimmung der Job-Rotation in unserer heutigen globalen Marktwirtschaft. Dabei werden vor allem die großen Industrienationen im Westen und Osten betrachtet und das jeweilige Verständnis für diese Arbeitsform und deren Anwendungsbereiche geschildert. Dem Leser soll ein Gefühl für die Bedeutung der Job-Rotation in den Unternehmen unterschiedlicher Kulturräume vermittelt werden. Daraus lassen sich die Aufgaben und die Gestaltungsparameter der Rotationsmodelle ermitteln. Sie dienen dem Wissen um die Gründe, die für den Einsatz von Job-Rotationen sprechen. Die nachfolgenden Fallstudien sollen die Erkenntnisse hinsichtlich der Anwendungsbereiche und Gestaltungsmöglichkeiten in der Theorie anhand von Praxisbeispielen stützen.
Der dritte Block der Arbeit besteht aus einer formalen Analyse. Die Vor- und Nachteile einer Job-Rotation werden hier in unterschiedlichen mathematischen Modellen analysiert. Das Ziel dieser Modelle ist, unabhängig von äußeren Einflußgrößen, wie beispielsweise der Kultur oder individuellen Präferenzen, die Effizienz und Wirksamkeit der Job-Rotation gegenüber einer fundamental konträren Arbeitsform, der Spezialisierung, darzustellen. Die Analyse folgt einer rein wirtschaftswissenschaftlichen Logik, das heißt, die beiden Arbeitsformen werden anhand einfacher und leicht nachzuvollziehender Rechenmodelle miteinander verglichen. Anhand der Ergebnisse sollen Aussagen bezüglich der Kosten, des Nutzens und der Effizienz der Job-Rotation getroffen werden können.
In dem vierten und letzten großen Block wird eine kleine, selbst durchgeführte Studie ausgewertet und auf ihre Aussagekraft im Gesamtkonzept untersucht. Ihre Aufgabe soll es sein, die theoretischen und ökonomischen Modelle und wissenschaftlichen Aussagen dieser Arbeit zu stützen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Job-Rotation im Rahmen des Human Resource Managements: Grundlegende Begriffe
- 3 Die geschichtliche Entwicklung, eine aktuelle Standortbestimmung und die Aufgaben der Job-Rotation
- 3.1 Job-Rotation, eine Historie
- 3.1.1 Job-Rotation, eine amerikanische Geschichte
- 3.1.2 Job-Rotation, eine südosteuropäische Geschichte
- 3.1.3 Job-Rotation, eine japanische Geschichte
- 3.2 Die Entwicklung der Job-Rotation als eigenständige Arbeitsform aus heutiger Sicht
- 3.2.1 Entstehung und Bedeutung der Job-Rotation in den westlichen Industrienationen
- 3.2.2 Entstehung und Bedeutung der Job-Rotation in Japan
- 3.3 Die Aufgaben und Gestaltungsparameter der Job-Rotation
- 3.3.1 Humanisierung der Arbeit
- 3.3.2 Gesundheitsaspekte
- 3.3.3 Produktivität
- 3.3.4 Gestaltungsparameter der Job-Rotation
- 3.4 Fallstudien
- 3.4.1 NISSAN
- 3.4.2 BQG Herzogtum Lauenburg
- 3.5 Zusammenfassung
- 3.1 Job-Rotation, eine Historie
- 4 Job-Rotation versus Spezialisierung: Eine modellhafte Analyse
- 4.1 Die Spezialisierung als Gegenstück zur Job-Rotation
- 4.2 Job-Rotation: Eine Analyse von Metin M. Cosgel und Thomas J. Miceli
- 4.2.1 Der Nutzen eines Mitarbeiters
- 4.2.2 Präferenzen der Arbeitnehmer bezüglich einer Arbeitsform
- 4.2.3 Entscheidungsfindung aus Sicht der Unternehmung
- 4.2.4 Erhöhte Produktivität durch Job-Rotationen in Verbindung mit Anreizsystemen
- 4.2.5 Schlußbemerkung zu Cosgel und Miceli
- 4.3 Job-Rotation: Eine Analyse von Assar Lindbeck und Dennis J. Snower
- 4.3.1 Ein mögliches Modell der Arbeitsorganisation
- 4.3.2 Einflußfaktoren, die eine Entscheidung hinsichtlich einer Arbeitsform beeinflussen
- 4.3.3 Argumente, die für eine Job-Rotation sprechen
- 4.3.4 Schlußbemerkung zu Lindbeck und Snower
- 5 Eine empirische Untersuchung
- 5.1 Struktur und Aufbau des Fragenkatalogs
- 5.2 Auswahl der Unternehmen
- 5.3 Resonanz der Unternehmen
- 5.4 Die Auswertung
- 5.5 Schlußfolgerungen aus der empirischen Untersuchung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die ökonomische Analyse von Job Rotation. Ziel ist es, die Wirksamkeit und Effizienz von Job Rotation als Arbeitsgestaltungsform zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet die historische Entwicklung, aktuelle Standortbestimmung und Gestaltungsparameter von Job Rotation. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Vergleich von Job Rotation und Spezialisierung anhand modellhafter Analysen.
- Historische Entwicklung und aktuelle Bedeutung von Job Rotation
- Vergleich Job Rotation vs. Spezialisierung
- Ökonomische Aspekte von Job Rotation (Produktivität, Humanisierung der Arbeit)
- Gestaltungsparameter und Einflussfaktoren von Job Rotation
- Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Job Rotation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der ökonomischen Analyse von Job Rotation ein und beschreibt den Kontext innerhalb verschiedener Personalmanagement-Konzepte. Sie betont die Bedeutung der optimalen Nutzung menschlicher Ressourcen und positioniert Job Rotation als einen Aspekt dieser Strategien. Die Einleitung hebt die Notwendigkeit einer umfassenderen Untersuchung der Job Rotation hervor, insbesondere im Vergleich zur Spezialisierung, und skizziert die Forschungslücken, die die Arbeit zu schließen versucht.
2 Job-Rotation im Rahmen des Human Resource Managements: Grundlegende Begriffe: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis von Job Rotation. Es definiert den Begriff, beschreibt verschiedene Formen und Komplexitätsgrade, und betont die Bedeutung im Kontext des Human Resource Managements. Es schafft so ein solides Fundament für die weiteren Kapitel, indem es die wichtigsten Begriffe und Konzepte der Job Rotation klar stellt und deren Positionierung innerhalb des Human Resource Managements veranschaulicht.
3 Die geschichtliche Entwicklung, eine aktuelle Standortbestimmung und die Aufgaben der Job-Rotation: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Job Rotation, beleuchtet ihre Entwicklung in verschiedenen Ländern (USA, Südosteuropa, Japan) und analysiert ihre aktuellen Aufgaben und Gestaltungsparameter. Es werden sowohl historische als auch aktuelle Entwicklungen und deren Einfluss auf die Gestaltung von Job Rotation-Programmen analysiert. Die Fallstudien von Nissan und BQG Herzogtum Lauenburg liefern konkrete Beispiele für die Anwendung und die Herausforderungen von Job Rotation in der Praxis.
4 Job-Rotation versus Spezialisierung: Eine modellhafte Analyse: Dieses Kapitel vergleicht Job Rotation mit Spezialisierung, dem traditionellen Gegenstück. Es analysiert die Arbeiten von Cosgel/Miceli und Lindbeck/Snower, um die Vor- und Nachteile beider Arbeitsformen zu beleuchten. Es werden die ökonomischen Modelle der Autoren detailliert vorgestellt, ihre Argumente analysiert und in Beziehung zueinander gesetzt. Der Vergleich dieser Modelle verdeutlicht die verschiedenen Perspektiven und bietet ein umfassendes Bild der ökonomischen Implikationen von Job Rotation und Spezialisierung.
5 Eine empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Job Rotation. Es wird der Aufbau des Fragenkatalogs, die Auswahl der Unternehmen und die Auswertung der Daten detailliert dargestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der empirischen Untersuchung liefern wertvolle Informationen über die Praxis der Job Rotation und tragen zur empirischen Untermauerung der theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel bei.
Schlüsselwörter
Job Rotation, Spezialisierung, Human Resource Management, Ökonomische Analyse, Produktivität, Humanisierung der Arbeit, Personalmanagement, Arbeitsorganisation, Modellanalyse, Empirische Untersuchung, Fallstudien, Japanisches Arbeitsmodell.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Ökonomische Analyse von Job Rotation
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die ökonomische Analyse von Job Rotation. Sie beleuchtet die Wirksamkeit und Effizienz von Job Rotation als Arbeitsgestaltungsform, betrachtet die historische Entwicklung, aktuelle Standortbestimmung und Gestaltungsparameter. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Vergleich von Job Rotation und Spezialisierung anhand modellhafter Analysen und einer empirischen Untersuchung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung und aktuelle Bedeutung von Job Rotation, einen Vergleich zwischen Job Rotation und Spezialisierung, ökonomische Aspekte wie Produktivität und Humanisierung der Arbeit, Gestaltungsparameter und Einflussfaktoren von Job Rotation sowie Ergebnisse einer empirischen Untersuchung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Job-Rotation im Rahmen des Human Resource Managements, Geschichtliche Entwicklung und Aufgaben der Job-Rotation, Job-Rotation versus Spezialisierung und eine empirische Untersuchung. Jedes Kapitel baut aufeinander auf und behandelt spezifische Aspekte der Job Rotation.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene Methoden: Literaturrecherche zur historischen Entwicklung und zu theoretischen Modellen, Modellanalysen von Cosgel/Miceli und Lindbeck/Snower zum Vergleich von Job Rotation und Spezialisierung, und eine empirische Untersuchung mit einem Fragenkatalog an ausgewählte Unternehmen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse aus der Literaturrecherche, der Analyse bestehender ökonomischer Modelle (Cosgel/Miceli und Lindbeck/Snower) und einer eigenen empirischen Untersuchung. Diese Ergebnisse beleuchten die Vor- und Nachteile von Job Rotation im Vergleich zur Spezialisierung und geben Aufschluss über die Praxis der Job Rotation in Unternehmen.
Welche Fallstudien werden behandelt?
Die Arbeit beinhaltet Fallstudien von Nissan und BQG Herzogtum Lauenburg, die konkrete Beispiele für die Anwendung und Herausforderungen von Job Rotation in der Praxis liefern.
Welche Länder werden im historischen Kontext betrachtet?
Der historische Kontext betrachtet die Entwicklung von Job Rotation in den USA, Südosteuropa und Japan.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Job Rotation, Spezialisierung, Human Resource Management, Ökonomische Analyse, Produktivität, Humanisierung der Arbeit, Personalmanagement, Arbeitsorganisation, Modellanalyse, Empirische Untersuchung, Fallstudien, Japanisches Arbeitsmodell.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die Struktur und die einzelnen Kapitel der Arbeit. Die Zusammenfassung der Kapitel liefert eine prägnante Beschreibung des Inhalts jedes Kapitels.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die Wirksamkeit und Effizienz von Job Rotation als Arbeitsgestaltungsform zu beleuchten und die ökonomischen Aspekte dieser Arbeitsform zu analysieren.
- Quote paper
- Frank Burgdorf (Author), 1999, Wirksamkeit und Effizienz der Job-Rotation als Arbeitsgestaltungsform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185460