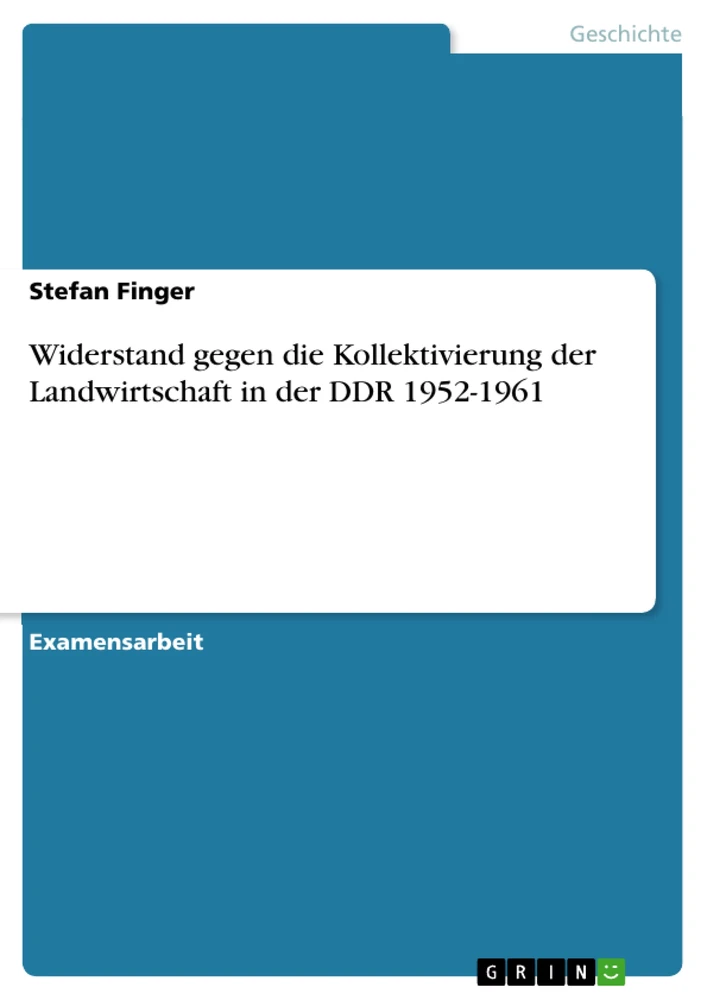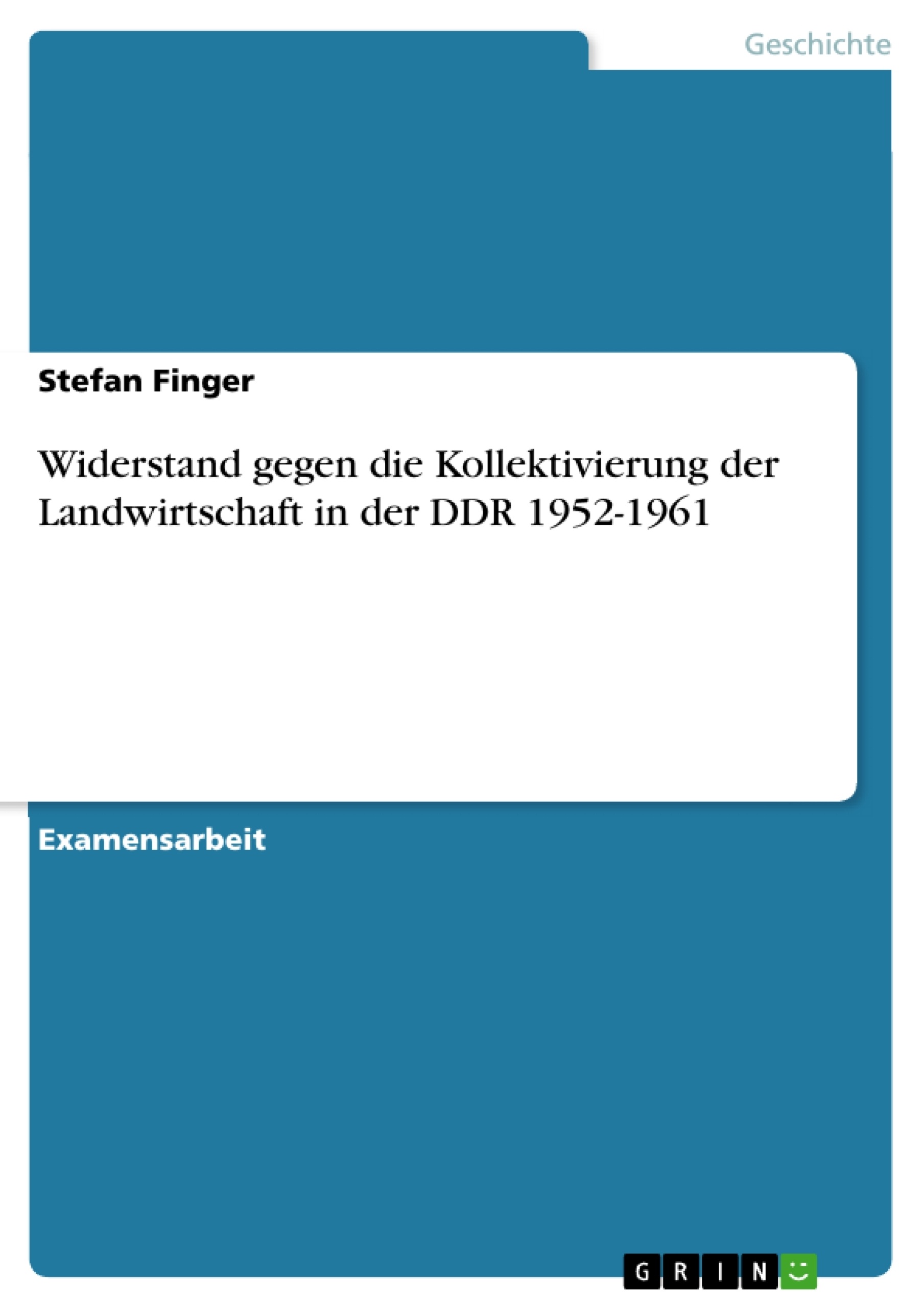Die vorliegende Staatsexamensarbeit befasst sich im Schwerpunkt mit dem Widerstand, welcher von Teilen der Landbevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) gegen die Kollektivierungsmaßnahmen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) in den Jahren 1952 bis 1961 geleistet wurde. Es handelte sich dabei um eine weitverbreitete Gegenwehr, die sich gegen den von der zweiten Parteikonferenz der SED im Juni 1952 beschlossenen „Aufbau des Sozialismus“ auf dem Lande und der damit einhergehenden „Vergenossenschaftlichung“ aller Produktionsmittel richtete. Schließlich sollte nach dem Willen der Partei- und Staatsführung der gesamte bäuerliche Grund und Boden unter „Wahrung der unbedingten Freiwilligkeit“ in Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG / LPGen) zusammengeführt und somit „vergenossenschaftlicht“ werden.
Außerdem sollten die Bauern und Landarbeiter jenen LPGen beitreten. Nicht eben wenige Landwirte folgten diesem Aufruf, gründeten freiwillig Produktionsgenossenschaften und arbeiteten fortan als linientreue Genossenschaftsbauern. Ein Großteil der Landbevölkerung jedoch setzte sich gegen die geforderte Sozialisierung auf vielfältige Art und Weise zur Wehr. Diese Gegenwehr ist es, die im Mittelpunkt der Betrachtungen der vorliegenden Staatsexamensarbeit stehen soll.
Das genaue Ziel der Untersuchungen liegt dabei in der Analyse, Typologisierung und Darstellung jenes widerständigen Verhaltens, obgleich politischer Widerstand weder genau definiert, noch absolut gemessen werden kann und allenfalls relativ und prozessual einzuschätzen ist. Dennoch ist beabsichtigt, die Analyse des widerständigen Verhaltens in der Gliederung umzusetzen, da die Unterteilung und die Abfolge der einzelnen Darstellungen zwangsläufig von der Typologisierung der unterschiedlichen Widerstandsarten abhängig ist. Die zentrale Fragestellung der Examensarbeit lautet also: Auf welche Art und Weise hat die Landbevölkerung der DDR auf die von Partei und Staat aufoktroyierte „Sozialisierung“ ihres Eigentums reagiert und inwieweit lässt sich das jeweilige Verhalten als Widerstand deuten bzw. typisieren?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Industrialisierung zur Zwangskollektivierung: Ein historischer Überblick.
- Die geistigen Väter des Sozialismus und ihre Vorstellungen von der genossenschaftlichen Produktion
- Die Einführung des „,stalinistischen Systems“ in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands
- Die,,antifaschistisch-demokratische Bodenreform“ in der Sowjetzone.
- Der systematische Machtausbau der SED und ihre Reorganisation zur „Partei neuen Typus“...
- Der,,Klassenkampf“ gegen die Großbauern
- Die II. Parteikonferenz der SED und ihr Beschluß zum „Aufbau des Sozialismus“ auf dem Lande
- Die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften
- Die Interdependenz von Fluchtbewegung, Wirtschaftskrise, Normerhöhungen und Volksaufstand
- Der „Neue Kurs“: Eine kurze „Atempause“ auf dem Weg zur Vollkollektivierung.
- Die Zwangskollektivierung: Exodus und Exitus des freien Bauerntums der Deutschen Demokratischen Republik
- Der Bau der Berliner Mauer: Die Fluchtbewegung hat ein Ende.
- Der Widerstand der Landbevölkerung gegen die Kollektivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft.............
- Vorüberlegungen zum Widerstandsbegriff..
- Die Kirche als letzter „legaler Träger“ von Opposition im totalitären Staat
- Die verschiedenen Formen des widerständigen Verhaltens der Landbevölkerung gegen die Kollektivierung..
- Forderungen, Meinungsäußerungen und offener Protest: Der verbale Widerstand als Mindestmaß der Gegenwehr.
- Nonkonformes Verhalten, ziviler Ungehorsam und offene Resistenz..
- Solidarischer Widerstand auf dem Lande: Die „Klasse der Bauern“ hält zusammen.
- Handgreifliche Verweigerung und kämpferische Abwehr von Übergriffen: Die Landbevölkerung demonstriert Entschlossenheit..
- ,,Stichagitationen“ und tätlicher Widerstand: Die Bauernschaft geht in die Offensive
- Sabotage und „Diversion“: Aktive Gegenwehr im Verborgenen
- Angebliche,,Schädlingstätigkeit“ und „fortgesetzte Wirtschaftsverbrechen“: Der Widerstand, der keiner war.....
- Die Flucht aus der Heimat: Endgültige Verweigerung durch Entzug.
- „Eher gehe ich aufs Schafott, als daß ich in die Kolchose eintrete!\" Suizid als Symbol der Ablehnung, der Verweigerung und der Resistenz..
- Gebrochener Widerstand und bezwungene Resistenz: Der Eintritt in die LPG.
- Erneutes Aufbegehren im „,vollsozialistischen Staat“: Austritte und Auflösungen von LPGen
- Die Gründe des Widerstands der Landbevölkerung.
- Zusammenfassung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Staatsexamensarbeit befasst sich mit dem Widerstand der Landbevölkerung der DDR gegen die Kollektivierungsmaßnahmen der SED in den Jahren 1952 bis 1961. Das Ziel der Arbeit ist die Analyse, Typologisierung und Darstellung dieses widerständigen Verhaltens. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Frage, wie die Landbevölkerung auf die „Sozialisierung“ ihres Eigentums reagierte und inwieweit dieses Verhalten als Widerstand gedeutet werden kann.
- Die verschiedenen Formen des Widerstands gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR
- Die Ursachen und Gründe für den Widerstand der Landbevölkerung
- Die Rolle der Kirche als Träger von Opposition im totalitären Staat
- Die Auswirkungen der Kollektivierung auf die Lebensbedingungen der Landbevölkerung
- Die Bedeutung des Widerstands für das Verständnis der DDR-Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und definiert den Begriff „Widerstand“ im Zusammenhang mit der Kollektivierung der Landwirtschaft. Sie erläutert die Ziele und die Vorgehensweise der Arbeit.
- Von der Industrialisierung zur Zwangskollektivierung: Ein historischer Überblick: Dieses Kapitel liefert einen historischen Hintergrund zur Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR. Es beschreibt die ideologischen Grundlagen, die sowjetzonalen Gegebenheiten und die Vorgeschichte, den Beginn, den Verlauf und den Abschluß der Kollektivierung.
- Der Widerstand der Landbevölkerung gegen die Kollektivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft: Dieses Kapitel bildet den Schwerpunkt der Arbeit. Es stellt die verschiedenen Formen des Widerstands der Landbevölkerung vor, darunter verbaler Protest, ziviler Ungehorsam, Sabotage, Flucht und Selbstmord. Es untersucht die Gründe und Ursachen für den Widerstand und die Rolle der Kirche als Träger von Opposition.
- Zusammenfassung: Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit zur Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität des Sozialismus auf dem Lande.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kollektivierung, Widerstand, DDR, Landwirtschaft, SED, Kirche, Landbevölkerung, Protest, Sabotage, Flucht, Selbstmord, Sozialismus, Staatssicherheit, Unterdrückung, Menschenrechte, Freiheit, Eigentum.
- Quote paper
- Stefan Finger (Author), 1999, Widerstand gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR 1952-1961, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185450