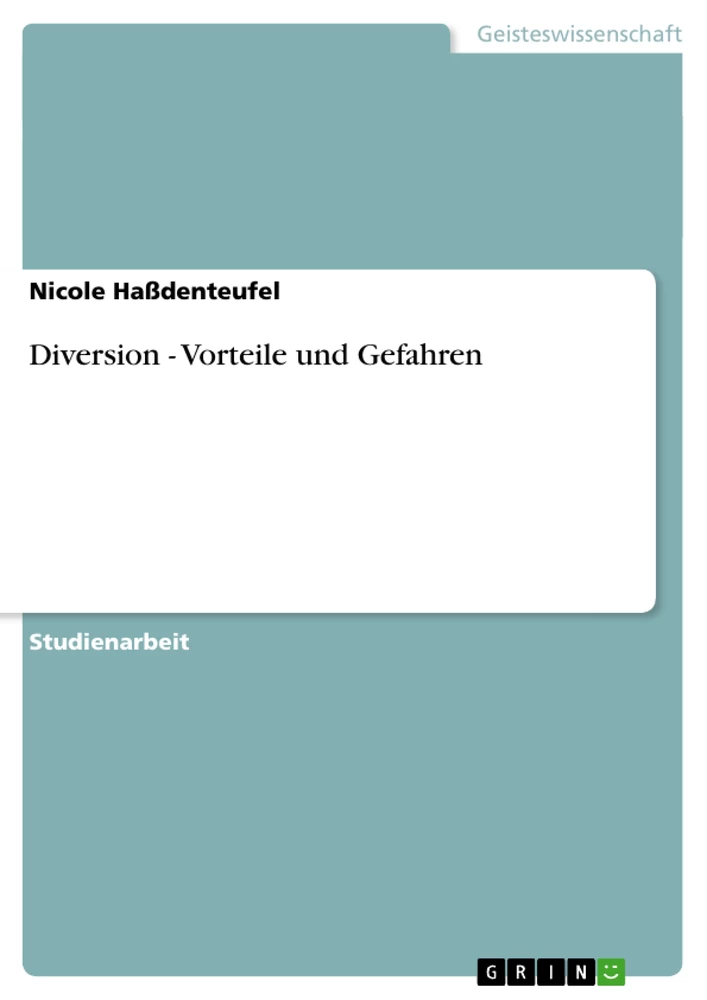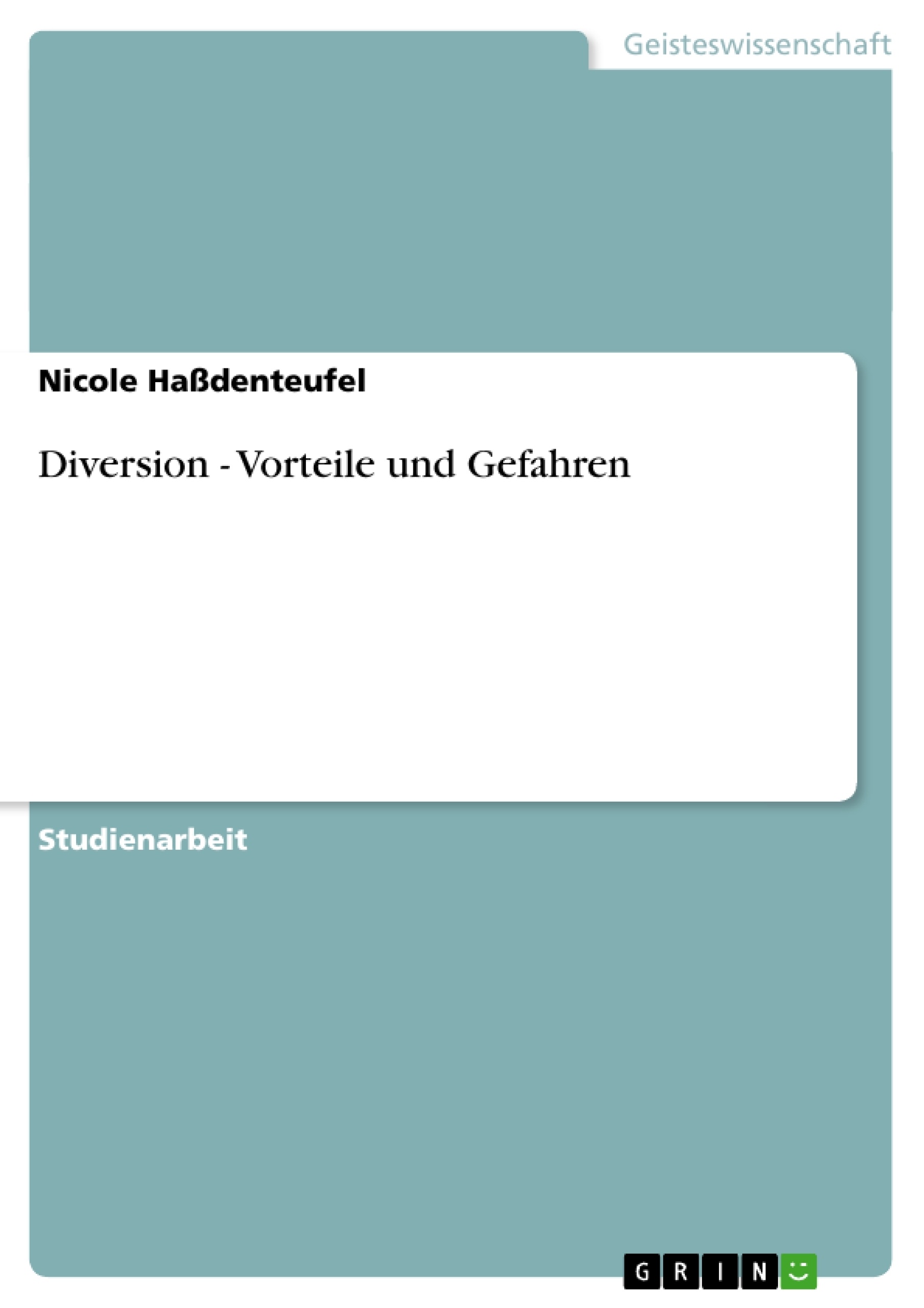Seit ca. 20 Jahren gewinnt die Diversion vor allem im Jugendstrafrecht immer mehr an
Bedeutung. Eine Studie der Konstanzer Inventar Sanktionsforschung besagt, dass in den 90er
Jahren ca. 2/3 der Sanktionsverfahren informell beendet wurden. Den größten Anteil daran
haben Jugendliche und Heranwachsende, für die das JGG Anwendung findet (Schwind, 2002,
S. 68). Ursache dafür sind verschiedene Faktoren. Einerseits sind es kriminologische
Erkenntnisse, die zeigen, dass sich Jugendkriminalität in Ursache, Art und Ausführung von
der Erwachsenenkriminalität unterscheidet und dass Erziehung in den meisten Fällen
effektiver ist als Strafe. Andererseits hat man eingesehen, dass eine formelle Verurteilung
(auch bei Erwachsenen) nicht immer eine angemessene Reaktion auf delinquentes Verhalten
ist. Außerdem gibt es auch verfahrensökonomische Gründe, die (wenn auch zweitrangig) dazu
beitragen, dass ein Verfahren im Rahmen einer Diversion eingestellt wird.
Im Folgenden werde ich den Begriff und die Entwicklung von Diversion allgemein erklären
und unter welchen Bedingungen sie im Jugend- und im Erwachsenenstrafrecht angewendet
werden kann. Dabei werde ich auf die Vorschriften des JGG und deren Anwendung
detaillierter eingehen, da im Zusammenhang mit dem Jugendstrafrecht vom engen
Diversionsbegriff die Rede ist, während der erweiterte sich auf das Erwachsenenstrafrecht
bezieht.
Auch bei den Zielvorstellungen, Vorteilen und Gefahren werde ich mich ausschließlich auf
die Jugendkriminalität beziehen, weil (obwohl sich die Ziele bei Jugendlichen und
Erwachsenen in gewisser Weise ähneln) wesentlich mehr Verfahren nach §§ 45 und 47 JGG
eingestellt werden als nach §§ 153ff StPO und weil Diversion im eigentlichen Sinne nur im
Jugendstrafrecht angewendet wird (enger Diversionsbegriff).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Diversion?
- Begriff
- Entwicklung
- Gesetzliche Grundlage
- Praktische Anwendung
- § 45 JGG Absehen von Verfolgung
- § 47 JGG Einstellung des Verfahrens durch den Richter
- § 37 BtmG Absehen von Verfolgung
- §§ 153, 153a, 153b StPO Einstellung wegen Geringfügigkeit, nach Erfüllung von Auflagen, bei Absehen von Strafe
- Die Diversionsmaßnahmen
- Weitere "Sanktionsmöglichkeiten" im Rahmen eines Diversionsverfahrens
- Auflagen und Weisungen nach § 45 Abs. 3 JGG
- Drogentherapie
- Ziele
- Verminderung von Etikettierung und Stigmatisierung
- Flexible angemessene Reaktion auf Jugendkriminalität
- Entlastung der Staatsanwaltschaft und der Gerichte
- Vorteile
- Gefahren
- Ausweitung der sozialen Kontrolle
- Ist der Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 GG gewährleistet?
- "Freiwilligkeit" durch staatlichen Eingriff
- Wie wichtig ist die Entlastung der Strafverfolgungsbehörde?
- Nach wie vor Etikettierung durch staatliche Intervention
- Erneute Schädigung des Opfers
- Mangelnde Abschreckung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Begriff und die Anwendung von Diversion im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, die praktische Anwendung verschiedener Diversionsmaßnahmen, sowie die damit verbundenen Ziele, Vorteile und Gefahren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Betrachtung der Diversion im Jugendstrafrecht, da hier der enge Diversionsbegriff Anwendung findet.
- Definition und Entwicklung des Diversionsbegriffs
- Rechtliche Grundlagen der Diversion im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht
- Praktische Anwendung und Diversionsmaßnahmen
- Vorteile und Nachteile von Diversion
- Bewertung der Effektivität von Diversion im Jugendstrafrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Diversion ein und erläutert deren steigende Bedeutung im Jugendstrafrecht der letzten 20 Jahre. Sie verweist auf kriminologische Erkenntnisse, die die Unterschiede zwischen Jugend- und Erwachsenenkriminalität aufzeigen und die Effektivität erzieherischer Maßnahmen gegenüber strafrechtlichen Sanktionen betonen. Die Einleitung skizziert den Fokus der Arbeit auf das Jugendstrafrecht aufgrund des dort vorherrschenden engen Diversionsbegriffs und der höheren Anzahl an Verfahren, die nach §§ 45 und 47 JGG eingestellt werden.
Was ist Diversion?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Diversion" etymologisch und konzeptionell als Umleitung oder Abbrechen eines förmlichen Strafverfahrens, oft in Verbindung mit Erziehungsmaßnahmen. Es unterscheidet zwischen dem engen Diversionsbegriff im Jugendstrafrecht, der auf Erziehung statt Strafe fokussiert, und dem erweiterten Begriff im Erwachsenenstrafrecht, bei dem Verfahren unter bestimmten Voraussetzungen eingestellt werden. Die historische Entwicklung des Diversionsbegriffs wird ebenfalls beleuchtet, beginnend mit frühen Ansätzen im 20. Jahrhundert bis hin zu den Reformen des Jugendgerichtsgesetzes.
Gesetzliche Grundlage: Dieses Kapitel (hier nur angedeutet, da der Text nicht den vollen Inhalt liefert) wird die spezifischen gesetzlichen Grundlagen der Diversion detailliert darlegen, wahrscheinlich mit Fokus auf die relevanten Paragraphen des JGG und der StPO.
Praktische Anwendung: Dieses Kapitel (ebenfalls nur angedeutet) wird die praktische Anwendung der Diversion in verschiedenen Kontexten des Jugend- und Erwachsenenstrafrechts untersuchen, einschließlich der beschriebenen Paragraphen (§§ 45 JGG, § 47 JGG, § 37 BtmG, §§ 153ff StPO) und deren spezifischen Voraussetzungen und Abläufe.
Die Diversionsmaßnahmen: Dieses Kapitel (hier nur angedeutet) wird verschiedene Diversionsmaßnahmen detailliert beschreiben, welche im Rahmen eines Diversionsverfahrens eingesetzt werden können, und deren spezifische Anwendung im Jugendstrafrecht erläutern.
Weitere "Sanktionsmöglichkeiten" im Rahmen eines Diversionsverfahrens: Dieses Kapitel (ebenfalls nur angedeutet) wird zusätzliche Sanktionsmöglichkeiten im Kontext der Diversion beleuchten, wie Auflagen und Weisungen nach § 45 Abs. 3 JGG und die Möglichkeit der Drogentherapie.
Ziele: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele der Diversion, unter anderem die Verminderung von Etikettierung und Stigmatisierung, die Bereitstellung einer flexiblen und angemessenen Reaktion auf Jugendkriminalität, sowie die Entlastung der Staatsanwaltschaft und der Gerichte.
Schlüsselwörter
Diversion, Jugendstrafrecht, Erwachsenenstrafrecht, § 45 JGG, § 47 JGG, § 37 BtmG, §§ 153ff StPO, Erziehung, Strafe, Etikettierung, Stigmatisierung, soziale Kontrolle, Gleichbehandlungsgrundsatz, Verfahrensökonomie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diversion im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über Diversion im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselbegriffe und beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, die praktische Anwendung, Ziele, Vorteile und Gefahren der Diversion. Besonderer Fokus liegt auf dem Jugendstrafrecht aufgrund des dort geltenden engen Diversionsbegriffs.
Was ist Diversion?
Diversion wird etymologisch und konzeptionell als Umleitung oder Abbruch eines förmlichen Strafverfahrens definiert, oft verbunden mit Erziehungsmaßnahmen. Der Text unterscheidet zwischen einem engen Diversionsbegriff im Jugendstrafrecht (Fokus auf Erziehung) und einem erweiterten Begriff im Erwachsenenstrafrecht (Verfahrensbeendigung unter bestimmten Voraussetzungen). Die historische Entwicklung des Begriffs wird ebenfalls behandelt.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden behandelt?
Der Text nennt die relevanten Paragraphen des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) (§§ 45, 47 JGG) und der Strafprozessordnung (StPO) (§§ 153ff StPO), sowie des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG, §37 BtmG). Eine detaillierte Darstellung der gesetzlichen Grundlagen ist angedeutet, aber nicht im vorliegenden Text vollständig enthalten.
Wie wird Diversion in der Praxis angewendet?
Der Text beschreibt die praktische Anwendung von Diversion in verschiedenen Kontexten des Jugend- und Erwachsenenstrafrechts, einschließlich der genannten Paragraphen und deren Voraussetzungen und Abläufe. Eine detaillierte Erläuterung der praktischen Anwendung ist jedoch im Auszug nicht vollständig gegeben.
Welche Diversionsmaßnahmen werden beschrieben?
Der Text erwähnt verschiedene Diversionsmaßnahmen, die im Rahmen eines Diversionsverfahrens eingesetzt werden können, und deren Anwendung im Jugendstrafrecht. Konkrete Beispiele werden nur angedeutet, eine umfassende Auflistung fehlt im vorliegenden Auszug.
Welche zusätzlichen Sanktionsmöglichkeiten gibt es?
Zusätzliche Sanktionsmöglichkeiten im Kontext der Diversion, wie Auflagen und Weisungen nach § 45 Abs. 3 JGG und die Möglichkeit der Drogentherapie, werden erwähnt, jedoch nicht detailliert erklärt.
Was sind die Ziele der Diversion?
Die Ziele der Diversion umfassen die Verminderung von Etikettierung und Stigmatisierung, flexible und angemessene Reaktionen auf Jugendkriminalität und die Entlastung der Staatsanwaltschaft und Gerichte.
Welche Vorteile und Gefahren birgt Diversion?
Der Text nennt Vorteile der Diversion, spricht aber auch Gefahren an, wie die mögliche Ausweitung der sozialen Kontrolle, die Frage nach der Gewährleistung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, die Problematik der "Freiwilligkeit" durch staatlichen Eingriff, die Bedeutung der Entlastung der Strafverfolgungsbehörden, die anhaltende Etikettierung durch staatliche Intervention, mögliche erneute Schädigung des Opfers und mangelnde Abschreckung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Diversion, Jugendstrafrecht, Erwachsenenstrafrecht, § 45 JGG, § 47 JGG, § 37 BtmG, §§ 153ff StPO, Erziehung, Strafe, Etikettierung, Stigmatisierung, soziale Kontrolle, Gleichbehandlungsgrundsatz, Verfahrensökonomie.
- Quote paper
- Nicole Haßdenteufel (Author), 2003, Diversion - Vorteile und Gefahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18538