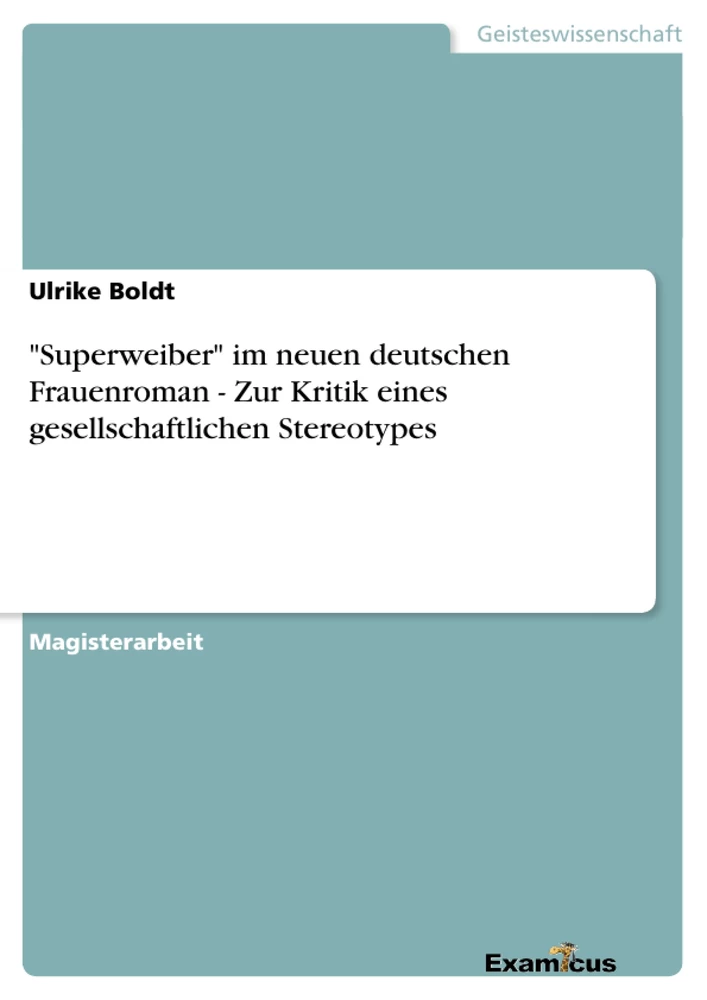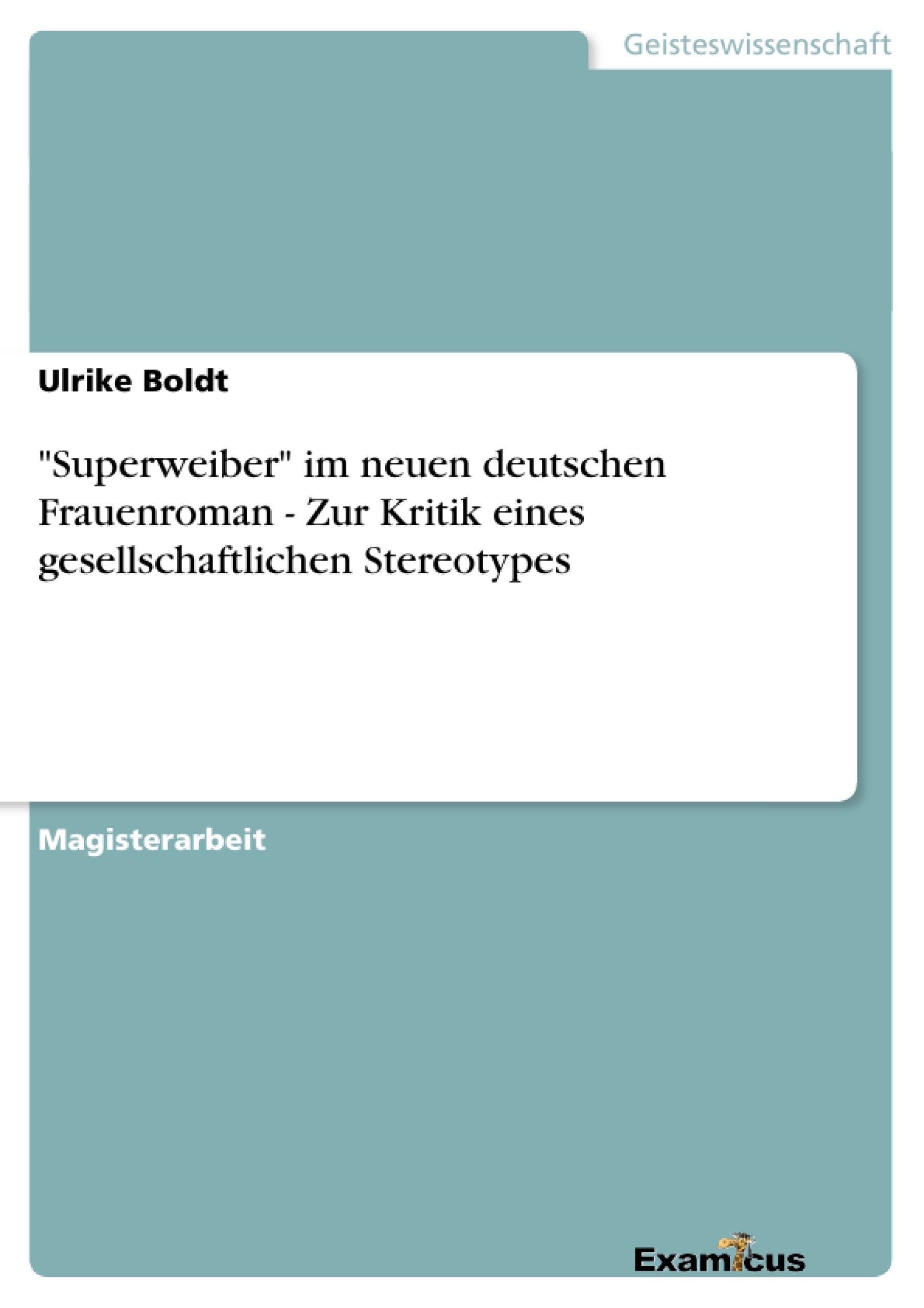„Warum lesen Sie Hera Lind, wenn Sie Literaturkritikerin sind? Lesen Sie etwas, das sich zu lesen lohnt! Ich will Ihnen etwas verraten: Ich selber lese nie solche Bücher, wie ich sie schreibe, weil das für mich totgeschlagene Zeit ist.“
Diese Meinung vertrat Hera Lind Anfang 1998 in einem Interview mit dem Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt. Die Journalistin Angelika Ohland schickte voraus, daß Literaturkritiker Probleme mit der Literatur von Hera Lind hätten und Hera Lind konterte, daß sie schließlich keine Literatur für Literaturkritiker schreibt. Die Kritiker sollten endlich aufhören in ihren Romanen mehr zu sehen, als sie sind - nämlich Unterhaltungsromane für Frauen.
Was ist das Besondere an diesen Büchern? Wie kommen die Auflagenzahlen von 600.000 bis zu 2 Millionen Exemplare pro Buch zustande? Was bringt die Frauen dazu, diese Bücher zu kaufen, trotz schlechter Rezensionen? Was ist das Faszinierende an den Romanheldinnen? Was bringt die Leserinnen dazu sich mit ihnen zu identifizieren? Ich möchte die Rolle der „Superweiber“ in der
Gesellschaft hinterfragen. Sind die „Superweiber“ gesellschaftlich gesehen wirklich realistisch oder wird in den Büchern ein Mythos aufgebaut? Was genau sind die Eigenschaften eines „Superweibes“? Mit welchen Klischees werden die „Superweiber“ beschrieben?
Kann diese Literatur tatsächlich als neue Frauenemazipationsliteratur bezeichnet werden, kann sie in der Gesellschaft etwas verändern oder ist sie nicht vielmehr Trivialliteratur?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abriß der Entwicklung der deutschen Frauenliteratur
- Kurzer Einblick in die Geschichte der deutschen Frauenliteratur
- Der Umbruch der deutschen Frauenliteratur
- Die neue deutsche Frauenliteratur
- Eva Heller
- Gaby Hauptmann
- Hera Lind
- Der Roman „Das Superweib“
- „Superweib“ Hera Lind in den Medien
- Das „Superweib“ in Roman und Realität
- Eigenschaften der „Superweiber“ im Roman
- „Superweiber“ in der Realität
- Interviews mit realen „Superweibern“
- Vera
- Tina
- Petra
- Claire
- Bilanz
- Die neuen Zwänge der Frauen - Das „Superweiber-Syndrom“
- Erstrebenswerte gesellschaftliche Veränderungen
- Gründe für den Erfolg der Bücher
- Kritik am neuen deutschen Frauenroman
- Der neue deutsche Frauenroman: eine Form der Trivialliteratur
- Frauenromane ohne „Superweiber“ - Claudia Keller
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den neuen deutschen Frauenroman und das darin auftretende Stereotyp des „Superweibs“. Ziel ist es, die Entwicklung der deutschen Frauenliteratur zu beleuchten, die Charakteristika der „Superweiber“ zu analysieren und die gesellschaftlichen Implikationen dieses Bildes zu diskutieren. Die Arbeit kritisiert auch die Einordnung dieser Romane als reine Unterhaltungsliteratur.
- Entwicklung der deutschen Frauenliteratur
- Charakterisierung des „Superweib“-Stereotyps in Literatur und Realität
- Analyse der Romane von Hera Lind, Gaby Hauptmann und Eva Heller
- Gesellschaftliche Kritik und Einordnung des Phänomens „Superweib“
- Bewertung der literarischen Qualität der neuen Frauenromane
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert Hera Linds Aussage über ihre eigene Literatur und die Kritik daran. Sie führt das Konzept des "Superweibs" ein, das in der modernen Frauenliteratur eine zentrale Rolle spielt, und beschreibt die Popularität dieser Romane, die Millionen von Leserinnen erreichen. Die Arbeit stellt die Frage nach der Bedeutung dieser Romane jenseits der Unterhaltung und der kritischen Auseinandersetzung mit dem "Superweib"-Stereotyp in den Mittelpunkt.
Abriß der Entwicklung der deutschen Frauenliteratur: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte der deutschen Frauenliteratur, von den frühen Anfängen bis hin zum Umbruch und der Entstehung der „neuen deutschen Frauenliteratur“. Es beleuchtet die Veränderungen in der Darstellung von Frauen in der Literatur und den Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen auf diese Darstellung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Frauenrollen und -bildern im Wandel der Zeit.
Die neue deutsche Frauenliteratur: Dieser Abschnitt porträtiert Autorinnen wie Eva Heller, Gaby Hauptmann und Hera Lind. Er analysiert die Inhalte ihrer Romane, relevante Rezensionen und die stilistischen Mittel, die sie einsetzen. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Frauenfiguren und ihrer Rolle in der Gesellschaft, die durch die Romane vermittelt wird. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Schreibstil und in den Themen der Autorinnen hervorgehoben.
Das „Superweib“ in Roman und Realität: Dieses Kapitel untersucht das "Superweib"-Stereotyp sowohl in der Literatur als auch in der Realität. Es beschreibt die Eigenschaften, die diesen Typus ausmachen, und vergleicht die fiktiven Darstellungen mit Interviews von Frauen, die als "Superweiber" bezeichnet werden könnten. Die Analyse befasst sich mit der Frage, inwieweit das literarische Bild ein realistisches Abbild der Realität darstellt oder eher ein Wunschbild verkörpert.
Die neuen Zwänge der Frauen - Das „Superweiber-Syndrom“: Hier wird das Konzept des „Superweiber-Syndroms“ eingeführt und analysiert. Es geht um die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und den Druck, Karriere, Familie und Partnerschaft erfolgreich zu vereinen. Dieser Abschnitt untersucht die Konsequenzen dieses Drucks für Frauen und die Frage, ob das „Superweib“-Bild einen positiven oder negativen Einfluss auf Frauen hat.
Erstrebenswerte gesellschaftliche Veränderungen: Dieses Kapitel erörtert die gesellschaftlichen Veränderungen, die wünschenswert wären, um den Druck auf Frauen zu verringern und eine ausgewogenere Lebensgestaltung zu ermöglichen. Es wird diskutiert, welche Schritte unternommen werden könnten, um die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen zu modifizieren und eine gleichberechtigtere Gesellschaft zu schaffen.
Gründe für den Erfolg der Bücher: Dieser Abschnitt untersucht die Gründe für die große Popularität der Romane der „neuen deutschen Frauenliteratur“. Es wird analysiert, welche Faktoren zum Erfolg dieser Bücher beitragen, beispielsweise die Identifikation der Leserinnen mit den starken Frauenfiguren oder die einfach zugängliche und unterhaltsame Schreibweise.
Kritik am neuen deutschen Frauenroman: Dieses Kapitel kritisiert die „neue deutsche Frauenliteratur“ und ihre Einordnung als Trivialliteratur. Es wird diskutiert, ob die Romane trotz ihres Unterhaltungswertes einen gesellschaftlichen Wert besitzen und ob sie zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Themen Frauenrolle und gesellschaftlichen Erwartungen beitragen.
Frauenromane ohne „Superweiber“ - Claudia Keller: Dieser Abschnitt stellt Autorinnen vor, die von dem „Superweib“-Stereotyp abweichen und andere Frauenbilder in ihren Romanen präsentieren. Es dient als Gegenbeispiel zur vorangegangenen Analyse und ermöglicht eine differenziertere Betrachtung der modernen deutschen Frauenliteratur.
Schlüsselwörter
Neue deutsche Frauenliteratur, Superweib, Stereotyp, Frauenrolle, Gesellschaftliche Erwartungen, Karriere, Familie, Unterhaltungsliteratur, Literaturkritik, Eva Heller, Gaby Hauptmann, Hera Lind, Identifikation, Trivialliteratur, Emanzipation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur neuen deutschen Frauenliteratur und dem "Superweib"-Stereotyp
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die neue deutsche Frauenliteratur und den darin prominent auftretenden Stereotyp des „Superweibs“. Sie untersucht die Entwicklung der deutschen Frauenliteratur, charakterisiert das „Superweib“, diskutiert dessen gesellschaftliche Implikationen und kritisiert die Einordnung dieser Romane als reine Unterhaltungsliteratur.
Welche Autorinnen werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit fokussiert sich auf die Autorinnen Hera Lind, Gaby Hauptmann und Eva Heller. Ihre Romane und die darin dargestellten Frauenfiguren werden im Detail analysiert und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht.
Was ist das "Superweib"-Stereotyp?
Das „Superweib“ ist ein Stereotyp, das Frauen beschreibt, die scheinbar mühelos Karriere, Familie und Partnerschaft unter einen Hut bringen. Die Arbeit untersucht, wie dieses Stereotyp in den Romanen dargestellt wird und vergleicht es mit realen Frauen, die dieses Bild verkörpern könnten.
Wie wird das "Superweib" in Romanen und der Realität verglichen?
Die Arbeit vergleicht die literarischen Darstellungen des „Superweibs“ mit Interviews von Frauen, die als „Superweiber“ bezeichnet werden könnten. Es wird untersucht, ob das literarische Bild ein realistisches Abbild der Realität oder eher ein Wunschbild darstellt.
Welche gesellschaftlichen Implikationen werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und den Druck, Karriere, Familie und Partnerschaft erfolgreich zu vereinen. Sie untersucht das „Superweib“-Syndrom und dessen Konsequenzen für Frauen und bewertet den Einfluss des „Superweib“-Bildes auf Frauen.
Welche gesellschaftlichen Veränderungen werden als erstrebenswert angesehen?
Die Arbeit erörtert wünschenswerte gesellschaftliche Veränderungen, um den Druck auf Frauen zu verringern und eine ausgewogenere Lebensgestaltung zu ermöglichen. Es werden Schritte diskutiert, um gesellschaftliche Erwartungen an Frauen zu modifizieren und eine gleichberechtigtere Gesellschaft zu schaffen.
Warum sind die Romane so erfolgreich?
Die Arbeit analysiert die Gründe für die Popularität der Romane, wie die Identifikation der Leserinnen mit den starken Frauenfiguren oder die einfach zugängliche und unterhaltsame Schreibweise.
Wie wird die literarische Qualität der Romane bewertet?
Die Arbeit beinhaltet Kritik an der „neuen deutschen Frauenliteratur“ und ihrer Einordnung als Trivialliteratur. Es wird diskutiert, ob diese Romane trotz ihres Unterhaltungswertes einen gesellschaftlichen Wert besitzen und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Frauenrollen und gesellschaftlichen Erwartungen beitragen.
Wer wird als Gegenbeispiel zum "Superweib" genannt?
Claudia Keller wird als Gegenbeispiel genannt. Ihre Romane präsentieren Frauenbilder, die vom „Superweib“-Stereotyp abweichen und eine differenziertere Betrachtung der modernen deutschen Frauenliteratur ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Neue deutsche Frauenliteratur, Superweib, Stereotyp, Frauenrolle, Gesellschaftliche Erwartungen, Karriere, Familie, Unterhaltungsliteratur, Literaturkritik, Eva Heller, Gaby Hauptmann, Hera Lind, Identifikation, Trivialliteratur, Emanzipation.
- Quote paper
- Ulrike Boldt (Author), 1998, "Superweiber" im neuen deutschen Frauenroman - Zur Kritik eines gesellschaftlichen Stereotypes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185313