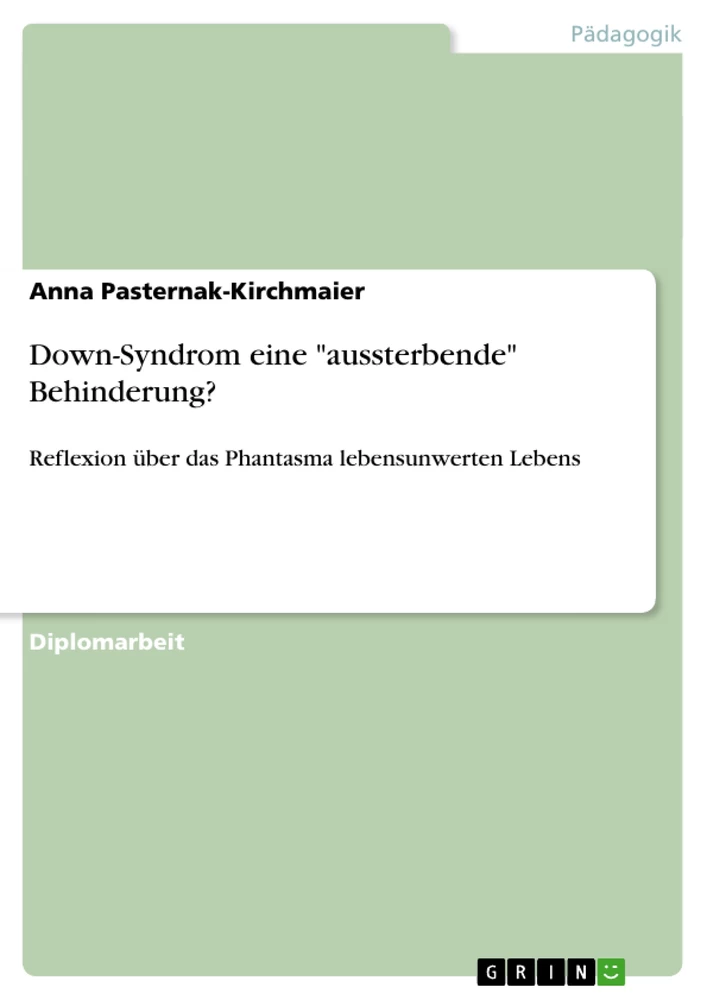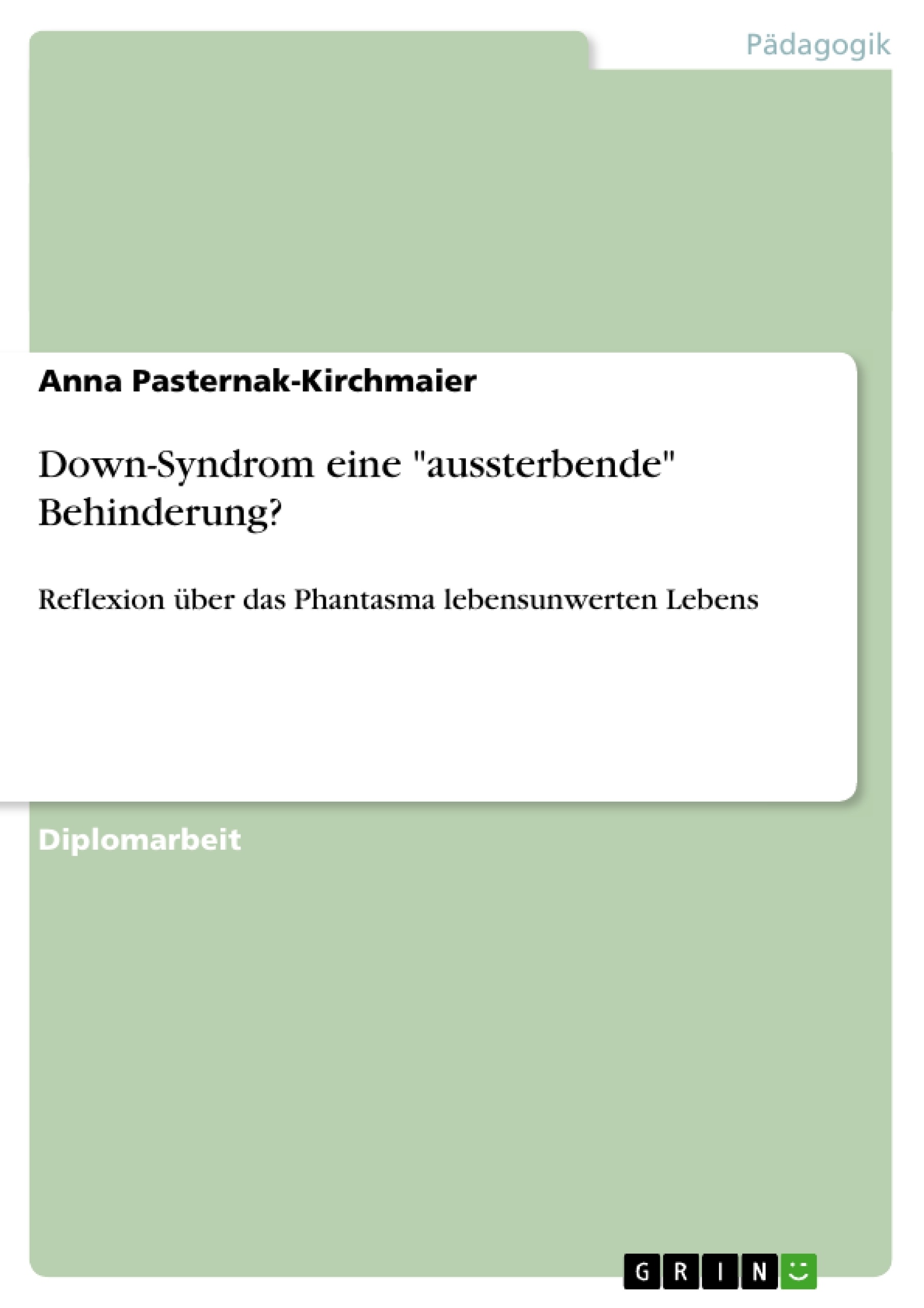"Die Geburt ist ein aufregendes Ereignis im Leben des Kindes. Es verlässt die behagliche Wärme des Mutterleibes. Die Welt, in die es kommt, ist voll von grellem Licht, lauter und kälter. Nun muss es selbst atmen und essen. Aber der kleine Mensch ist gut vorbereitet: Schon Monate vorher hat er gelernt, zu schlucken, zu saugen und zu greifen. Alles hat sich zur gegebenen Zeit entwickelt" (Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, S. 15).
Auch für die Mutter ist dieses Ereignis entscheidend. Es wird ihr Leben verändern. Zum ersten Mal hält sie ihr eigenes Kind im Arm. Sie kann es sehen, berühren und begreifen, d.h. sie kann einen direkten Kontakt zu ihm aufnehmen. Während der zurückliegenden Schwangerschaft war dies nur bedingt möglich. Erst in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft konnte sie das Kind durch seine Bewegungen und Tritte wahrnehmen. Zuvor spürte sie nur die Veränderung ihres eigenen Körpers.
Daher sind gerade in dieser Zeit der Schwangerschaft für die werdende Mutter die Besuche bei ihrem Gynäkologen besonders wichtig. Bei diesen Besuchen erhält sie nicht nur Informationen über die ersten Entwicklungsschritte ihres Kindes, sondern es werden ihr auch verschiedene pränatal diagnostische Untersuchungsmethoden von ihrem Arzt empfohlen, welche "dem Wohle" ihres Kindes dienen sollen. Außer den mittlerweile üblichen Vorsorgeuntersuchungen, wie z.B. Ultraschall, werden den Frauen individuell verschiedene, spezielle zusätzliche pränatale Untersuchungen angeboten, welche zahlreiche Informationen über die vorgeburtliche Entwicklung ihres Kindes vermitteln sollen. Jedoch beeinflussen nicht selten die möglichen Ergebnisse der pränatalen Untersuchungen die Beziehung der zukünftigen Mutter zu ihrem ungeborenen Kind. Diese können ihr sowohl Sicherheit über den Gesundheitszustand geben als auch die Freude über ihr Kind in Frage stellen oder sogar zerstören. Nicht selten wird anschließend die Berechtigung der Existenz des ungeborenen Kindes hinterfragt.
Vor gut vier Jahren habe ich während meiner eigenen Schwangerschaft eine solche Situation selbst erlebt. Ohne einen für mich ersichtlichen Grund, hat mir meine Gynäkologin damals eine über die übliche Ultraschalluntersuchung hinausgehende Untersuchung angeboten, den sogenannten Triple-Test. Diese Untersuchung wurde mir nur mit der kurzen Information empfohlen, dass mit dieser die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des "Mongolismus" festgestellt werden kann. .[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zum Begriff
- 2.1 Behinderung
- 2.2 Geistige Behinderung
- 3 Down-Syndrom
- 3.1 Begriffsdefinition und kurzer geschichtlicher Überblick
- 3.2 Ursachen des Down-Syndroms
- 3.2.1 Freie Trisomie 21
- 3.2.2 Mosaik-Trisomie
- 3.2.3 Translokations-Trisomie
- 3.2.4 Ätiologische Faktoren
- 3.3 Symptomenspektrum des Down-Syndroms
- 3.3.1 Morphologische Aspekte
- 3.3.2 Funktionelle Aspekte
- 3.3.3 Lebenserwartung
- 4 Gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Down-Syndrom
- 4.1 Behinderte Menschen in der vorindustriellen und industriellen Gesellschaft
- 4.2 Menschen mit Down-Syndrom und ihre heutige gesellschaftliche Akzeptanz
- 5 Pränatale Diagnostik und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen
- 5.1 Medizinischer Aspekt
- 5.2 Der Paragraph 218a StGB
- 5.3 Gewissenskonflikt der Eltern bzw. Mütter
- 5.4 Geburtenentwicklung
- 6 Drei Stellungnahmen von Vertretern zweier Berufsgruppen
- 6.1 Vorstellung der Interviews
- 6.2 Auswahl der Interviewpartner
- 6.3 Ziele der Interviews
- 6.4 Interviewsituation
- 6.5 Ergebnisse der Interviews
- 6.6 Fazit der Interviews
- 7 Ethischer Aspekt der pränatalen Diagnostik
- 7.1 Ethischer Ansatz von Singer
- 7.1.1 Die präferenz-utilitaristische Position Singers
- 7.1.2 Personenstatus nach Singer
- 7.1.3 Nichtfreiwillige Euthanasie
- 7.2 Lebensrecht behinderter Menschen - kritische Stellungnahme von Sonderpädagogen bzgl. des Ansatzes von Singer
- 7.3 Praxis der humangenetischen Beratung
- 7.1 Ethischer Ansatz von Singer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die gesellschaftliche Wahrnehmung und den Umgang mit dem Down-Syndrom. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Sichtweise auf Menschen mit Down-Syndrom, die medizinischen Aspekte der Erkrankung und die ethischen Fragen im Zusammenhang mit pränataler Diagnostik.
- Historische und gesellschaftliche Entwicklung der Betrachtung von Down-Syndrom
- Medizinische Aspekte des Down-Syndroms: Ursachen, Symptome und Lebenserwartung
- Pränatale Diagnostik und ihre ethischen Implikationen
- Gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit Down-Syndrom
- Ethische Positionen zum Thema Lebensrecht behinderter Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und schildert die persönliche Erfahrung der Autorin mit pränataler Diagnostik während ihrer Schwangerschaft. Sie hebt die Bedeutung pränataler Untersuchungen und deren potenziellen Einfluss auf die Beziehung zwischen Mutter und ungeborenem Kind hervor, wobei die ethischen Fragen im Zentrum stehen. Der Text spannt einen Bogen von der Freude der Geburt bis hin zu den existenziellen Fragen, die durch pränatale Diagnosen entstehen können.
2 Zum Begriff: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Behinderung“ und „geistige Behinderung“ im Kontext der vorliegenden Arbeit. Es legt die Grundlage für das Verständnis der weiteren Kapitel, indem es die verschiedenen Aspekte von Behinderung beleuchtet und den Begriff Down-Syndrom im Kontext von geistiger Behinderung einordnet. Die Definitionen bieten ein solides Fundament für die spätere Diskussion der gesellschaftlichen und ethischen Implikationen.
3 Down-Syndrom: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Down-Syndroms. Es beginnt mit einer Begriffsdefinition und einem geschichtlichen Überblick, bevor es detailliert auf die Ursachen (freie Trisomie 21, Mosaik-Trisomie, Translokations-Trisomie und ätiologische Faktoren) eingeht. Der Schwerpunkt liegt auf dem Symptomenspektrum, unterteilt in morphologische und funktionelle Aspekte sowie die Lebenserwartung von Menschen mit Down-Syndrom. Das Kapitel dient als umfassende medizinische Grundlage für die weiteren Kapitel, die sich mit gesellschaftlichen und ethischen Aspekten befassen.
4 Gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Down-Syndrom: Dieses Kapitel analysiert die historische und aktuelle gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Down-Syndrom. Es vergleicht die Situation in der vorindustriellen und industriellen Gesellschaft mit der heutigen Akzeptanz. Der Fokus liegt auf der Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung und des Umgangs mit Menschen mit Down-Syndrom im Laufe der Zeit, was die Grundlage für die Diskussion der ethischen Fragen in den nachfolgenden Kapiteln bildet.
5 Pränatale Diagnostik und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen: Dieses Kapitel untersucht die pränatale Diagnostik aus medizinischer, rechtlicher und ethischer Perspektive. Es beleuchtet den Paragraph 218a StGB und den Gewissenskonflikt der Eltern, die mit den Ergebnissen pränataler Untersuchungen konfrontiert werden. Die Geburtenentwicklung im Zusammenhang mit pränataler Diagnostik wird ebenfalls analysiert, um die gesellschaftlichen Auswirkungen zu verdeutlichen. Das Kapitel verbindet die medizinischen Fakten mit den ethischen und rechtlichen Aspekten der Thematik.
6 Drei Stellungnahmen von Vertretern zweier Berufsgruppen: Dieses Kapitel präsentiert Interviews mit Vertretern zweier Berufsgruppen, die mit Menschen mit Down-Syndrom arbeiten. Die Auswahl der Interviewpartner, die Ziele der Interviews und die Interviewsituation werden detailliert beschrieben. Die Ergebnisse und das Fazit der Interviews geben Einblicke in die Praxis und die verschiedenen Perspektiven auf den Umgang mit Down-Syndrom. Es bietet eine wertvolle Ergänzung zur theoretischen Auseinandersetzung der vorhergehenden Kapitel.
Schlüsselwörter
Down-Syndrom, Behinderung, Geistige Behinderung, Pränatale Diagnostik, Gesellschaftliche Akzeptanz, Ethische Aspekte, Lebensrecht, Lebensqualität, Humangenetische Beratung, Utilitarismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Down-Syndrom, Pränatale Diagnostik und Ethische Aspekte
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die gesellschaftliche Wahrnehmung und den Umgang mit dem Down-Syndrom. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Sichtweise auf Menschen mit Down-Syndrom, die medizinischen Aspekte der Erkrankung und die ethischen Fragen im Zusammenhang mit pränataler Diagnostik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die historische und gesellschaftliche Entwicklung der Betrachtung von Down-Syndrom, medizinische Aspekte (Ursachen, Symptome, Lebenserwartung), pränatale Diagnostik und deren ethische Implikationen, gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit Down-Syndrom und ethische Positionen zum Thema Lebensrecht behinderter Menschen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung (Behinderung, geistige Behinderung), umfassende Darstellung des Down-Syndroms (Ursachen, Symptome), gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Down-Syndrom (historisch und aktuell), pränatale Diagnostik und deren gesellschaftliche Auswirkungen (medizinischer, rechtlicher und ethischer Aspekt), Interviews mit Vertretern zweier Berufsgruppen und ein Kapitel zu ethischen Aspekten der pränatalen Diagnostik, insbesondere unter Berücksichtigung des Ansatzes von Singer.
Welche medizinischen Aspekte des Down-Syndroms werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Ursachen des Down-Syndroms (freie Trisomie 21, Mosaik-Trisomie, Translokations-Trisomie, ätiologische Faktoren) und das Symptomenspektrum (morphologische und funktionelle Aspekte). Die Lebenserwartung von Menschen mit Down-Syndrom wird ebenfalls behandelt.
Wie wird die pränatale Diagnostik behandelt?
Die pränatale Diagnostik wird aus medizinischer, rechtlicher und ethischer Perspektive beleuchtet. Der Paragraph 218a StGB, der Gewissenskonflikt der Eltern und die Geburtenentwicklung im Zusammenhang mit pränataler Diagnostik werden analysiert.
Welche ethischen Aspekte werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert ethische Aspekte der pränatalen Diagnostik, insbesondere den ethischen Ansatz von Singer (präferenz-utilitaristische Position, Personenstatus, nichtfreiwillige Euthanasie). Sie enthält auch eine kritische Stellungnahme von Sonderpädagogen zu Singers Ansatz und betrachtet die Praxis der humangenetischen Beratung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf wissenschaftliche Literatur und Interviews mit Vertretern zweier Berufsgruppen, die mit Menschen mit Down-Syndrom arbeiten. Die konkreten Quellen werden im Literaturverzeichnis der vollständigen Arbeit aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Down-Syndrom, Behinderung, Geistige Behinderung, Pränatale Diagnostik, Gesellschaftliche Akzeptanz, Ethische Aspekte, Lebensrecht, Lebensqualität, Humangenetische Beratung, Utilitarismus.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant beschreibt.
Welche Interviews wurden durchgeführt?
Die Arbeit beinhaltet Interviews mit Vertretern zweier Berufsgruppen, die im Umgang mit Menschen mit Down-Syndrom tätig sind. Die Auswahl der Interviewpartner, die Ziele der Interviews und die Ergebnisse werden detailliert dargestellt.
- Quote paper
- Anna Pasternak-Kirchmaier (Author), 2002, Down-Syndrom eine "aussterbende" Behinderung? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18476