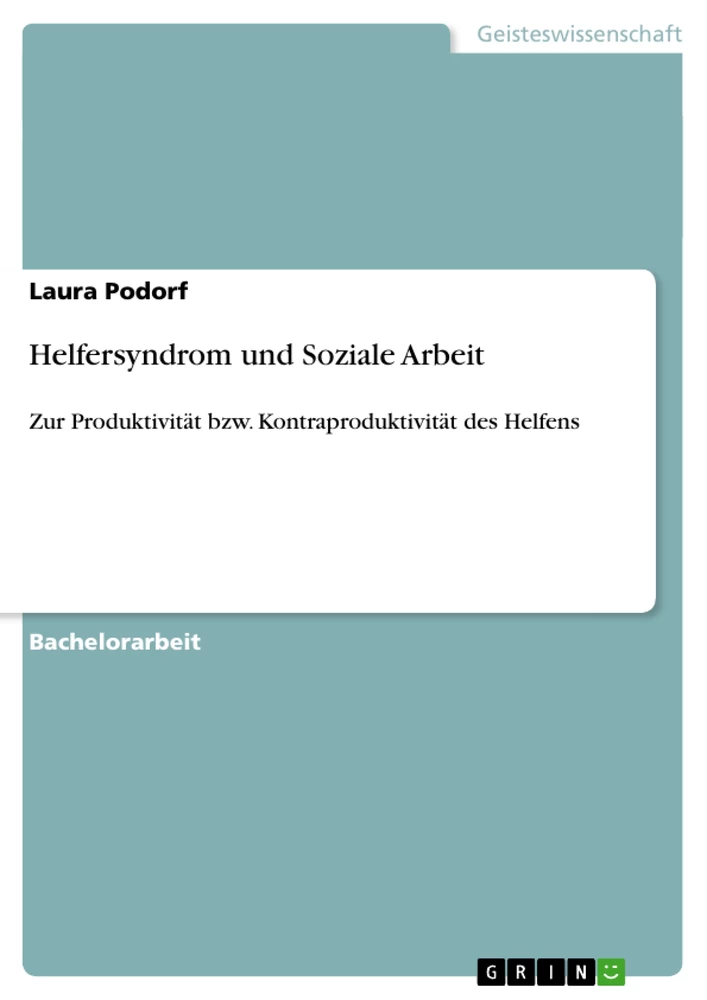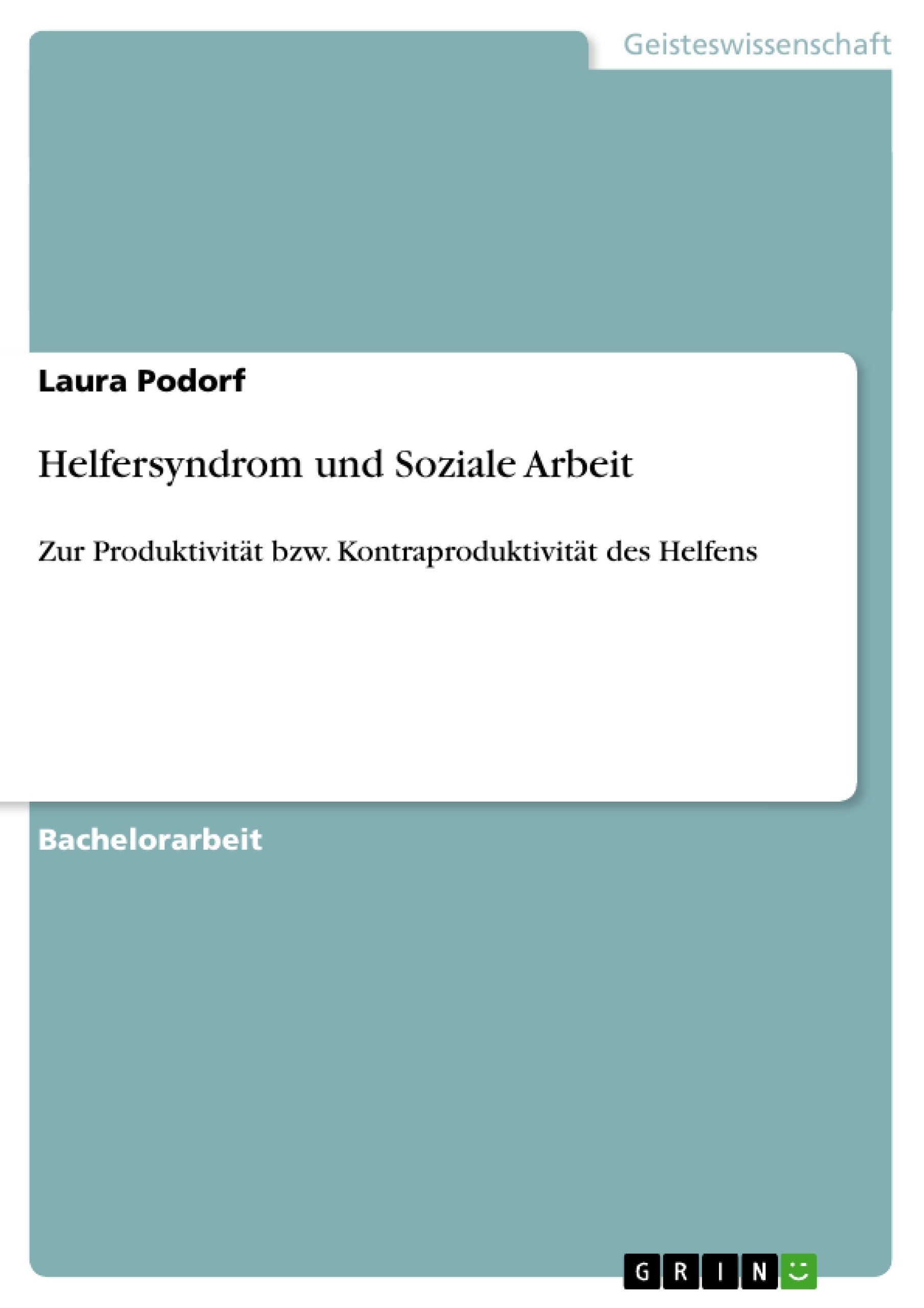"Für viele Sozialarbeiter und Sozialpädagogen steht die Motivation eines "helfenden Umgangs mit anderen Menschen" im Vordergrund und im Zentrum ihrer Berufswahl und darin auch die Erwartung einer weniger "entfremdeten", sinnvollen, an realen Bedürfnissen orientierten Berufstätigkeit." Regine Gildemeister (Als Helfer überleben, 1983)
Dieses Zitat von Regine Gildemeister beschreibt eindrucksvoll die Problematik, um die es in dieser Arbeit gehen soll. Die Berufstätigkeit einer Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin bzw. eines Sozialarbeiters/ Sozialpädagogen ist gekennzeichnet durch eine gemeinsame Grundmotivation: das "Helfen-Wollen". Ebenso wie Gildemeister in ihrer Aussage beschreibt, handelt es sich um eine an "sinnvollen, an realen Bedürfnissen orientierte Berufstätigkeit". Ich möchte an dieser Stelle einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass sich die berufsmäßige Orientierung an den Bedürfnissen jedoch nicht ausschließlich auf die Bedürfnisse des Klientels beziehen muss. Im Verlauf meines Studiums habe ich mir oft die frage gestellt, was Menschen dazu motiviert anderen zu helfen und immer wider versucht, meine eigene Motivation zu überprüfen. Zum anderen ist mir aufgefallen, dass viele Helfer die Soziale Arbeit gebrauchen, um sich selbst helfen zu wollen. Außerdem kommt die Frage nach der Tatsache, wann die Grenzen des Helfens erreicht sind,k selten zur Sprache. Denn diese Frage ist häufig verbunden damit, die eigene Kompetenz in Frage zu stellen, so erscheint es mir. Es gibt einige SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen, die sich voll und ganz in ihrem Job investieren und nach einiger Zeit der Berufstätigkeit an Erschöpfungszuständen, z.B. dem Burnout-Syndrom leiden. Oft fällt es den Helferinnen und Helfern schwer, sich emotional abzugrenzen und ihre Arbeit von Privatem zu trennen. Sie sind ausgebrannt, bevor sie sich die Problematik bewusst gemacht haben.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung des Hilfsbegriffs
- 2.1 Helfen - Eine Definition
- 2.2 Die Bedeutung der Ethik/ Philosophie für helfende Berufe
- 2.3 Die gesellschaftliche Entwicklung der Hilfe
- 2.4 Soziale Arbeit - Resultat der Hilfsentwicklung
- 3. Motivationen des Helfens in der Sozialen Arbeit
- 3.1 Ein Überblick über die theoretischen Erklärungsansätze
- 3.1.1 Die humanistisch psychologisch begründete Motivation
- 3.1.2 Die christlich religiös begründete Motivation
- 3.1.3 Die evolutionsbiologisch/ sozialpsychologisch begründete Motivation
- 3.2 Persönliche Motivationen des Helfens
- 3.3 Empirische Studie: Motive zur Sozialen Arbeit
- 3.4 Die biographische Rekonstruktion von Studienverläufen nach Schweppe
- 3.5 Soziale Arbeit als Selbsthilfe
- 3.6 Resümee I
- 3.1 Ein Überblick über die theoretischen Erklärungsansätze
- 4. Das Helfersyndrom mit Folge Burnout
- 4.1 Definition und Ursachen der Entstehung des Helfersyndroms
- 4.2 Der „hilflose Helfer“ und die „Ware Nächstenliebe“
- 4.3 Endstation: Burnout
- 5. Exkurs: Interview zur Berufsmotivation in Bezug auf das Helfersyndrom
- 5.1 Beschreibung und Durchführung
- 5.2 Zusammenfassung
- 5.3 Die interpretative Auswertung des Interviews
- 6. Wann wird helfen kontraproduktiv?
- 6.1 Ergebnisse in Bezug auf das Helfersyndrom und Burnout
- 6.1.1 Aspekte in der Helferpersönlichkeit
- 6.1.2 Kontraproduktivität als Folge des Burnout-Syndroms
- 6.2 Weitere Deformationen des Helfens, die zu kontraproduktiver Hilfe führen können
- 6.3 Deformationen durch gesellschaftliche Entwicklungen
- 6.4 Resümee II
- 6.1 Ergebnisse in Bezug auf das Helfersyndrom und Burnout
- 7. Die gelungene Hilfe
- 7.1 Vermeidung von Burnout und kontraproduktiver Hilfe durch die „richtige“ Motivation
- 7.1.1 Das Fundament einer „richtigen“ Motivation
- 7.1.2 Die eigenen Ressourcen des Helfers
- 7.1.3 Die Unterstützung von außen
- 7.1.4 Der Lebenskontext des Helfers
- 7.1.5 Zusammenfassung
- 7.2 Was macht eine gelungene Helferbeziehung aus?
- 7.2.1 Die dialogische Haltung als Grundlage der Helferbeziehung
- 7.2.2 Die Balance zwischen Nähe und Distanz
- 7.2.3 Die Ratlosigkeit des Helfers als Ressource
- 7.2.4 Zusammenfassung
- 7.1 Vermeidung von Burnout und kontraproduktiver Hilfe durch die „richtige“ Motivation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Produktivität und Kontraproduktivität von Hilfeleistungen im Kontext Sozialer Arbeit. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der Helfermotivation für eine gelungene Helfer-Klient-Beziehung zu analysieren und Faktoren zu identifizieren, die zu kontraproduktiver Hilfe führen können. Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit dem Helfersyndrom und dem Burnout-Syndrom als mögliche Folgen einer ungünstigen Motivation.
- Motivationen für Hilfeleistungen in der Sozialen Arbeit
- Das Helfersyndrom und seine Auswirkungen
- Faktoren, die zu kontraproduktiver Hilfe führen
- Der Einfluss der Helferpersönlichkeit auf die Hilfeleistung
- Kriterien für eine gelungene Helfer-Klient-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Helfermotivation in der Sozialen Arbeit ein und benennt die zentrale Forschungsfrage: Wie wirkt sich die persönliche Motivation des Helfers auf die Produktivität der Hilfeleistung aus? Sie skizziert den Forschungsansatz, der die psychoanalytische Perspektive des Helfersyndroms nach Wolfgang Schmidbauer nutzt, um die Hypothese zu prüfen, dass Helfen produktiv ist, wenn der Helfer seine wahren Motive kennt. Die Arbeit strukturiert die folgenden Kapitel und erklärt die Methodik.
2. Entstehung des Hilfsbegriffs: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff des Helfens aus unterschiedlichen Perspektiven. Es untersucht verschiedene Definitionen, die ethische und philosophische Implikationen des Helfens und die gesellschaftliche Entwicklung des Hilfsbegriffs, um schliesslich den Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung und der Entstehung der Sozialen Arbeit als Profession zu verdeutlichen. Es schafft so ein breites Fundament für das Verständnis des komplexen Konzepts "Helfen".
3. Motivationen des Helfens in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit den Motivationen für Hilfeleistungen im Bereich der Sozialen Arbeit. Es analysiert verschiedene theoretische Ansätze, darunter humanistisch-psychologische, christlich-religiöse und evolutionsbiologisch-sozialpsychologische Erklärungen. Weiterhin werden persönliche Motivationen von Helfern betrachtet und durch eine empirische Studie untermauert. Die Rolle der Biographie und die Perspektive der Selbsthilfe werden ebenfalls einbezogen. Das Kapitel mündet in ein Resümee, welches die vielschichtigen Motivationen zusammenfasst.
4. Das Helfersyndrom mit Folge Burnout: Dieses Kapitel definiert das Helfersyndrom und seine Ursachen. Es analysiert das Phänomen des „hilflosen Helfers“ und die problematische „Ware Nächstenliebe“, um schliesslich die Entwicklung zum Burnout-Syndrom als Konsequenz zu beschreiben. Der Fokus liegt auf der Erklärung der psychologischen Mechanismen und der Verknüpfung von Helfermotivation und den negativen Folgen.
5. Exkurs: Interview zur Berufsmotivation in Bezug auf das Helfersyndrom: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse eines Interviews, das die theoretischen Überlegungen der Arbeit auf einer praktischen Ebene überprüft. Es wird die Methodik erläutert und die Ergebnisse interpretiert. Der Exkurs dient dazu, die empirische Validität der theoretischen Annahmen zu untersuchen.
6. Wann wird helfen kontraproduktiv?: Dieses Kapitel untersucht die Bedingungen, unter denen Hilfe kontraproduktiv wird. Es analysiert die Rolle des Helfersyndroms und des Burnouts, aber auch weiterer Faktoren wie persönliche Eigenschaften des Helfers und gesellschaftliche Einflüsse. Es beschreibt verschiedene Arten der kontraproduktiven Hilfe und entwickelt eine umfassende Analyse ihrer Ursachen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Produktivität und Kontraproduktivität von Hilfeleistungen in der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Produktivität und Kontraproduktivität von Hilfeleistungen in der Sozialen Arbeit. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Rolle der Helfermotivation für eine gelungene Helfer-Klient-Beziehung und die Identifizierung von Faktoren, die zu kontraproduktiver Hilfe führen können. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Helfersyndrom und dem Burnout-Syndrom als mögliche Folgen ungünstiger Motivation.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Motivationen für Hilfeleistungen in der Sozialen Arbeit, das Helfersyndrom und dessen Auswirkungen, Faktoren, die zu kontraproduktiver Hilfe führen, der Einfluss der Helferpersönlichkeit auf die Hilfeleistung und Kriterien für eine gelungene Helfer-Klient-Beziehung. Die Arbeit beleuchtet den Hilfsbegriff aus verschiedenen Perspektiven (ethisch, philosophisch, gesellschaftlich) und analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Helfermotivation (humanistisch-psychologisch, christlich-religiös, evolutionsbiologisch-sozialpsychologisch).
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit verwendet einen Forschungsansatz, der die psychoanalytische Perspektive des Helfersyndroms nach Wolfgang Schmidbauer nutzt, um die Hypothese zu prüfen, dass Helfen produktiv ist, wenn der Helfer seine wahren Motive kennt. Zusätzlich wird ein Interview zur Berufsmotivation in Bezug auf das Helfersyndrom durchgeführt und interpretiert, um die empirische Validität der theoretischen Annahmen zu untersuchen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Entstehung des Hilfsbegriffs, Motivationen des Helfens in der Sozialen Arbeit, Das Helfersyndrom mit Folge Burnout, Exkurs: Interview zur Berufsmotivation in Bezug auf das Helfersyndrom, Wann wird helfen kontraproduktiv?, und Die gelungene Hilfe. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Thematik und baut auf den vorherigen Kapiteln auf. Die Kapitel beinhalten jeweils eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse.
Welche zentralen Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirkt sich die persönliche Motivation des Helfers auf die Produktivität der Hilfeleistung aus? Zusätzlich werden Fragen nach den Ursachen des Helfersyndroms und des Burnouts, den Faktoren kontraproduktiver Hilfe und den Kriterien für eine gelungene Helfer-Klient-Beziehung untersucht.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse zur Vielschichtigkeit der Helfermotivation, den Gefahren des Helfersyndroms und Burnouts, den Ursachen kontraproduktiver Hilfe und den Faktoren, die zu einer gelingenden Helfer-Klient-Beziehung beitragen. Die Ergebnisse basieren auf theoretischen Analysen, empirischen Studien und einem Interview, das die theoretischen Überlegungen auf einer praktischen Ebene überprüft.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass eine gelungene Hilfeleistung von einer reflektierten und adäquaten Helfermotivation abhängt. Kontraproduktive Hilfe kann durch ein mangelndes Bewusstsein für die eigenen Motive, das Helfersyndrom und Burnout, sowie durch gesellschaftliche Einflüsse entstehen. Eine gelungene Helfer-Klient-Beziehung zeichnet sich durch eine dialogische Haltung, eine Balance zwischen Nähe und Distanz und die Nutzung der eigenen Ressourcen des Helfers aus.
- Quote paper
- Laura Podorf (Author), 2011, Helfersyndrom und Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184767