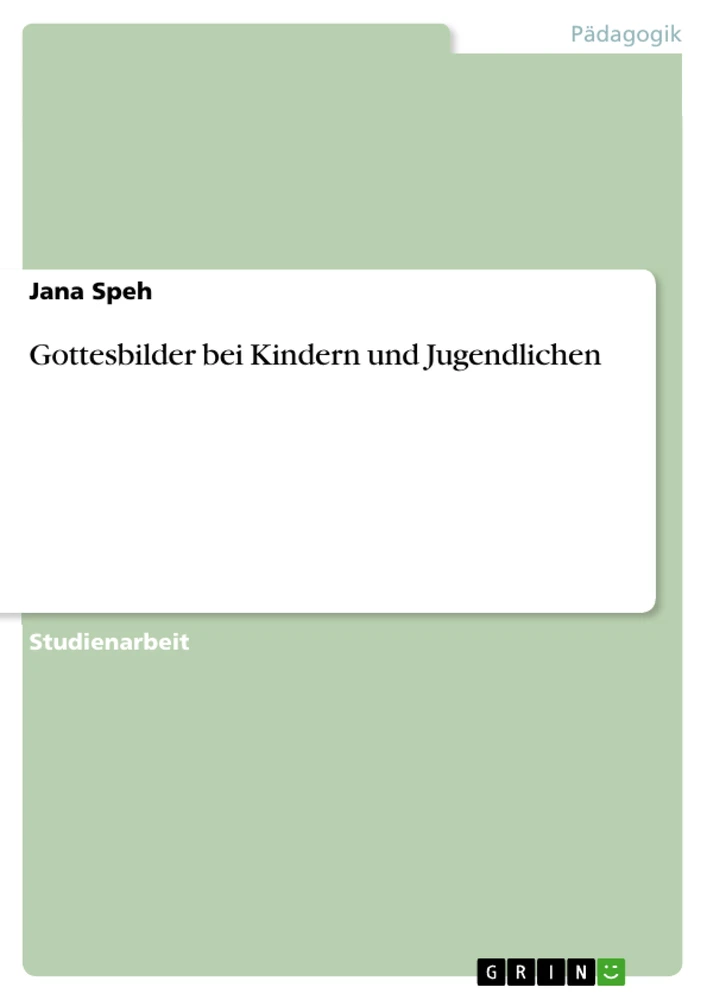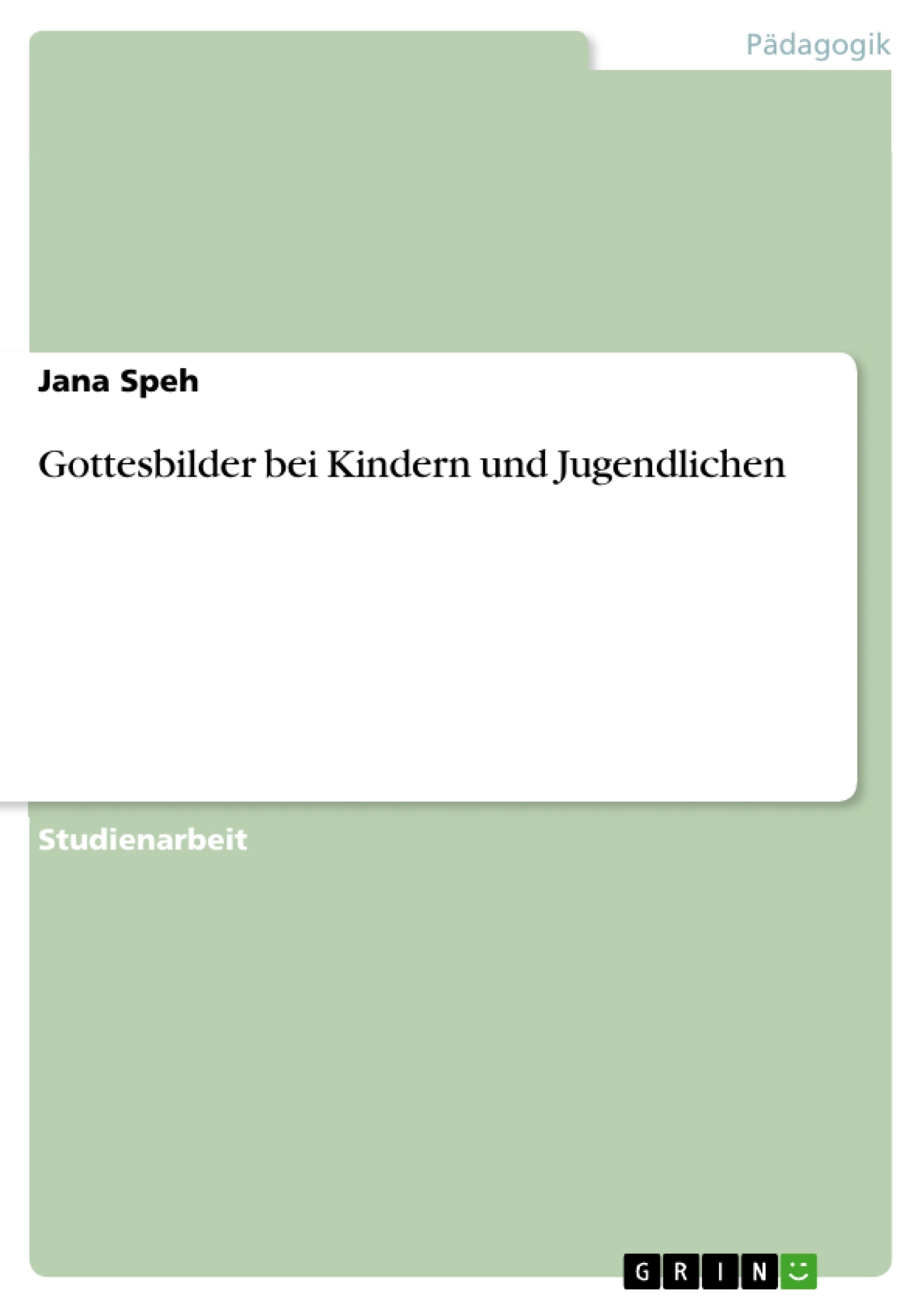Wer ist für uns eigentlich ,,Gott"? Wie stellen wir uns ihn oder sie eigentlich vor? Egal, aus welchen sozialen Verhältnissen jemand kommt und ob er oder sie eine religiöse Erziehung genossen hat, irgendein Bild wer oder was ,,Gott" sein könnte, hat jeder. Aber selbst unter jenen Menschen, die einen gemeinsamen Glauben teilen, gibt es Unterschiede. Zu allem, was wir mit einem Namen benennen, möchten wir ein Bild vor Augen haben. Ein mehr oder weniger konkretes Bild, das zu einem nicht unwesentlichen Teil davon abhängt, wie es uns unsere Eltern während unserer Kindheit im Rahmen der Erziehung vermittelt haben.
Es ist für Religionslehrerinnen und Religionslehrer daher sehr wichtig zu wissen, wie Kinder über Gott denken und welche Vorstellungen sie von ihm haben. Denn erst wenn dies bekannt ist, können wir unseren Schülerinnen und Schülern die christliche Botschaft vermitteln.
In meiner Hausarbeit zum Thema „Wie entstehen Gottesbilder bei Kindern und Jugendlichen?“ möchte ich zunächst auf die allgemeine Bildung eines Gottesbildes eingehen. Es sollen Geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, sowie der mögliche Einfluss der Eltern oder Erzieher bei der Bildung eines Gottesbildes überprüft werden. In einem anderen Kapitel meiner Arbeit werde ich auf den Wandel der Gottesvorstellungen eingehen und dabei die Bereiche Kindheit und Jugend voneinander abgrenzen. Auch die Vermittlung von Gottesbildern und die daraus resultierenden didaktischen Konsequenzen für den Unterricht, werden am Ende der Arbeit berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition
- 3. Entstehung von Gottesbildern
- 3.1 Geschlechtsspezifische Gottesbilder
- 3.2 Der Einfluss von Eltern und Erziehern auf das kindliche Gottesbild
- 3.3 Dunkle oder gefährliche Gottesbilder
- 4. Der Wandel der Gottesvorstellung
- 4.1 Gottesvorstellungen in der Kindheit
- 4.2 Gottesvorstellungen im Jugendalter
- 5. Arten der Vermittlung von Gottesbildern
- 5.1 Didaktische Konsequenzen
- 6. Zusammenfassung / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung von Gottesbildern bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, die Faktoren zu beleuchten, die die Entwicklung dieser Bilder beeinflussen, und ein besseres Verständnis dafür zu schaffen, wie Kinder und Jugendliche Gott wahrnehmen und verstehen. Die Arbeit berücksichtigt dabei geschlechtsspezifische Unterschiede, den Einfluss der Eltern und Erzieher sowie den Wandel der Gottesvorstellungen im Laufe der Entwicklung.
- Entwicklung von Gottesbildern im Kindes- und Jugendalter
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gottesvorstellung
- Einfluss von Eltern und Erziehern auf die kindliche Gottesvorstellung
- Wandel der Gottesvorstellung über die Zeit
- Didaktische Konsequenzen für den Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gottesbilder bei Kindern und Jugendlichen ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach deren Entstehung. Sie hebt die Bedeutung des Verständnisses kindlicher Gottesvorstellungen für den Religionsunterricht hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, welcher die geschlechtsspezifischen Unterschiede, den Einfluss der Eltern sowie den Wandel der Gottesvorstellungen im Laufe der Entwicklung beleuchten soll. Die Arbeit betont die Diversität der Gottesbilder selbst bei Menschen gemeinsamen Glaubens.
2. Definition: Dieses Kapitel klärt den Begriff „Gottesbild“. Es wird definiert, dass ein Gottesbild nicht nur die Vorstellung von Gottes Aussehen oder Handeln umfasst, sondern auch seine Beziehung zu den Menschen. Die enge Verbindung zwischen Gottesbeziehung und Gottesvorstellung wird hervorgehoben. Das Kapitel betont, dass die Vorstellung von Gott die Haltung und Beziehung zu ihm prägt und umgekehrt persönliche Erfahrungen zu Gott das Gottesbild stetig verändern.
3. Entstehung von Gottesbildern: Dieses Kapitel erörtert die Entstehung von Gottesbildern bei Kindern. Es wird beschrieben, wie vielfältig die Vorstellungen von Gott sind und der Einfluss der Eltern und biblischer Texte hervorgehoben. Kinder orientieren sich an ihrer Umwelt und bekannten Personen, während sie gleichzeitig wissen, dass Gott unsichtbar ist. Das Kapitel betont das Zusammenspiel von drei Ebenen nach Fritz Oser: der Realitätsebene, der Sinnesebene und der religiös-glaubensmäßigen Ebene, die für die Entstehung eines Gottesbildes unerlässlich sind.
3.1 Geschlechtsspezifische Gottesbilder: Hier wird der Unterschied in der religiösen Sozialisation von Jungen und Mädchen und deren Einfluss auf die Entwicklung unterschiedlicher Gottesbilder analysiert. Jungen assoziieren Gott oft mit Macht und Distanz, während Mädchen eine engere, emotionalere Beziehung betonen. Trotzdem ist das Gottesbild bei beiden Geschlechtern meist männlich geprägt. Das Kapitel unterstreicht den Einfluss religiöser Traditionen und die Übernahme von Bildern aus der Umwelt.
4. Der Wandel der Gottesvorstellung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Gottesvorstellungen im Laufe der Kindheit und Jugend. Es untersucht die Veränderungen und Unterschiede zwischen den Gottesbildern in diesen beiden Phasen. Das Kapitel liefert Einblicke in die Dynamik des Gottesbildes und dessen Anpassung an die jeweilige Lebensphase.
5. Arten der Vermittlung von Gottesbildern: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Wege der Vermittlung von Gottesbildern und zieht didaktische Konsequenzen für den Religionsunterricht. Es wird die Bedeutung des Verständnisses kindlicher Gottesvorstellungen für eine effektive religiöse Bildung im Unterricht herausgearbeitet. Es befasst sich also mit der Frage, wie die Erkenntnisse über die Entwicklung von Gottesbildern im Unterricht angewendet werden können.
Schlüsselwörter
Gottesbilder, Kinder, Jugendliche, Religionspädagogik, Geschlechtsspezifische Unterschiede, Elternhaus, Biblische Texte, Gottesvorstellung, Entwicklung, Didaktik, Religionsunterricht.
Häufig gestellte Fragen zu "Entstehung von Gottesbildern bei Kindern und Jugendlichen"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehung von Gottesbildern bei Kindern und Jugendlichen. Sie beleuchtet die Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen, und zielt auf ein besseres Verständnis der kindlichen und jugendlichen Gotteswahrnehmung ab.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung von Gottesbildern im Kindes- und Jugendalter, geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gottesvorstellung, den Einfluss von Eltern und Erziehern, den Wandel der Gottesvorstellung über die Zeit und didaktische Konsequenzen für den Religionsunterricht.
Wie wird der Begriff "Gottesbild" definiert?
Ein Gottesbild umfasst nicht nur die Vorstellung von Gottes Aussehen oder Handeln, sondern auch seine Beziehung zu den Menschen. Die enge Verbindung zwischen Gottesbeziehung und Gottesvorstellung wird betont. Die Vorstellung von Gott prägt die Haltung und Beziehung zu ihm, und umgekehrt verändern persönliche Erfahrungen das Gottesbild stetig.
Wie entstehen Gottesbilder bei Kindern?
Die Entstehung von Gottesbildern bei Kindern ist vielfältig und wird beeinflusst von der Umwelt, bekannten Personen, biblischen Texten und dem Zusammenspiel von Realitätsebene, Sinnesebene und religiös-glaubensmäßiger Ebene (nach Fritz Oser). Kinder orientieren sich an ihrer Umwelt und bekannten Personen, obwohl sie wissen, dass Gott unsichtbar ist.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in Gottesbildern?
Ja, Jungen assoziieren Gott oft mit Macht und Distanz, während Mädchen eine engere, emotionalere Beziehung betonen. Trotzdem ist das Gottesbild bei beiden Geschlechtern meist männlich geprägt. Der Einfluss religiöser Traditionen und die Übernahme von Bildern aus der Umwelt spielen eine Rolle.
Wie verändert sich die Gottesvorstellung im Laufe der Entwicklung?
Die Arbeit untersucht die Veränderungen und Unterschiede zwischen den Gottesbildern im Kindes- und Jugendalter. Sie liefert Einblicke in die Dynamik des Gottesbildes und dessen Anpassung an die jeweilige Lebensphase.
Welche didaktischen Konsequenzen werden für den Religionsunterricht gezogen?
Die Arbeit analysiert verschiedene Wege der Vermittlung von Gottesbildern und zieht didaktische Konsequenzen für den Religionsunterricht. Es wird die Bedeutung des Verständnisses kindlicher Gottesvorstellungen für eine effektive religiöse Bildung im Unterricht herausgearbeitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Gottesbilder, Kinder, Jugendliche, Religionspädagogik, geschlechtsspezifische Unterschiede, Elternhaus, biblische Texte, Gottesvorstellung, Entwicklung, Didaktik, Religionsunterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Definition von Gottesbild, Entstehung von Gottesbildern (inkl. geschlechtsspezifischer Aspekte), Wandel der Gottesvorstellung, Arten der Vermittlung von Gottesbildern und Zusammenfassung/Fazit.
- Quote paper
- Jana Speh (Author), 2010, Gottesbilder bei Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184703