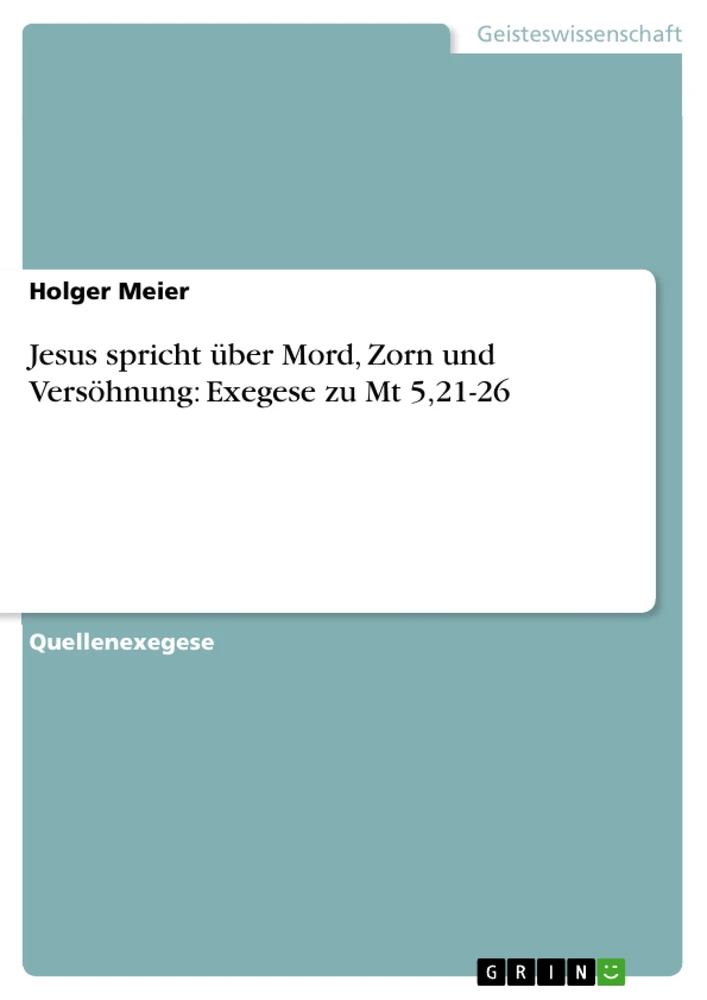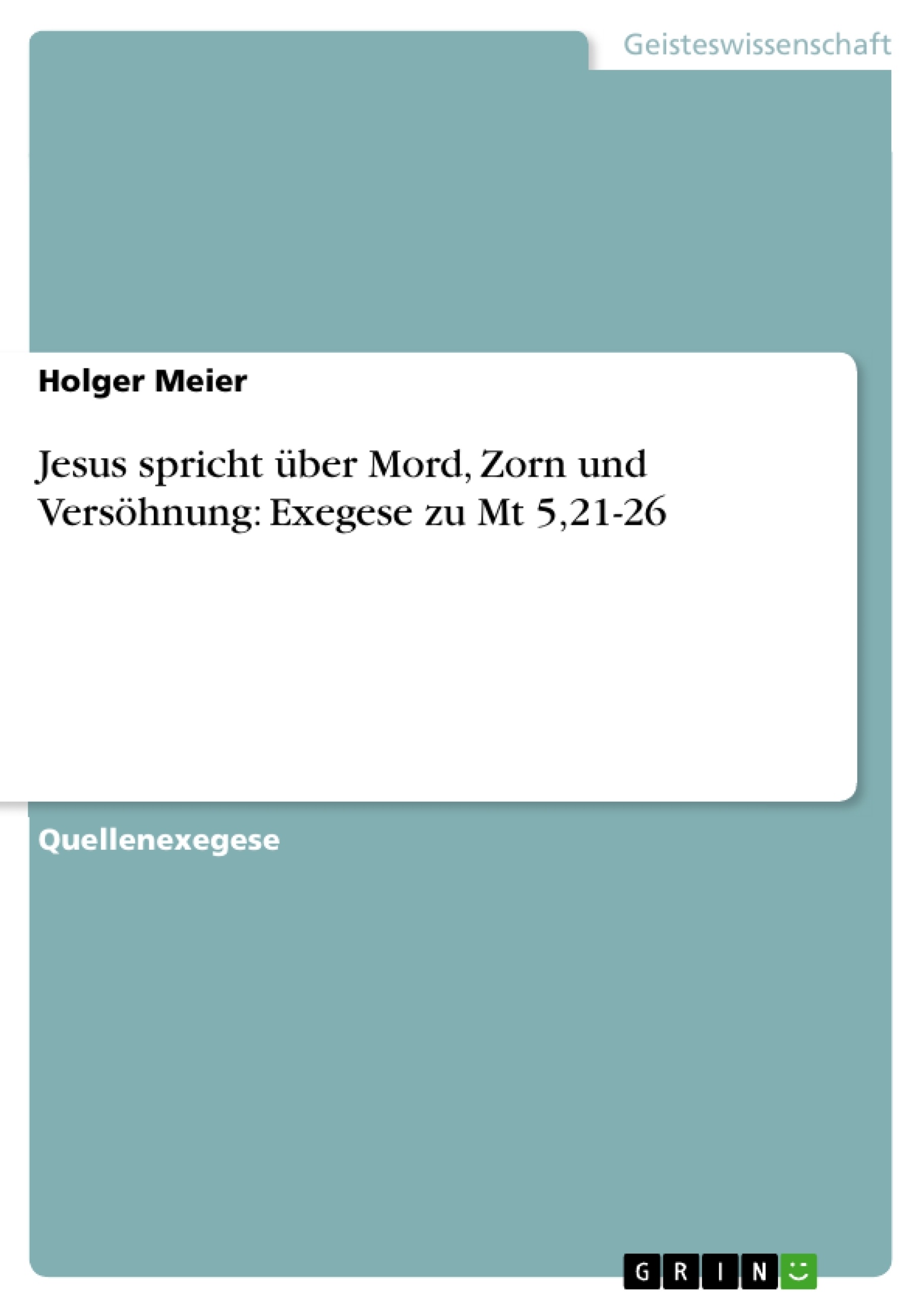1. Hinführung
Der Textabschnitt Mt 5,21-261 erscheint relativ am Anfang der Jesusgeschichte des Matthäusevangeliums. In Mt 1-2 berichtet der Autor von Jesu Abstammung und Kindheit. In Mt 3,1-12 erscheint Johannes der Täufer und in 3,13-17 tauft er den erwachsenen Jesus,
woraufhin dieser von Gott hörbar als Sein „geliebter Sohn“ identifiziert wird. Etwas später widersteht Jesus erfolgreich den Versuchungen des Teufels (4,1-11), und ab 4,17 beginnt
Jesus, öffentlich in Galiläa zu wirken, indem er, wie vor ihm Johannes der Täufer, predigt: „Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen“ (Mt 4,17). Vier Fischer schließen sich ihm als seine ersten Jünger an (4,18-22) und er predigt und heilt in
Galiläa (4,23-25), woraufhin ihm „große Volksmengen“ aus Galiläa und der weiteren Umgebung folgen. In Anbetracht der vielen Menschen steigt Jesus nun auf einen Berg in Galiläa und hält seine erste Rede (Mt 5,1f), die so genannte Bergpredigt (Mt 5-7). Sie beginnt
mit den Seligpreisungen (5,1-12), auf die eine Ansprache folgt, in der die Jünger als „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ bezeichnet werden (5,13-16). Darauf hin erklärt Jesus sein Verhältnis zum Gesetz und zu den Propheten (5,17-20) indem er sagt, er sei
nicht gekommen, sie aufzulösen, sondern sie zu erfüllen; eindringlich warnt er davor, sie aufzulösen und fordert in Vers 20 von seinen Zuhörern eine bessere Gerechtigkeit als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Diese Verse (17-20) sind die programmatische Einleitung und Vers 20 insbesondere ist die zusammenfassende Überschrift für das nun folgende in Mt 5,21ff: Hier entfaltet Jesus nun in sechs so genannten Antithesen das, was er unter der besseren Gerechtigkeit versteht. Der Inhalt des Abschnitts, der das Thema dieser Hausarbeit ist, besteht aus dreimal zwei Versen: In der ersten Antithese spricht Jesus in Mt 5,21f über sein Verständnis des Gebotes „Du sollst nicht töten“ und sagt in
23f, man solle sich zuerst mit dem Bruder versöhnen, bevor man eine Opfergabe darbringt. In 25f mahnt er zur Einigung mit dem Prozessgegner. Fünf weitere Antithesen folgen, in denen Jesus sein Verständnis des Gesetzes erläutert und über Ehebruch (5,27-
30) und Ehescheidung (31f), das Schwören eines Eides (33-37), die Vergeltung (38-42) und die Feindesliebe (43-47) spricht. Schließlich fordert er seine Zuhörer auf, „vollkommen“ [zu] sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist“ (Vers 48).
In den nächsten beiden Kapiteln (6+7) setzt Jesus seine Bergpredigt fort...
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Historische Analyse
- Quellen- und Redaktionskritik
- Der Historische Kontext und Religionsgeschichtliche Vergleich
- Sprachliche Analyse
- Gliederung und Struktur
- Syntaktisch - Stilistische Analyse
- Semantische Analyse zentraler Begriffe
- Formkritik (Gattungsanalyse)
- Pragmatik/Funktion und Intention des Textes
- Rezeptionsästhetische Analyse: Unterrichtliche Impulse zum Text
- Zusammenfassende Exegese
- Anhang
- Der verwendete Bibeltext Mt 5,21-26
- Synoptischer Vergleich
- Mt 5,21-26 als Erklärungstext
- Mt 5,21-26 als Teil von Jesu „Schulhofpredigt“
- Exkurs: Die Textzeugen und die abweichende Lesart „ohne Ursache“
- Exkurs: Die Diskussion über Vers 22
- Exkurs: Die Antithese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der exegetischen Analyse des Textabschnitts Matthäus 5,21-26. Ziel ist es, den Text im Kontext der Bergpredigt und der Jesusgeschichte des Matthäusevangeliums zu verstehen und die darin enthaltenen Aussagen Jesu zu Mord, Zorn und Versöhnung zu erforschen. Dabei werden insbesondere die sprachlichen, historischen und rezeptionsästhetischen Aspekte des Textes beleuchtet.
- Die Bedeutung des „Gebotes“ im Kontext der Bergpredigt und des Alten Testaments
- Die Rolle der Versöhnung in der Lehre Jesu
- Die sprachliche Gestaltung der Antithese in Matthäus 5,21-26
- Die Relevanz des Textes für die heutige Zeit
- Die Beziehung zwischen dem „inneren Menschen“ und dem „äußeren Handeln“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Hinführung zum Textabschnitt und stellt seine Bedeutung innerhalb der Bergpredigt und des gesamten Matthäusevangeliums dar. Im zweiten Kapitel wird die historische Analyse des Textes vorgenommen, wobei Quellenkritik und die religionsgeschichtliche Einordnung des Textes beleuchtet werden. Das dritte Kapitel widmet sich der sprachlichen Analyse des Textabschnitts, einschließlich seiner Struktur, Syntax, Semantik und Form. Es werden die Schlüsselbegriffe des Textes erörtert und dessen pragmatische Funktion und Intention untersucht. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Rezeptionsästhetik des Textes und bietet unterrichtliche Impulse für eine Auseinandersetzung mit Matthäus 5,21-26.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit behandelt zentrale Themen wie die Jesusgeschichte, die Bergpredigt, die Exegese des Neuen Testaments, die Bedeutung des Gesetzes, Mord, Zorn, Versöhnung, die Antithese, die Funktion von Sprache, Rezeptionsästhetik, unterrichtliche Impulse und die Bedeutung des Textes für die heutige Zeit.
- Quote paper
- Holger Meier (Author), 2008, Jesus spricht über Mord, Zorn und Versöhnung: Exegese zu Mt 5,21-26, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184669