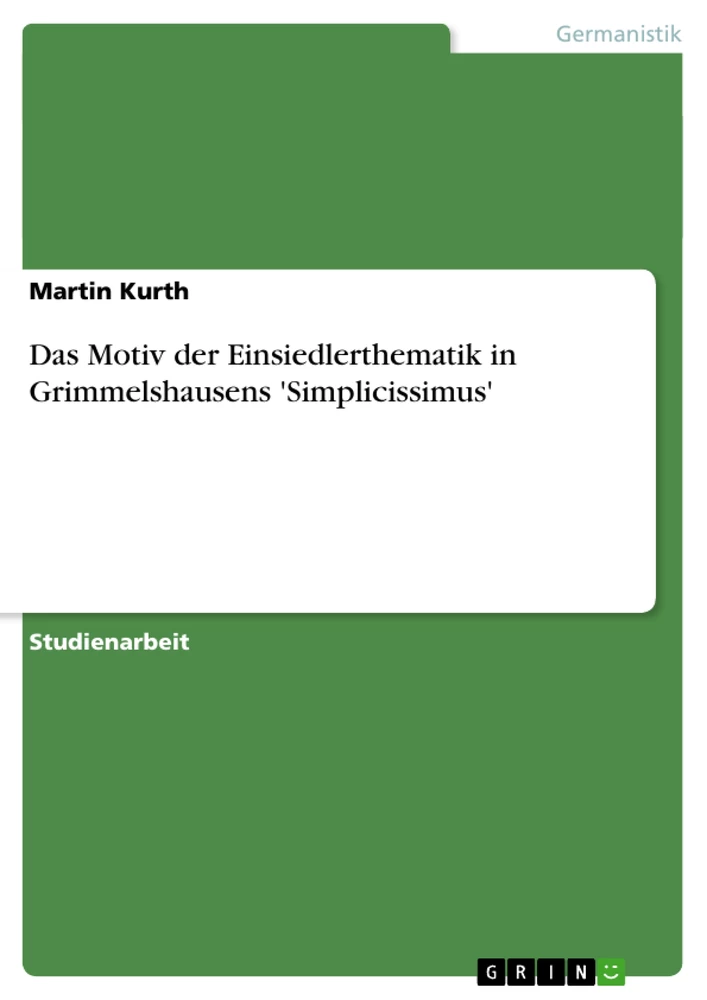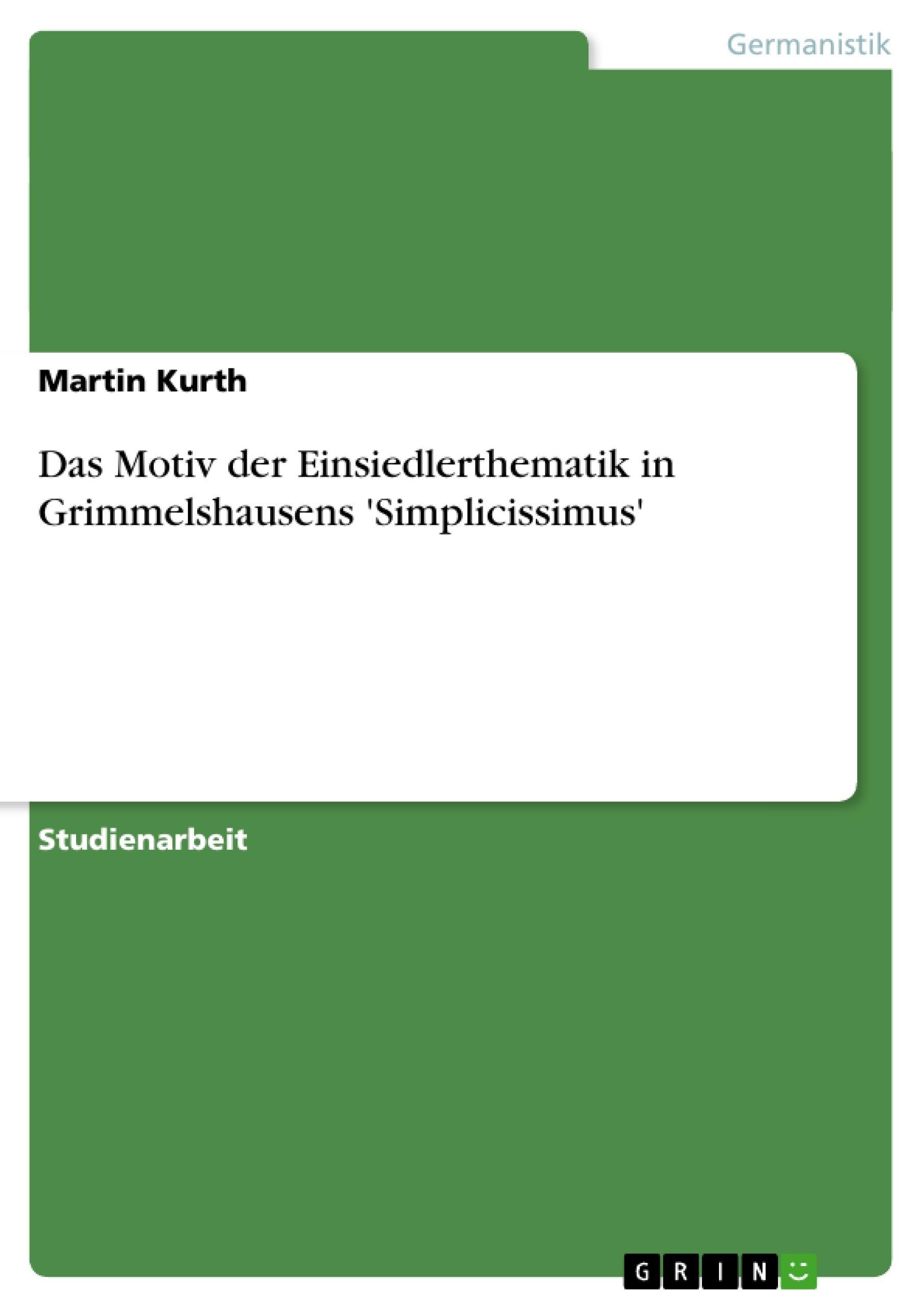Die Komplexität des Simplicissimusromans ist bereits in vielen Untersuchungen erwähnt worden. Das sich der bedeutendste deutsche Roman der Barockzeit jedem Versuch einer einfachen Auslegung verschließt, ist aus diesem Grunde unumstritten. Diese Arbeit soll nun einen Einblick in die Diskussion um den Stellenwert der Religion in Grimmelshausens umfangreichsten Werk geben. Um das Themenfeld weiter einzuschränken, beschäftigt sie sich eingehend und, soweit dies möglich ist, ausschließlich mit der Einsiedlerthematik, die vor allem im sechsten Buch, der Continuatio, eine zentrale und vieldiskutierte Stellung einnimmt. Eine weitestgehend textimmanente Darstellung der Einsiedlerepisoden soll als Einstieg in die Untersuchung dienen. Dabei setzt die Arbeit grundsätzlich Strellers Feststellung voraus: „Es ist ein religiöses Konzept, was dem Simplicissimus und seinen Folgeschriften zugrundeliegt.“ 1 Des weiteren wird, ebenfalls auf der Basis der ausgewählten Episoden versucht, eine Einordnung der christlichen Lehre in Grimmelshausens Werk in die geistesgeschichtliche Situation der Zeit zu leisten. Ziel der Arbeit ist es, Forschungsstand und Diskussion zu diesem Thema darzustellen und gegebenenfalls kritisch Stellung zu beziehen Auf eine Untersuchung der Konfessionalität Grimmelshausens, wie viele Autoren sie anstreben, wird in diesem Zusammenhang verzichtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Untersuchung der Einsiedlerepisoden
- 2.1 Simplicius beim Einsiedel im Spessart
- 2.2 Die Mooskopfeinsiedelei
- 2.3 Die Kreuzinselepisode
- 3. Historische Grundlagen einer Deutung
- 3.1 Gesellschaft im 17. Jahrhundert
- 3.2 Literatur im 17. Jahrhundert
- a) Die erbauliche Funktion barocker Romane
- b) Der mehrfache Schriftsinn
- 4. Der Simplicissimus im Spiegel des barocken Schrifttums
- 4.1 Spirituelle Hermeneutik im Simplicissimusroman
- 4.2 Der Simplicissimus: Ein niederer Roman?
- 5. Die Funktion des Einsiedlerphänomens im Simplicissimusroman
- 6. Die Continuatio als Schluss des Simplicissimus - Grimmelshausens Bekenntnis zum Skepizismus?
- 7. Die Rückkehr des Helden in späteren Werken
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einsiedlerthematik in Grimmelshausens „Simplicissimus“ und deren Bedeutung im Kontext der religiösen und gesellschaftlichen Situation des 17. Jahrhunderts. Sie beleuchtet den Forschungsstand zu diesem Thema und nimmt gegebenenfalls kritisch Stellung. Die Arbeit verzichtet auf eine Untersuchung der Konfessionalität Grimmelshausens.
- Die Darstellung der Einsiedlerepisoden im Simplicissimus Roman
- Die Einordnung der christlichen Lehre in Grimmelshausens Werk in die geistesgeschichtliche Situation des 17. Jahrhunderts
- Die Funktion des Einsiedlerphänomens als Alternative zum „mundus Inversus“
- Die religiöse und weltanschauliche Entwicklung des Simplicissimus
- Grimmelshausens mögliche Bekenntnis zum Skeptizismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Komplexität des Simplicissimus und kündigt eine Untersuchung des Stellenwerts der Religion im Werk an, fokussiert auf die Einsiedlerthematik, besonders im sechsten Buch (Continuatio). Sie verweist auf Strellers These eines religiösen Konzepts im Simplicissimus und formuliert das Ziel, den Forschungsstand darzustellen und kritisch zu bewerten, wobei eine Untersuchung der Konfessionalität Grimmelshausens vermieden wird.
2. Untersuchung der Einsiedlerepisoden: Dieses Kapitel beschreibt die drei Einsiedlerepisoden im Simplicissimus: Simplicius' unfreiwilliges Einsiedlerleben mit seinem Vater im Spessart, seinen wenig erfolgreichen Versuch der Einsiedelei als Erwachsener und schließlich sein drittes Einsiedlerdasein auf der Kreuzinsel. Es dient als Grundlage für die weitere Untersuchung der Einsiedlerthematik im Roman.
2.1 Simplicius beim Einsiedel im Spessart: Dieser Abschnitt analysiert die erste Einsiedlerepisode, in der der naive Simplicius von einem Eremiten unterrichtet wird. Der Einsiedler wird als christlicher Lehrer dargestellt, dessen Maxime „bete und arbeite“ ist. Die Analyse beleuchtet verschiedene Interpretationen der Rolle des Einsiedlers, einschließlich der Frage, ob er als Vorbild oder eher als Kontrastfigur zu Simplicius' Lebensweg zu verstehen ist. Die Diskussion umfasst den Einfluss der persönlichen Rückschläge des Einsiedlers (Kriegsniederlage, Verlust der Frau) auf seine Weltanschauung und religiöse Ethik.
3. Historische Grundlagen einer Deutung: Dieses Kapitel betrachtet den historischen Kontext des Simplicissimus, indem es die Gesellschaft und die Literatur des 17. Jahrhunderts untersucht. Es analysiert die erbauliche Funktion barocker Romane und das Konzept des mehrfache Schriftsinns.
4. Der Simplicissimus im Spiegel des barocken Schrifttums: Dieser Abschnitt untersucht den Simplicissimus im Kontext der barocken Literatur und beleuchtet spirituelle Hermeneutik und die Frage, ob der Simplicissimus als „niederer Roman“ zu klassifizieren ist.
5. Die Funktion des Einsiedlerphänomens im Simplicissimusroman: Dieses Kapitel analysiert die umfassende Funktion der Einsiedlerepisoden im Gesamtwerk. Es soll die Bedeutung der Einsiedelei im Rahmen der religiösen und weltanschaulichen Entwicklung des Simplicissimus ergründen.
Schlüsselwörter
Simplicissimus, Grimmelshausen, Einsiedlerthematik, Barockliteratur, Religiosität, Christentum, Mundus Inversus, Askese, Geistesgeschichte 17. Jahrhundert, Spirituelle Hermeneutik.
Häufig gestellte Fragen zum Simplicissimus und seiner Einsiedlerthematik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Einsiedlerthematik in Grimmelshausens „Simplicissimus“ und deren Bedeutung im Kontext des 17. Jahrhunderts. Sie untersucht die Einsiedlerepisoden, ordnet sie in den religiösen und gesellschaftlichen Hintergrund ein und beleuchtet die religiöse und weltanschauliche Entwicklung des Simplicissimus. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Einsiedelei als mögliche Alternative zum „mundus inversus“. Die Konfessionalität Grimmelshausens wird dabei nicht untersucht.
Welche Einsiedlerepisoden werden untersucht?
Die Arbeit analysiert drei Einsiedlerepisoden: Simplicius' unfreiwilliges Einsiedlerleben mit seinem Vater im Spessart, seinen erfolglosen Versuch der Einsiedelei als Erwachsener und sein drittes Einsiedlerdasein auf der Kreuzinsel. Jede Episode wird einzeln betrachtet und im Kontext des Gesamtwerks interpretiert.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Das 17. Jahrhundert wird als gesellschaftlicher und literarischer Hintergrund beleuchtet. Die erbauliche Funktion barocker Romane und das Konzept des mehrfache Schriftsinns werden analysiert, um den Simplicissimus besser einordnen zu können.
Welche Rolle spielt die religiöse Lehre?
Die Arbeit untersucht die Einordnung der christlichen Lehre in Grimmelshausens Werk in die geistesgeschichtliche Situation des 17. Jahrhunderts. Sie erforscht, wie die Einsiedlerepisoden die religiöse und weltanschauliche Entwicklung des Simplicissimus widerspiegeln und ob Grimmelshausens Werk ein Bekenntnis zum Skeptizismus enthält.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, die die Zielsetzung und den Forschungsstand darlegt. Es folgen Kapitel zur Analyse der Einsiedlerepisoden, zum historischen Kontext, zur Einordnung des Simplicissimus in die Barockliteratur, zur Funktion des Einsiedlerphänomens im Roman und zur Interpretation der Continuatio. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Simplicissimus, Grimmelshausen, Einsiedlerthematik, Barockliteratur, Religiosität, Christentum, Mundus Inversus, Askese, Geistesgeschichte 17. Jahrhundert, Spirituelle Hermeneutik.
Welche zentralen Fragen werden beantwortet?
Die Arbeit versucht unter anderem folgende Fragen zu beantworten: Wie werden die Einsiedlerepisoden im Simplicissimus dargestellt? Welche Funktion hat das Einsiedlerphänomen als Alternative zum „mundus inversus“? Wie entwickelt sich die religiöse und weltanschauliche Haltung des Simplicissimus? Ist Grimmelshausens Bekenntnis zum Skeptizismus in der Continuatio erkennbar?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Methode, die die Textanalyse mit der Einordnung in den historischen und literarischen Kontext verbindet. Die verschiedenen Interpretationen der Einsiedlerepisoden werden diskutiert und kritisch bewertet.
- Quote paper
- Martin Kurth (Author), 2003, Das Motiv der Einsiedlerthematik in Grimmelshausens 'Simplicissimus', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18456