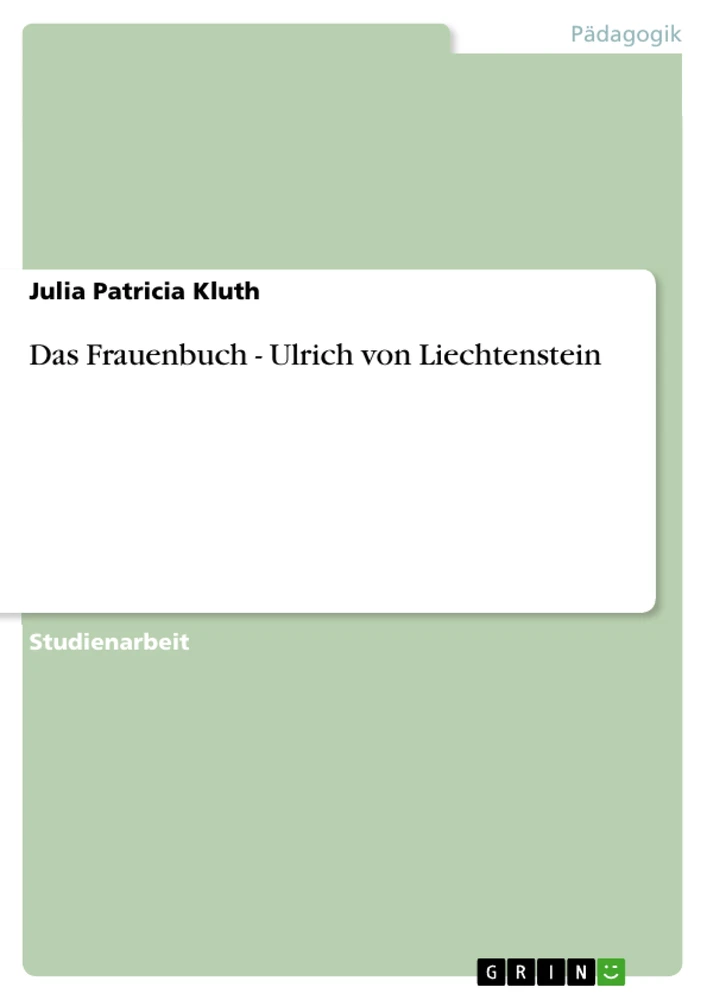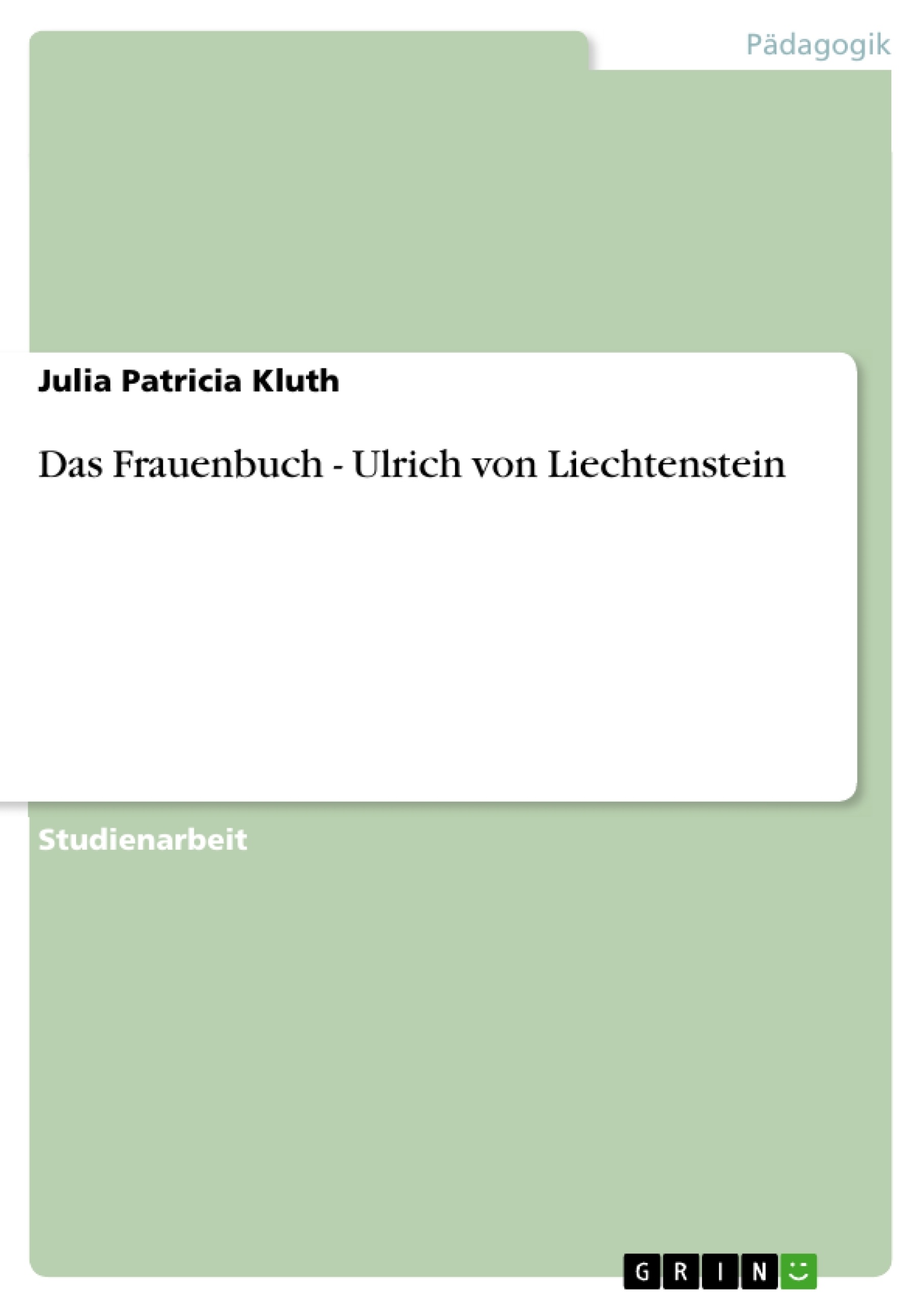Das genaue Geburtsdatum von Ulrich von Liechtenstein ist nicht bekannt, wird aber zwischen den Jahren 1200 – 1210 datiert. Gestorben ist Liechtenstein am 26.01.1275 in Österreich, wo er auch geboren wurde. Für mittelalterliche Verhältnisse war eine solche Lebensdauer damals noch sehr ungewöhnlich. Dort lebte er in der Steiermark, wo er auch einem einflussreichen Ministerialengeschlecht angehörte. Er war der Sohn Dietmars III und hatte vier Geschwister (Otto, Dietmar, Hedwig und eine nirgendwo namentlich genannte Schwester). Ulrich selbst war verheiratet mit Perchta von Weissenstein und hatte mit ihr vier Kinder (Ulrich II, Otto II, Diemut und Perchta).
Grundsätzlich war er Minnesänger und Dichter, aber auch Inhaber einiger Ämter, wie zum Beispiel Truchseß der Steiermark, von 1244 bis 1245. Von 1267 bis 1272 war er Marschall und 1272 auch noch Landrichter. Hierbei vertrat er den Landesherren im Gericht und im Taiding. Dadurch war er einer der bekanntesten Vertreter des steirischen Herrenstandes. Er wird in insgesamt 94 Urkunden als Aussteller, Vertragspartner, Bürge, Zeuge, Siegler, Schiedsrichter und Vermittler sowohl in seinem Herzogtum als auch in ganz Österreich, Kärnten und Krain genannt. Aufgrund seines vielfältigen Lebensstils lässt sich vermuten, dass er auch auf anderen Gebieten, wie Kunst, Musik und Literatur recht belesen war.
Am meisten aufgehalten haben soll sich Ulrich von Liechtenstein auf der Frauenburg, die heute als Burgruine zu besichtigen ist, im Murtal im Süden der Steiermark.
Es heißt, dass er nach der Mitte des Jahrhunderts, nachdem 1246 der steirische Herzog Friedrich II und 1250 der deutsche Kaiser Friedrich II gestorben waren, ein führender Machtspieler war und in diesem Zuge 1260 die ungarischen Gegner von Ottokar II von Böhmen unterstützte. Obwohl er dessen Herrschaftsanspruch 1253 noch gefördert hatte. Aufgrund dieses Gegenspiels wurde er im Jahre 1267 von Ottokar eingekerkert, aber kurz darauf doch in die oben genannten Ämter berufen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Autor und Werke
- 2. „Das Frauenbuch“ - Inhalt
- 2.1 Förmliches - Prolog
- 2.2 Förmliches - Epilog
- 3. Minnerede im Mittelalter
- 4. Der Frauenpreis - Die Frau aus der Sicht des Ritters Ulrich
- 5. Die Beziehung zwischen Prolog und Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Ulrich von Lichtensteins „Das Frauenbuch“ im Kontext seiner literarischen Werke und der Minnelyrik des Mittelalters. Die Arbeit untersucht die Struktur des Werkes, insbesondere die Funktion von Prolog und Epilog, und beleuchtet die Darstellung der Frau in Ulrichs Werk.
- Ulrich von Lichtensteins Leben und Werk
- Die literarische Form und Struktur von „Das Frauenbuch“
- Die Darstellung der Frau in „Das Frauenbuch“
- Der Kontext der Minnelyrik im Mittelalter
- Der Vergleich zwischen Prolog und Epilog
Zusammenfassung der Kapitel
1. Autor und Werke: Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Biografie Ulrichs von Liechtenstein, die sein Geburtsdatum (um 1200-1210), seinen Tod (1275), seine Herkunft aus einem einflussreichen steirischen Ministerialengeschlecht und seine vielfältigen Ämter (Truchseß, Marschall, Landrichter) beleuchtet. Sein literarisches Schaffen, insbesondere sein Einfluss auf die Minnelyrik und seine Werke „Frauendienst“ und „Das Frauenbuch“, werden skizziert. Der Fokus liegt auf der Vielschichtigkeit seines Lebens, welches sowohl politische als auch literarische Dimensionen umfasste, und der Einordnung seines Werkes in den Kontext der mittelalterlichen Literatur und höfischen Kultur. Die Beschreibung seines Lebens und der Bezug zu seinen Werken dienen als Basis für das Verständnis des „Frauenbuchs“.
2. „Das Frauenbuch“ - Inhalt: Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt von Ulrich von Lichtensteins „Das Frauenbuch“. Es wird die Unterteilung in fünf Abschnitte, beginnend mit einem Prolog, hervorgehoben. Der Prolog wird als Lobgedicht an die „Vrouwe“ interpretiert, in dem der Autor seine Hingabe bekundet und den Inhalt des Buches ankündigt. Die weiteren Abschnitte des „Frauenbuches“ werden nur kurz angerissen, um den Fokus auf die Gesamtschau des Werkes und nicht auf die detaillierte Analyse der einzelnen Abschnitte zu legen. Die Zusammenfassung betont die formale Struktur des Werkes und seine Funktion als Ausdruck der Minne.
Schlüsselwörter
Ulrich von Liechtenstein, Das Frauenbuch, Frauendienst, Minnelyrik, Mittelalter, Prolog, Epilog, höfische Literatur, Frauenbild, autobiografische Elemente.
Häufig gestellte Fragen zu Ulrich von Lichtensteins „Das Frauenbuch“
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über Ulrich von Lichtensteins „Das Frauenbuch“. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Werkes im Kontext der mittelalterlichen Minnelyrik und der Darstellung der Frau in Ulrichs Werk.
Welche Themen werden in „Das Frauenbuch“ behandelt?
Das „Frauenbuch“ behandelt zentrale Themen der Minnelyrik des Mittelalters. Es untersucht die Beziehung zwischen Ritter und Frau, die Verehrung der Frau und die Rolle der Frau in der höfischen Gesellschaft. Die Arbeit analysiert die Struktur des Werkes, insbesondere die Funktion von Prolog und Epilog, und beleuchtet die Darstellung der Frau aus der Perspektive Ulrichs von Liechtenstein.
Wie ist die Datei strukturiert?
Die Datei ist in verschiedene Abschnitte gegliedert: Ein Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über die behandelten Kapitel. Die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte werden klar definiert. Die Kapitelzusammenfassungen bieten detaillierte Einblicke in den Inhalt der einzelnen Abschnitte. Schließlich werden wichtige Schlüsselwörter zur besseren Orientierung und Suche aufgeführt.
Welche Kapitel werden in der Datei behandelt?
Die Datei behandelt folgende Kapitel: 1. Autor und Werke (Biographie Ulrichs von Liechtenstein und Einordnung seines Werkes), 2. „Das Frauenbuch“ - Inhalt (Beschreibung des Inhalts und der Struktur), 3. Minnelyrik im Mittelalter (Kontextualisierung des Werkes), 4. Der Frauenpreis - Die Frau aus der Sicht des Ritters Ulrich (Analyse der Darstellung der Frau) und 5. Die Beziehung zwischen Prolog und Epilog (Vergleich und Analyse).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für „Das Frauenbuch“?
Die Schlüsselwörter umfassen: Ulrich von Liechtenstein, Das Frauenbuch, Frauendienst, Minnelyrik, Mittelalter, Prolog, Epilog, höfische Literatur, Frauenbild, autobiografische Elemente. Diese Begriffe ermöglichen eine effiziente Suche und helfen, den Inhalt des Werkes und seiner Kontextualisierung zu verstehen.
Was ist die Zielsetzung der Analyse von „Das Frauenbuch“?
Die Zielsetzung der Analyse ist es, Ulrich von Lichtensteins „Das Frauenbuch“ im Kontext seiner literarischen Werke und der Minnelyrik des Mittelalters zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die Struktur, die Funktion von Prolog und Epilog und beleuchtet die Darstellung der Frau in Ulrichs Werk. Es geht um ein umfassendes Verständnis des Werkes innerhalb seines historischen und literarischen Kontextes.
Wie wird die Frau in „Das Frauenbuch“ dargestellt?
Die Darstellung der Frau in „Das Frauenbuch“ ist ein zentraler Aspekt der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie Ulrich von Liechtenstein die Frau in seinem Werk präsentiert und welche Rolle sie in seinem Verständnis von Minne und höfischer Liebe spielt. Der Fokus liegt auf der Interpretation des Frauenbildes im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft und Literatur.
Welche Rolle spielen Prolog und Epilog in „Das Frauenbuch“?
Prolog und Epilog spielen eine wichtige Rolle in der Struktur und Interpretation von „Das Frauenbuch“. Die Analyse untersucht die Funktion dieser beiden Teile und vergleicht sie miteinander. Sie beleuchten, wie Prolog und Epilog den Inhalt des Werkes einrahmen und zur Gesamtdeutung beitragen.
- Quote paper
- Julia Patricia Kluth (Author), 2008, Das Frauenbuch - Ulrich von Liechtenstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184557