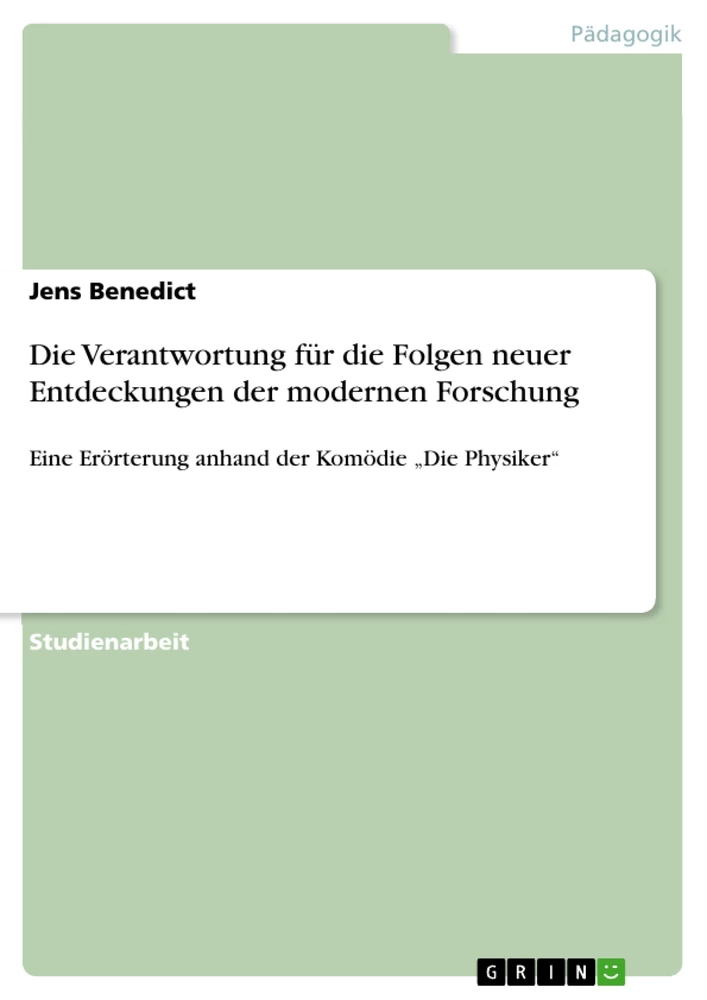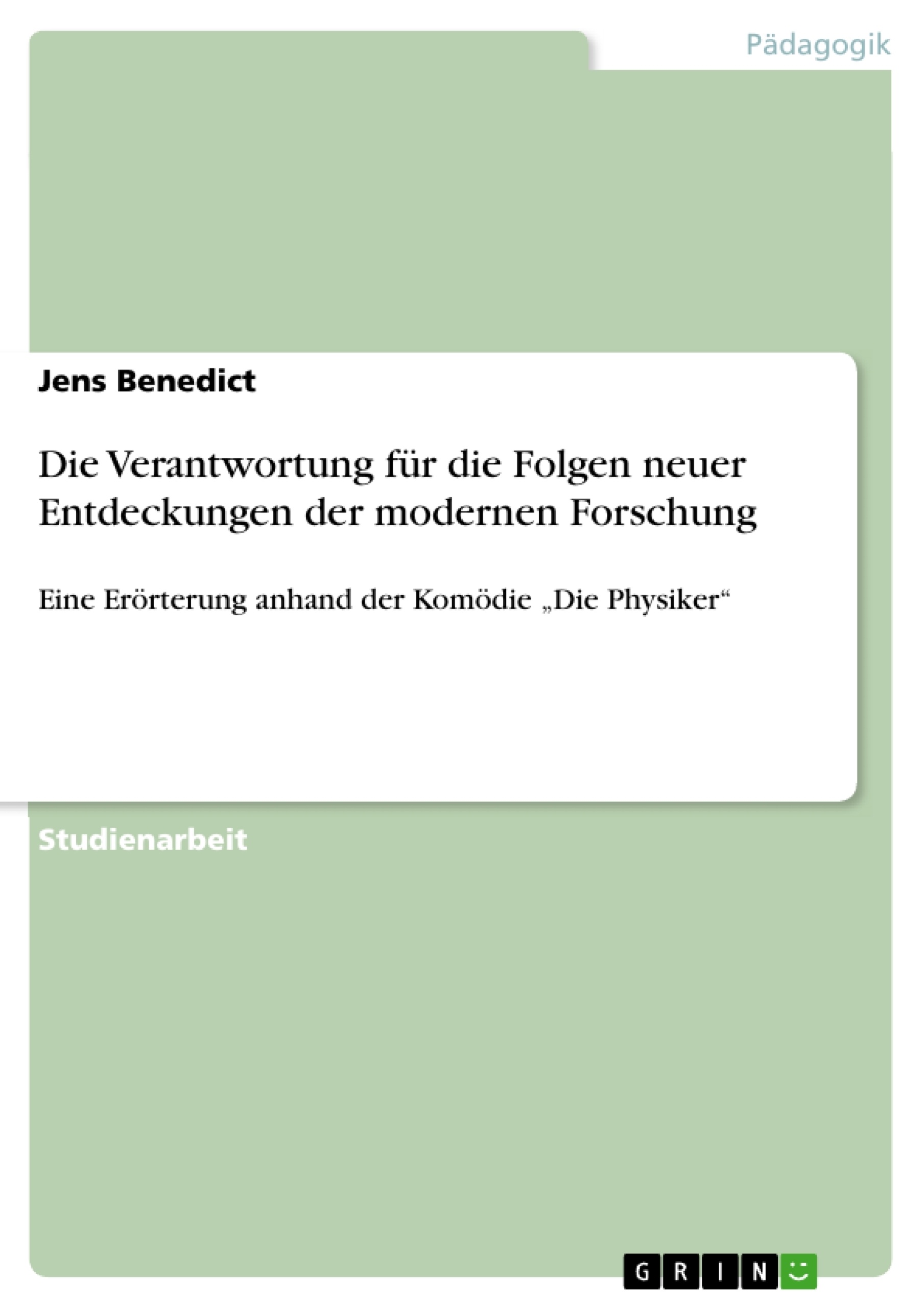Die Wissenschaft sieht sich seit Bestehen der Menschheit immer wieder dem Problem der Zweischneidigkeit von Erfindungen gegenüber. Einerseits geschaffen um Positives zu erzeugen, aber gleichzeitig auch andererseits eine neue, negative Facette für das menschliche Zusammenleben hervorzubringen.
Als großer Gewissenkonflikt der modernen Wissenschaft gilt das Beispiel der Genforschung. Einerseits hilft es der menschlichen Forschung auf dem Gebiet der Erbkrankheiten enorm, anderseits wird in den Evolutionsverlauf durch Klonung und künstliche Behandlung von kranken Genen massiv eingegriffen.
Wo liegt da die moralisch noch verantwortbare Grenze der Wissenschaft? Darf alles Gedachte auch erforscht werden? Müssen Wissenschaftler immer die Folgen ihrer Entdeckungen abschätzen? Lässt sich die Freiheit der Wissenschaft durch moralische Grenzen überhaupt noch einschränken?
In Dürrenmatts Tragödie „Die Physiker“ setzt sich der Protagonist und Wissenschaftler Möbius selbst seine moralische Schranke, als er die Dimension seiner Entdeckung der „Weltformel“ erkennt. Er will nicht die Schuld übernehmen für die Folgen, welche die „Weltformel“ in falschen Händen auslösen würde. Deshalb lässt er sein Gedachtes unerforscht und vernichtet seine Aufzeichnungen. Doch wird nicht alles Denkbare auch irgendwann gedacht? Nimmt man als Wissenschaftler mit dem Erdenken etwas Neuem, alle Schuld an den entsprechenden Konsequenzen in der Zukunft auf sich?
Ich möchte in meiner folgenden Seminararbeit dieses Thema, unter anderem am Beispiel Dürrenmatts Protagonisten Möbius erörtern. Ich werde erst eine kurze biografische Übersicht zum Autor und seinem Gesellschaftsbild allgemein liefern. Danach werde ich eine Kurzdefinition des Schuldbegriffes aufzeigen, um dann im Hauptteil meiner Arbeit meine Kernfrage zu erörtern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzbiografie des Autors
- Welt-, Geschichts- und Gesellschaftsbild Dürrenmatts
- Definition des Schuldbegriffs
- Schuld als Verantwortlichkeit
- Schuld im strafrechtlichen Sinn
- Schuld des Möbius an der Folgen seiner Entdeckung unter den Aspekten der definierten Schuldbegriffe
- ,,Muss ein Wissenschaftler die möglichen Folgen seiner Entdeckungen schon vor der Erforschung abwägen?“ – Erörterung
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage der Verantwortung für die Folgen wissenschaftlicher Entdeckungen. Am Beispiel der Komödie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt wird untersucht, inwieweit ein Wissenschaftler die möglichen Folgen seiner Forschungsergebnisse abwägen muss und ob er für die daraus resultierenden Konsequenzen verantwortlich ist.
- Die Zweischneidigkeit von wissenschaftlichen Entdeckungen
- Der Schuldbegriff und seine Anwendung auf wissenschaftliche Erkenntnisse
- Die Verantwortung des Wissenschaftlers für die Folgen seiner Forschung
- Die Freiheit der Wissenschaft und ihre moralischen Grenzen
- Die Rolle des Einzelnen in einer komplexen und technologisierten Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der wissenschaftlichen Verantwortung ein und stellt die Problematik der Zweischneidigkeit von Entdeckungen anhand des Beispiels der Genforschung dar. Anschließend wird die Kernfrage der Arbeit formuliert, die sich mit der Schuld des Wissenschaftlers an den Folgen seiner Forschung befasst.
Im zweiten Kapitel wird eine kurze Biografie des Autors Friedrich Dürrenmatt vorgestellt, wobei sein Welt-, Geschichts- und Gesellschaftsbild beleuchtet wird. Dürrenmatt sieht die moderne Welt als chaotisch und undurchschaubar an, geprägt von Bevölkerungswachstum, Technisierung und der Bedrohung durch Massenvernichtungsmittel. Er betont die Gesellschaftsbezogenheit seiner Literatur und die Notwendigkeit, ein gesellschaftliches Gewissen zu entwickeln.
Das dritte Kapitel widmet sich der Definition des Schuldbegriffs. Es werden zwei Aspekte des Schuldbegriffs erläutert: Schuld als Verantwortlichkeit und Schuld im strafrechtlichen Sinn. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Aspekten ist wichtig, um die Schuld des Wissenschaftlers im Kontext seiner Forschungsergebnisse zu beurteilen.
Das vierte Kapitel untersucht die Schuld des Protagonisten Möbius in Dürrenmatts „Die Physiker“ im Hinblick auf die Folgen seiner Entdeckung der „Weltformel“. Möbius verzichtet auf die Veröffentlichung seiner Erkenntnisse, um die Menschheit vor den möglichen Gefahren zu schützen. Die Frage stellt sich, ob er mit dieser Entscheidung die Verantwortung für die Folgen seiner Entdeckung ablehnen kann.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Frage, ob ein Wissenschaftler die möglichen Folgen seiner Entdeckungen schon vor der Erforschung abwägen muss. Es wird diskutiert, inwieweit die Freiheit der Wissenschaft durch moralische Grenzen eingeschränkt werden kann und ob der Wissenschaftler für alle möglichen Konsequenzen seiner Forschung verantwortlich ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Verantwortung für die Folgen wissenschaftlicher Entdeckungen, die Komödie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt, den Schuldbegriff, die Freiheit der Wissenschaft, die moralischen Grenzen der Forschung und die Rolle des Einzelnen in einer komplexen und technologisierten Welt.
- Quote paper
- Jens Benedict (Author), 2007, Die Verantwortung für die Folgen neuer Entdeckungen der modernen Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184504