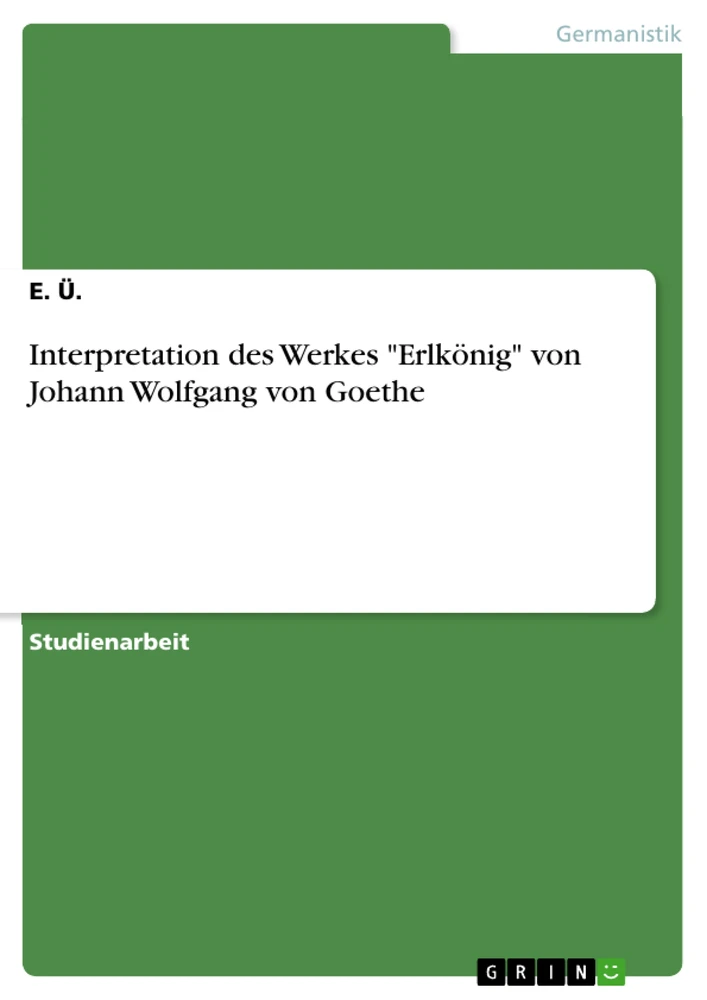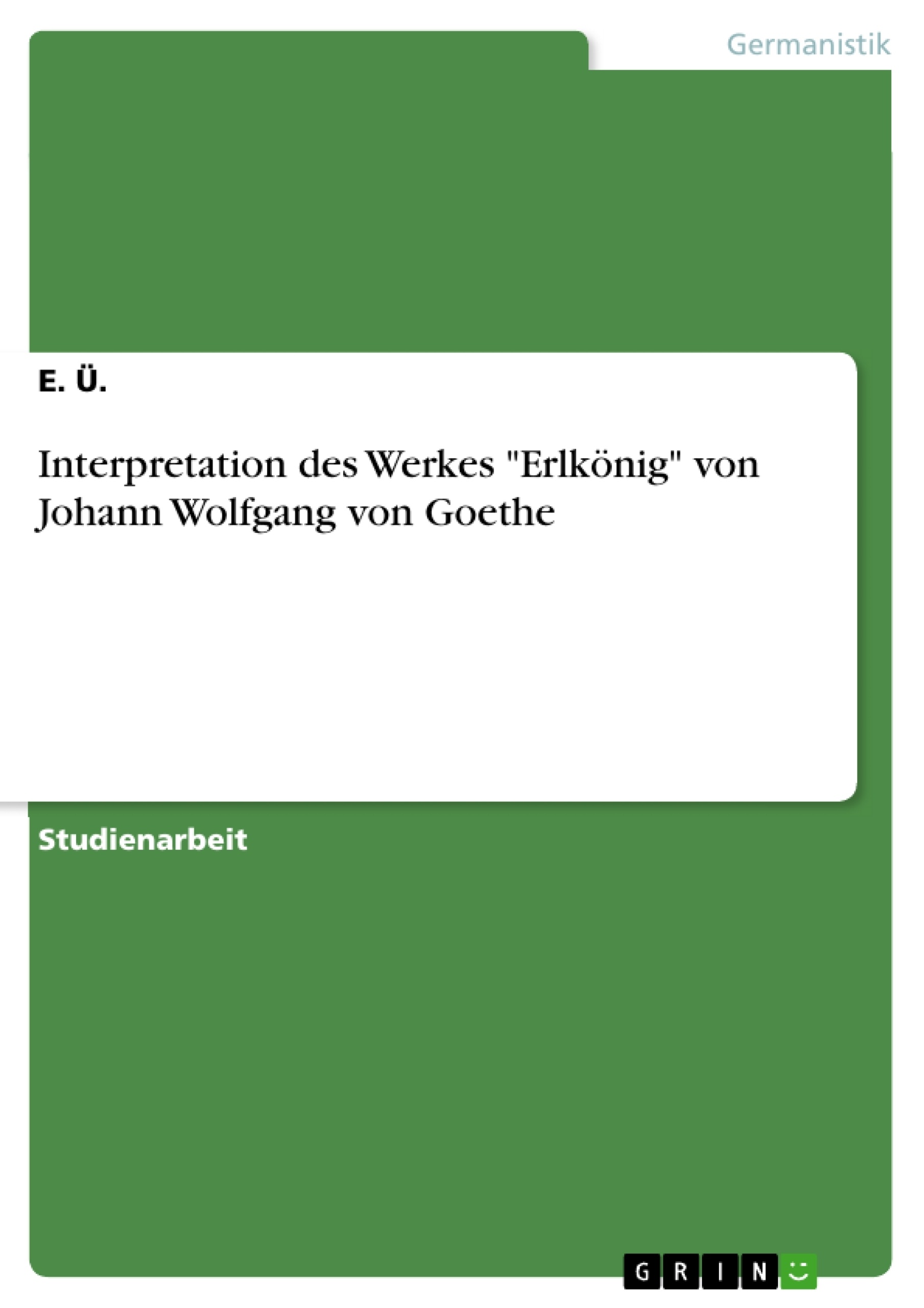Goethes Ballade „Erlkönig”, die seiner voritalienischen Weimarer Zeit zugehört, ist im Jahre 1782 entstanden und eröffnet das Singspiel Die Fischerin, mit dem Untertitel „auf dem natürlichen Schauplatz zu Tiefurth vorgestellt”.
Johann Gottfried Herder, der ein Freund Goethes war, übersetzte eine alte dänische Volksballade ins Deutsche, wobei er irrtümlich den Elfenkönig als Erlkönig verstand. Dieser Übersetzungsfehler wurde dann von Goethe übernommen. Hirschenauer schreibt dazu:
„Gerade das falsch als ‘Erlkönig’ wiedergegebene dänische Wort, ‘ellerkonge’, das ‘Elfenkönig’ heißt, hat Goethes wache Phantasie beflügelt, die in seinem Innern schon schlummernden naturmagischen Vorstellungen in einer neuen Form auszudrücken”.
Goethe nahm als Grundlage die Ballade „Erlkönigs Tochter” aus Herders Volkslieder-Sammlung (1778/79), überarbeitete sie sprachlich und daraus entstand Erlkönig. Herders Gedicht „Erlkönigs Tochter” ist von der magischen Verlockung und der den Menschen verderbenden Macht geprägt. Gleiches gilt Goethes Ballade „Erlkönig”.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Entstehung der Ballade „Erlkönig”
- 2. Die äußere Gestalt von „Erlkönig”
- 3. Der inhaltliche Aufbau des Gedichtes
- 4. Die Redesituationen und Wortgebrauch
- 5. Die Sinndeutung der Ballade
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit einer detaillierten Interpretation von Goethes Ballade „Erlkönig“. Ziel ist es, die Entstehung, die äußere Form, den inhaltlichen Aufbau, die sprachlichen Besonderheiten und die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten des Gedichtes zu beleuchten.
- Entstehung und Kontext der Ballade im Rahmen des Tiefurter Kreises.
- Analyse der sprachlichen Gestaltung, Metrik und Rhythmus.
- Untersuchung der verschiedenen Redesituationen und des Wortgebrauchs.
- Interpretation der symbolischen Bedeutung der Figuren und Motive.
- Erforschung der verschiedenen Sinndeutungen und der Relevanz des Gedichtes bis heute.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Entstehung der Ballade „Erlkönig”: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte von Goethes „Erlkönig“, die im Jahr 1782 im Kontext des Singspiels „Die Fischerin“ anzusiedeln ist. Es wird die Aufführung in Tiefurt und die spätere Aufnahme in verschiedene Goethe-Ausgaben beschrieben. Besonders hervorgehoben wird der Einfluss von Johann Gottfried Herder und dessen Übersetzung einer dänischen Volksballade, die den „Elfenkönig“ irrtümlich als „Erlkönig“ interpretierte. Goethe adaptierte dieses Missverständnis und entwickelte daraus seine eigene Ballade, wobei er sich von Herders „Erlkönigs Tochter“ inspirierte und diese sprachlich überarbeitete. Das Kapitel verdeutlicht somit die Verbindungen zwischen Volksdichtung, Naturmagie und Goethes eigener künstlerischer Entwicklung.
2. Die äußere Gestalt von „Erlkönig”: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der formalen Struktur der Ballade. Es werden die acht Strophen mit jeweils vier Versen im aabb-Schema beschrieben, sowie die männliche Kadenz und der wechselnde Rhythmus, der zwischen Jamben und Daktylen variiert. Die Metrik ist nicht einheitlich, sondern folgt dem dramatischen Handlungsverlauf. Der Wechsel zwischen Jamben und Daktylen erzeugt eine Spannung und Unruhe, die die emotionale Intensität des Geschehens verstärkt. Besonders werden die Stellen mit Daktylen herausgestellt, die Erlkönigs Verführerschaft und die Bedrohung des Kindes betonen. Die Analyse des Rhythmus zeigt, wie die Form die Bedeutung des Textes unterstreicht.
3. Der inhaltliche Aufbau des Gedichtes: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht erstellt werden.)
4. Die Redesituationen und Wortgebrauch: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Goethe, Erlkönig, Ballade, Volksdichtung, Herder, Naturmagie, Metrik, Rhythmus, Redesituation, Interpretation, Symbolismus.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Erlkönig"
Was ist der Inhalt der HTML-Datei?
Die HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine akademische Arbeit zur Interpretation von Goethes Ballade "Erlkönig". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der Kapitel 1 und 2, sowie eine Liste von Schlüsselbegriffen. Die Kapitel 3 und 4 sind in der vorliegenden Vorschau nicht zusammengefasst.
Welche Kapitel werden in der Vorschau zusammengefasst?
Die Vorschau enthält Zusammenfassungen von Kapitel 1 ("Die Entstehung der Ballade „Erlkönig”") und Kapitel 2 ("Die äußere Gestalt von „Erlkönig”"). Kapitel 1 beleuchtet die Entstehungsgeschichte im Kontext des Tiefurter Kreises, den Einfluss von Herder und die Adaption einer dänischen Ballade. Kapitel 2 analysiert die formale Struktur der Ballade, Metrik (aabb-Schema, männliche Kadenz), Rhythmus (Jamben und Daktylen) und deren Wirkung auf die emotionale Intensität des Gedichtes.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung, die äußere Form (Metrik und Rhythmus), den inhaltlichen Aufbau, die sprachlichen Besonderheiten (Redesituationen und Wortgebrauch) und die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten von Goethes "Erlkönig". Es werden die Verbindungen zwischen Volksdichtung, Naturmagie und Goethes künstlerischer Entwicklung untersucht, sowie die symbolische Bedeutung der Figuren und Motive.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Goethe, Erlkönig, Ballade, Volksdichtung, Herder, Naturmagie, Metrik, Rhythmus, Redesituation, Interpretation, Symbolismus.
Wo finde ich die Zusammenfassungen der Kapitel 3 und 4?
Die Zusammenfassungen für Kapitel 3 ("Der inhaltliche Aufbau des Gedichtes") und Kapitel 4 ("Die Redesituationen und Wortgebrauch") fehlen in dieser Vorschau.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, eine detaillierte Interpretation von Goethes "Erlkönig" zu liefern, indem die Entstehung, die äußere Form, der inhaltliche Aufbau, die sprachlichen Besonderheiten und die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten des Gedichtes beleuchtet werden.
Wie ist die äußere Form des "Erlkönigs" aufgebaut?
Der "Erlkönig" besteht aus acht Strophen mit jeweils vier Versen im aabb-Schema. Er hat eine männliche Kadenz und einen wechselnden Rhythmus aus Jamben und Daktylen, der die Spannung und Unruhe des Geschehens verstärkt.
- Quote paper
- Magister Artium E. Ü. (Author), 2002, Interpretation des Werkes "Erlkönig" von Johann Wolfgang von Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184251