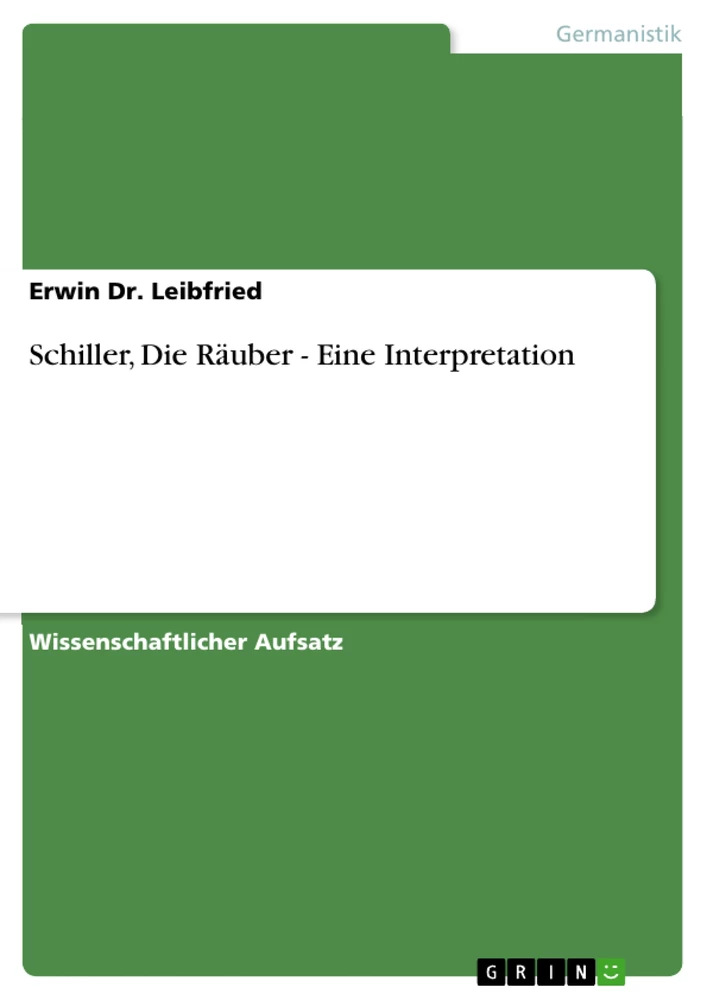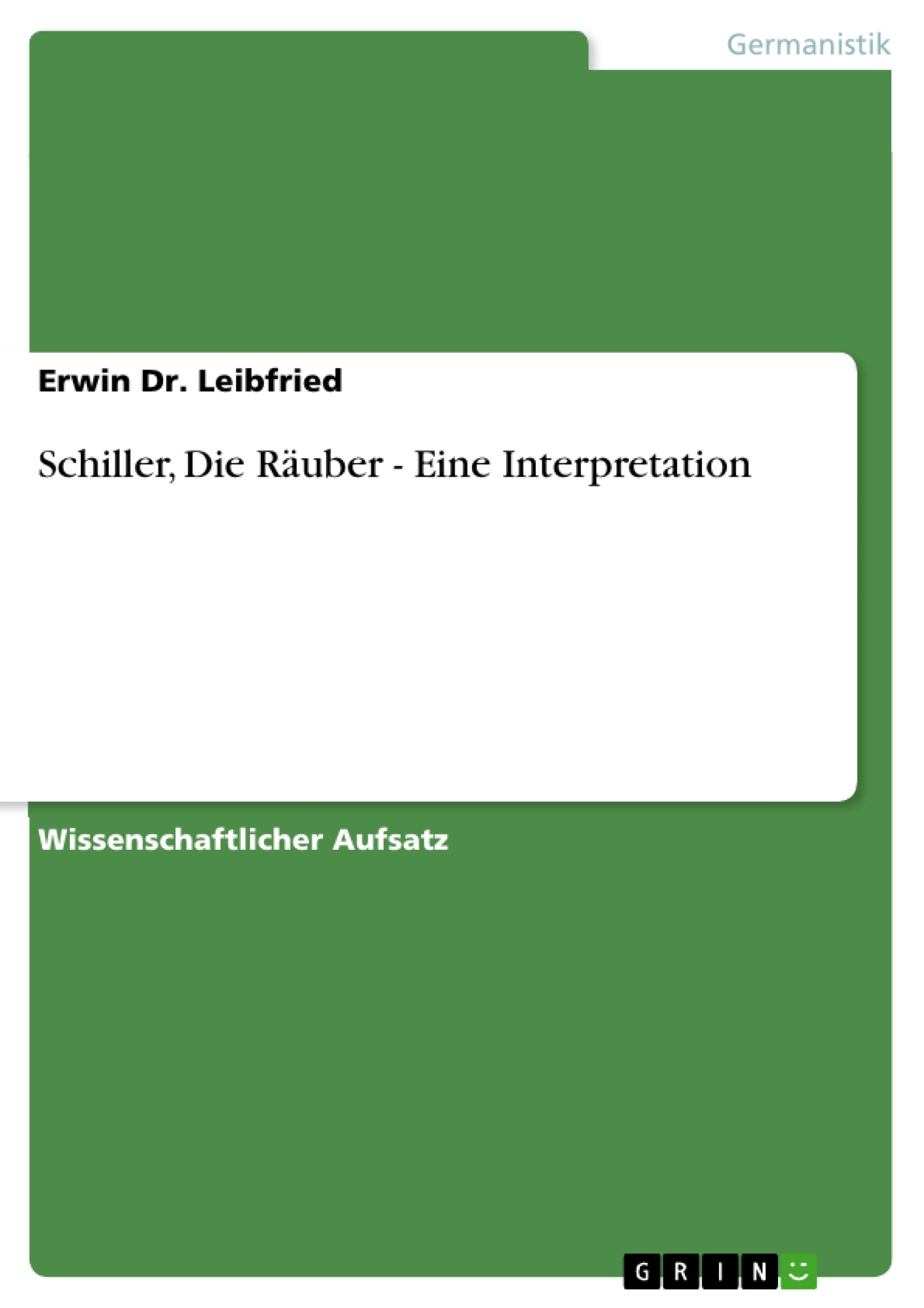Die Räuber
Erbrecht und Affektstruktur
Die ersten Produkte Goethes und Schillers sind von einer Unreife, ja selbst von einer Rohheit und Barbarei, vor der man erschrecken kann.
Hegel, Ästhetik, ed. Bassenge,Bd. I, S. 39
Räuber und Mörder sind in Zeiten der Noth keine seltene Erscheinung.
B. Becker, Actenmäßige Geschichte der Räuberbanden an den beyden Ufern des Rheins, Erster Theil ... Cöln, 1844, S. 3
Inhalt
(1)
Textgeschichte - Vorrede
(2)
Briefintrige - Franz als unmoralischer Charakter - Der be-nachteiligte, kalte Franz gegen den erstgeborenen, gefühl-vollen Karl - Vater Moor als Repräsentant einer deformie-renden Institution - Ungleiche Verfügung über Güter und d ie dadurch neidbestimmte Affektstruktur von Franz.
(3)
Karls Unfähigkeit zu humanem Handeln - aus Enttäu-schung zum Räuberhauptmann - Spiegelberg als Böse-wicht - Gleichverteilung der Güter als Ziel setzt Kritik der Moral am Staat in Handlung um - Das Scheitern legitimer politischer Aktion des Subjekts im Absolutismus
(4)
Auseinandersetzung Franz - Amalia - Macht der Vernunft als Form der Zerstörung - Bündnis Franz - Herrmann - Das Leid der Betrogenen - zerstörender Einfluß auch in der Familie - Der alte Moor als ‘Stellvertreter Gottes’ und die Realität von Ausbeutung und Unterdrückung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Räuber
- (1) Textgeschichte - Vorrede
- (2) Briefintrige - Franz als unmoralischer Charakter - Der benachteiligte, kalte Franz gegen den erstgeborenen, gefühlvollen Karl - Vater Moor als Repräsentant einer deformierenden Institution - Ungleiche Verfügung über Güter und die dadurch neidbestimmte Affektstruktur von Franz.
- (3) Karls Unfähigkeit zu humanem Handeln aus Enttäuschung zum Räuberhauptmann - Spiegelberg als Bösewicht - Gleichverteilung der Güter als Ziel setzt Kritik der Moral am Staat in Handlung um - Das Scheitern legitimer politischer Aktion des Subjekts im Absolutismus
- (4) Auseinandersetzung Franz - Amalia - Macht der Vernunft als Form der Zerstörung - Bündnis Franz - Herrmann - Das Leid der Betrogenen - zerstörender Einfluß auch in der Familie - Der alte Moor als 'Stellvertreter Gottes' und die Realität von Ausbeutung und Unterdrückung.
- (5) Spiegelberg contra Karl - Karls Handlungsmotivation - Die Bühne als Gericht - Ankündigung der Peripetie - Das Scheitern menschlicher Pläne
- (6) Franz und Amalia - keine mundane Realisierung von Glückseligkeit - Prometheische Rebellion versus Mißlingen menschlicher Handlungen - Melancholie und Glückswechsel durch Roller-Episode - Kosinsky-Szene als Kampf wider moralisches Übel - Karls Selbstverständnis als Räuber - Subjektives besiegt Objektiv-Allgemeines - Der Widerstand der Materie und die Aktualität des Dramas
- (7) Karl im väterlichen Schloß - Nichterkennen durch Entfremdung - Notwendigkeit der scheiternden Versöhnung - Franz als Nihilist - Franz und Karl: Zwei Widersacher aufklärerischer Ideale - Die menschenverschuldete Katastrophe - Zurücknahme des prometheischen Programms - Aufstandsversuch Spiegelbergs - Brutus-Caesar-Lied Karls oder der gescheiterte Kampf wider die Festen des Absolutismus - pervertierte Aktionen der Söhne gegenüber Vater als Rechtsvertreter
- (8) Franzens Aufgabe der nihilistischen Position - Der alte Moor als Vertreter des Neuen Testaments - Die Ermordung der Geliebten und die Unmöglichkeit von Glück - Falsche Lösungsversuche und Resignation - evolutionäre Entfaltung zum Humanen als einzige Alternative - Der Schluß: die Apotheose der Moral - Das klassische Programme einer Förderung der Menschheitsentwicklung
- (9) Einfluß barocker Operntechnik auf den jungen Schiller - Zusammenstoß von aufklärerischem und barockem Denken - Resignation und Optimismus - Rekonstruktion der dramatischen Argumentation - lösungsloser Schluß - die Welt als me on - Kunst als Trompete des Fortschritts und als Requiem menschlicher Planungen
- 2. Erbrecht und Affektstruktur
- (1)
- 3. Die Räuber
- 4. Erbrecht und Affektstruktur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Schillers "Die Räuber" und untersucht die damit verbundenen Fragen des Erbrechts und der Affektstrukturen. Sie beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Dramas und untersucht die verschiedenen Interpretationen und die Aktualität des Stücks im Kontext der Aufklärung und des Barocks.
- Die Entstehungsgeschichte und Textgeschichte von Schillers "Die Räuber"
- Die Darstellung von Erbrecht und dessen Auswirkungen auf die Charaktere
- Die Rolle von Affekten und Emotionen in der Handlung
- Die Kritik am Absolutismus und die Darstellung politischer Verhältnisse
- Der Konflikt zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlichen Normen
Zusammenfassung der Kapitel
1, Die Räuber: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Analyse von Schillers "Die Räuber", beginnend mit der Textgeschichte und Vorrede. Es untersucht die Intrige zwischen Franz und Karl, die durch ungleiches Erbrecht und deformierte Familienstrukturen ausgelöst wird. Karls Enttäuschung und sein Weg zum Räuberhauptmann werden detailliert beleuchtet, ebenso wie Spiegelbergs Rolle als Bösewicht und die Kritik an der Staatsmoral. Das Kapitel analysiert die Beziehungen zwischen Franz und Amalia, die zerstörerische Macht der Vernunft und das Leid der Betrogenen. Schließlich werden Karls Handlungsmotivationen, das Scheitern menschlicher Pläne und die Bedeutung der Bühne als Gericht untersucht. Die Kapitel (6-9) verfolgen den Verlauf der Handlung weiter mit den verschiedenen Konflikten, dem Scheitern prometheischer Rebellion, der Auseinandersetzung mit moralischer Korruption, und den letzten Akten des Dramas, die die Unmöglichkeit von Glück und die Notwendigkeit einer evolutionären Entwicklung zum Humanen aufzeigen.
2, Erbrecht und Affektstruktur: Der zweite Teil befasst sich mit den komplexen Problemen rund um das Drama "Die Räuber", insbesondere mit seiner Entstehung und der relativ unklaren Textgeschichte. Es wird die Schwierigkeit der Rekonstruktion der genetischen Schichtung des Textes thematisiert, und die Bedeutung der verschiedenen Fassungen, einschließlich der "unterdrückten Bögen", für das Verständnis des Werks wird diskutiert. Die Arbeit untersucht die Anpassungen an die Zensur und ihren Einfluss auf die Interpretation. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung des Stücks zur realen Welt Schillers, mit der Analyse von realen Bezügen und historischen Ereignissen, die das Drama inspiriert haben könnten. Der Abschnitt analysiert Schillers eigene Stellungnahme in der Vorrede zur ersten Auflage und beleuchtet die Intentionen des Autors, seine Auseinandersetzung mit der Aufklärungspoetik, und wie diese die Gestaltung der Charaktere beeinflusst hat.
3, Die Räuber: Dieses Kapitel untersucht weiter die historische Einbettung und die Quellen des Dramas. Es wird der Versuch unternommen, die Beweisinteressen und Intentionen Schillers herauszuarbeiten. Die Verlegung der Handlung ins Spätmittelalter und die damit verbundenen Herausforderungen für die Interpretation werden diskutiert. Die Anpassungen des Stücks an die Zensurvorschriften und ihre Auswirkungen auf die aktuelle Schärfe des Werks werden analysiert, ebenso wie Schillers Bemühen, eine Verbindung zwischen fiktionaler Handlung und der realen Welt seines Jahrhunderts herzustellen. Die Arbeit untersucht den Bezug zu realen Ereignissen und Personen, die als Inspiration für das Drama gedient haben könnten.
4, Erbrecht und Affektstruktur: Dieser Teil vertieft die Analyse der Vorrede zu "Die Räuber" und untersucht das Verhältnis von Schiller zur Aufklärungspoetik. Es wird beleuchtet, wie Schiller die Legalität seines provokanten Stücks zu rechtfertigen versucht, und wie er den Schein der Ordnung für die staatliche Zensur wahren muss. Die Untersuchung der "Natur", die Schiller in seiner Vorrede erwähnt, wird kritisch hinterfragt. Die Analyse der psychologischen Methode und des mechanistischen Denkens des 18. Jahrhunderts im Kontext des Werks wird weiter vertieft, ebenso die Frage der Intentionen des Autors und seiner gesellschaftlichen Kritik.
Schlüsselwörter
Die Räuber, Schiller, Erbrecht, Affektstruktur, Aufklärung, Barock, Absolutismus, Moral, Gesellschaftliche Kritik, Textgeschichte, Interpretation, Prometheische Rebellion, Nihilismus.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers "Die Räuber"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit Schillers Drama "Die Räuber" auseinandersetzt. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Dramas im Kontext von Erbrecht, Affektstrukturen, Aufklärung und Barock.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte und Textgeschichte von Schillers "Die Räuber", die Darstellung des Erbrechts und dessen Auswirkungen auf die Charaktere, die Rolle von Affekten und Emotionen in der Handlung, die Kritik am Absolutismus und die Darstellung politischer Verhältnisse, sowie den Konflikt zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlichen Normen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Figuren Franz und Karl Moor sowie deren Motivationen und Handlungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert. Kapitel 1 bietet eine detaillierte Analyse des Dramas "Die Räuber" selbst, von der Vorrede bis zum Schluss. Kapitel 2 und 4 befassen sich mit den Aspekten des Erbrechts und der Affektstrukturen im Drama und im Kontext der Entstehungszeit. Kapitel 3 befasst sich mit der historischen Einbettung und den Quellen des Dramas sowie Schillers Intentionen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Die Räuber, Schiller, Erbrecht, Affektstruktur, Aufklärung, Barock, Absolutismus, Moral, Gesellschaftliche Kritik, Textgeschichte, Interpretation, Prometheische Rebellion, Nihilismus.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Schillers "Die Räuber" und untersucht die damit verbundenen Fragen des Erbrechts und der Affektstrukturen. Sie beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Dramas und untersucht die verschiedenen Interpretationen und die Aktualität des Stücks im Kontext der Aufklärung und des Barocks.
Welche Aspekte von Schillers "Die Räuber" werden im Detail untersucht?
Die Analyse umfasst die Intrige zwischen Franz und Karl Moor, die durch ungleiches Erbrecht und deformierte Familienstrukturen ausgelöst wird; Karls Weg zum Räuberhauptmann; Spiegelbergs Rolle; die Kritik an der Staatsmoral; die Beziehungen zwischen Franz und Amalia; die zerstörerische Macht der Vernunft; das Leid der Betrogenen; Karls Handlungsmotivationen; das Scheitern menschlicher Pläne; die Bedeutung der Bühne als Gericht; die Auseinandersetzung mit moralischer Korruption; die Unmöglichkeit von Glück und die Notwendigkeit einer evolutionären Entwicklung zum Humanen.
Welche Rolle spielt die Aufklärung im Kontext des Dramas?
Die Arbeit untersucht die Auseinandersetzung Schillers mit der Aufklärung und deren Einfluss auf die Gestaltung des Dramas. Sie analysiert, wie Schiller die Legalität seines provokanten Stücks zu rechtfertigen versuchte und wie er den Schein der Ordnung für die staatliche Zensur wahren musste. Die Analyse der "Natur", die Schiller in seiner Vorrede erwähnt, wird kritisch hinterfragt.
Wie wird die historische Einbettung des Dramas behandelt?
Die Arbeit untersucht die historische Einbettung und die Quellen des Dramas. Sie beleuchtet die Verlegung der Handlung ins Spätmittelalter und die damit verbundenen Herausforderungen für die Interpretation. Die Anpassungen des Stücks an die Zensurvorschriften und ihre Auswirkungen auf die aktuelle Schärfe des Werks werden ebenso analysiert wie Schillers Bemühen, eine Verbindung zwischen fiktionaler Handlung und der realen Welt seines Jahrhunderts herzustellen. Die Arbeit untersucht den Bezug zu realen Ereignissen und Personen, die als Inspiration für das Drama gedient haben könnten.
- Quote paper
- Erwin Dr. Leibfried (Author), 1985, Schiller, Die Räuber - Eine Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184231